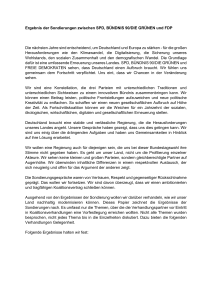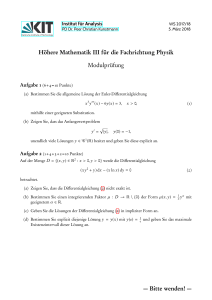Der digitale Reifegrad der Schweizer Kliniken & Spitäler Die Digitalisierung in Schweizer Spitälern. Eine Analyse und Handlungsempfehlungen. Master-Thesis Zürcher Fachhochschule HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich eingereicht bei: Sven Ruoss Studiengangleiter CAS Social Media Management vorgelegt von: Stefan Lienhard Studiengang: MAS Digital Business Matrikelnummer: 15-523-806 Ort, Datum: Zürich, 02. Juli 2018 Der digitale Reifegrad der Schweizer Kliniken & Spitäler Die Digitalisierung in Schweizer Spitälern. Eine Analyse und Handlungsempfehlungen. + Master-Thesis von Stefan Lienhard MAS Digital Business Zürich, 02. Juli 2018 Management Summary «Digital Health», die Digitalisierung des Gesundheitswesens, beschäftigt derzeit die Entscheidungsträger von Kliniken und Spitälern. Sie sehen sich vermehrt mit Fragestellungen zu verschiedenen digitalen Wirkungsfeldern konfrontiert. Der technologische Wandel zwingt sie dazu, ihr Geschäftsmodell zu hinterfragen und adaptieren, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben und im härter werdenden Wettbewerb erfolgreich zu bestehen. Doch wie weit ist die Digitalisierung in den Schweizer Spitälern fortgeschritten und welche Kompetenz- oder Handlungsfelder lassen sich daraus ableiten? Welche Relevanz geniessen digitale Themen in Spitälern? Wie sieht ihre digitale Bereitschaft und Reife aus und welches sind mögliche hemmende Faktoren für eine erfolgreiche Digitalisierung? Die vorliegende Master-Thesis analysiert Schweizer Kliniken und Spitäler in Bezug auf unterschiedliche digitale Dimensionen und beantwortet diese Fragen. Im Rahmen der empirischen Untersuchung werden zwei Methoden angewendet: als quantitatives Instrument wird eine Online-Umfrage in Schweizer Spitälern durchgeführt, die qualitative Datenerhebung erfolgt durch Experteninterviews mit vier Branchenkennern. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass das Spitalwesen ganz am Anfang seiner digitalen Reise steht. Die Branche hinkt der Digitalisierung deutlich hinterher und es fehlen Erfolgsstories oder Leuchtturmprojekte. Zwar sprechen 88 % der Befragten dem digitalen Wandel in der Spitalbranche eine sehr hohe Relevanz zu, in den einzelnen Kliniken und Spitälern ist davon jedoch nicht viel zu spüren. In mehr als der Hälfte der Spitäler fehlt eine Digitalstrategie und folglich ein strukturiertes und koordiniertes Vorgehen. Mehrheitlich liegt die Zuständigkeit für digitale Anliegen, stark projektgetrieben, bei der IT-Abteilung und nicht bei der Geschäftsleitung. Die Analyse unterschiedlicher Wirkungsfelder der Digitalisierung hat gezeigt, dass die Spitäler in den meisten Bereichen nur knapp genügende Werte erzielen. Am besten schneiden sie bei der «Informatik & Technologie ICT» ab, wo hingegen bei den Dimensionen «Organisation», «Zusammenarbeit» «Digitale Transformation» oder «Prozessdigitalisierung» etwa gleichermassen akuter Handlungsbedarf besteht. Digitalisierung umfasst technologische, kulturelle und ökonomische Aspekte und in diese gilt es für alle Spitaltypen und -grössen stärker und zielgerichtet zu investieren. Doch genau dieses Risikokapital, welches Investitionen in unbekannte Technologien, nichtmedizinische Innovationen und potentiell neue Geschäftsfelder ermöglicht, wird als grösster Hemmfaktor erachtet. Mangelndes Knowhow auf der Managementebene und, daraus resultierend, eine fehlende Vision und Strategie sind weitere Gründe für den digitalen Rückstand. Die Spitäler sind gut beraten, ihre Haltung gegenüber «Digital Health» zu überdenken und Massnahmen in den verschiedenen digitalen Themenfeldern zu initiieren. Digitalisierung ist mehr als die Umwandlung von analog zu digital. Sie bietet die Chance, bestehende Prozesse und Abläufe völlig neu zu gestalten und ebnet so den Weg für smarte und effiziente «Spitäler 4.0». I Inhaltsverzeichnis Management Summary .................................................................................................................. I Inhaltsverzeichnis .......................................................................................................................... II Ehrenwörtliche Erklärung .............................................................................................................. V Vorwort ......................................................................................................................................... VI Glossar ........................................................................................................................................ VII 1. Einleitung ............................................................................................................................... 1 1.1. Ausgangslage ........................................................................................................................ 3 1.2. Zielsetzungen ........................................................................................................................ 3 1.3. Vorgehensweise .................................................................................................................... 4 1.4. Aufbau und Struktur der Arbeit .............................................................................................. 4 1.5. Abgrenzung ........................................................................................................................... 5 2. Grundlagen & Definitionen .................................................................................................... 7 2.1. Digitalisierung ........................................................................................................................ 7 2.2. Digitale Transformation ......................................................................................................... 8 2.3. Phasen und Handlungsfelder der digitalen Transformation .................................................. 9 2.4. Digitale Reife ....................................................................................................................... 10 2.5. Das «Digital Maturity Model» .............................................................................................. 11 2.6. Die neun Dimensionen des «Digital Maturity Model» ......................................................... 12 3. Das Gesundheits- und Spitalwesen .................................................................................... 17 3.1. Digitalisierung im Gesundheitswesen ................................................................................. 18 3.2. Digital Health ....................................................................................................................... 19 3.3. Digitalisierung in Schweizer Spitälern ................................................................................. 20 3.3.1. Stand der Digitalisierung ............................................................................................. 20 3.4. Studien & Analysen ............................................................................................................. 21 3.4.1. Analyse von KPMG ..................................................................................................... 21 3.4.2. Branchenreport der ZHAW .......................................................................................... 23 3.4.3. CEO Survey «Spitalmarkt Schweiz» von PWC Schweiz ............................................ 24 3.4.4. Weitere Quellen ........................................................................................................... 25 3.4.5. Zusammenfassung des Status Quo ............................................................................ 25 4. Empirische Untersuchung ................................................................................................... 28 4.1. Ziele und Forschungsgegenstand ....................................................................................... 29 4.2. Hypothesenbildung .............................................................................................................. 29 4.3. Potenzielle Informationsquellen .......................................................................................... 30 4.4. Forschungsmethoden .......................................................................................................... 30 4.5. Wahl der Erhebungsinstrumente ......................................................................................... 31 4.6. Online-Umfrage ................................................................................................................... 31 II 4.6.1. Aufbau des Fragebogens ............................................................................................ 32 4.6.2. Planung der Stichprobe ............................................................................................... 35 4.6.3. Evaluation Umfrage- & Auswertungstool..................................................................... 36 4.7. Experteninterviews .............................................................................................................. 36 4.7.1. Leitfaden ...................................................................................................................... 36 4.7.2. Auswahl der Interviewpartner ...................................................................................... 37 4.7.3. Auswertung der Interviews .......................................................................................... 38 5. Auswertung der Ergebnisse ................................................................................................ 41 5.1. Online-Umfrage ................................................................................................................... 41 5.1.1. Teilnehmende Personen ............................................................................................. 41 5.1.2. Teilnehmende Kliniken & Spitäler ............................................................................... 42 5.1.3. Relevanz der Digitalisierung in der Spitalbranche ...................................................... 44 5.1.4. Relevanz der Digitalisierung im Unternehmen ............................................................ 45 5.1.5. Vorhandensein einer Digitalstrategie .......................................................................... 46 5.1.6. Zuständigkeit für das Thema Digitalisierung ............................................................... 47 5.1.7. Dimension «Patientenerlebnis»................................................................................... 48 5.1.8. Dimension «Produktinnovation».................................................................................. 50 5.1.9. Dimension «Digitalstrategie» ....................................................................................... 51 5.1.10. Dimension «Organisation» .......................................................................................... 52 5.1.11. Dimension «Prozessdigitalisierung» ........................................................................... 53 5.1.12. Dimension «Zusammenarbeit» ................................................................................... 55 5.1.13. Dimension «Informatik & Technologie (ICT)» ............................................................. 56 5.1.14. Dimension «Digitale Unternehmenskultur» ................................................................. 57 5.1.15. Dimension «Digitale Transformation» ......................................................................... 59 5.1.16. Reifegrad der Branche ................................................................................................ 60 5.1.17. Reifegrad nach Spitaltypen ......................................................................................... 61 5.1.18. Reifegrad nach Spitalgrösse ....................................................................................... 62 5.1.19. Einsatz von disruptiven Technologien ......................................................................... 63 5.1.20. Hemmfaktoren der Digitalisierung ............................................................................... 63 5.1.21. Information über Ergebnisse ....................................................................................... 64 5.1.22. Feedbacks zur Online-Umfrage .................................................................................. 65 5.2. Zusammenfassung der Experteninterviews ........................................................................ 65 5.2.1. Stand der Digitalisierung ............................................................................................. 65 5.2.2. Projekte & Initiativen .................................................................................................... 66 5.2.3. Trends ......................................................................................................................... 66 5.2.4. Disruptionspotenzial .................................................................................................... 67 5.2.5. Auswirkungen auf Organisation und Unternehmenskultur .......................................... 67 5.2.6. Veränderung der Berufsbilder ..................................................................................... 68 5.2.7. Zuständigkeit ............................................................................................................... 69 III 5.2.8. Benötigte Ressourcen ................................................................................................. 69 5.2.9. Bereitschaft für Digitalisierung..................................................................................... 69 5.2.10. Technologie-Trends..................................................................................................... 70 5.2.11. Treiber der Digitalisierung ........................................................................................... 70 5.2.12. Das Spital der Zukunft ................................................................................................. 71 5.2.13. Reifegrad der Spitäler.................................................................................................. 71 5.2.14. Kritische Betrachtung der Ergebnisse ......................................................................... 71 6. Schlussbetrachtung & Handlungsempfehlungen ................................................................ 74 6.1. Beantwortung der Forschungsfragen .................................................................................. 74 6.2. Auflösung der aufgestellten Hypothesen ............................................................................ 76 6.3. Handlungsempfehlungen .................................................................................................... 78 6.4. Zusammenfassung & Ausblick ............................................................................................ 82 7. Dank .................................................................................................................................... 83 8. Anhang ................................................................................................................................ 84 8.1. Quellen- und Literaturverzeichnis........................................................................................ 84 8.2. Abkürzungsverzeichnis ....................................................................................................... 94 8.3. Abbildungsverzeichnis ......................................................................................................... 95 8.4. Tabellenverzeichnis ............................................................................................................. 97 8.5. Online-Umfrage ................................................................................................................... 98 8.5.1. Anfrage zur Teilnahme an der Online-Umfrage .......................................................... 98 8.5.2. Online Fragebogen ...................................................................................................... 99 8.5.3. Auswertungen pro Dimension nach Spitaltyp ........................................................... 114 8.5.4. Auswertungen pro Dimension nach Spitalgrösse ..................................................... 117 8.6. Experteninterviews ............................................................................................................ 120 8.6.1. Anfrage zur Teilnahme an den Experteninterviews .................................................. 120 8.6.2. Leitfaden Experteninterviews .................................................................................... 121 8.6.3. Interview mit Herr Raphael Frangi............................................................................. 126 8.6.4. Interview mit Herr Prof. Dr. Alfred Angerer ............................................................... 136 8.6.5. Interview mit Herr Yves Laukemann ......................................................................... 145 8.6.6. Interview mit Herr Stefan Märke ................................................................................ 157 8.6.7. Qualitative Inhaltsanalyse ......................................................................................... 166 8.6.8. Qualitative Inhaltsanalyse mit Codierungen .............................................................. 173 IV Ehrenwörtliche Erklärung Ich bestätige hiermit, dass ich die vorliegende Thesis selbständig und ohne Benützung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel anfertigte, die benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich als solche kenntlich machte, diese Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungskommission vorlegte. Zürich, 02. Juli 2018 Stefan Lienhard V Vorwort Im Rahmen meiner insgesamt achtjährigen Tätigkeit bei der Privatklinikgruppe Hirslanden, zuerst als Projektleiter Digital Marketing und später als Projektleiter Social Media, bin ich 2008 erstmals beruflich mit dem Gesundheitswesen in Berührung gekommen. Rasch stellte ich fest, dass es sich bei der Gesundheitsbranche um ein äusserst komplexes Konstrukt mit unterschiedlichsten Leistungserbringern handelt, welches, trotz verschiedener Interessen, ein einziges gemeinsames Ziel verfolgt: die Sicherstellung einer bestmöglichen Gesundheitsversorgung der Schweizer Bevölkerung durch ein leistungsfähiges und bezahlbares System. Vor allem in meiner Funktion als Verantwortlicher für Social Media, kam ich nicht nur in Kontakt mit vielen med. Fachpersonen, vor allem Ärzte und Pflegefachpersonen, sondern auch mit einer Vielfalt an neusten und modernsten Technologien. Tagtäglich las und verbreitete ich auf sozialen Netzwerken im Namen von Hirslanden Spannendes aus der Gesundheits- und Medizinwelt und fing bald an, mich auch persönlich für viele dieser Themen zu interessieren. Für besonders faszinierend hielt ich die rasante technologische Entwicklung im med. Bereich und ich empfand es als Privileg, dass ich die Möglichkeit hatte, bei meiner Arbeit Operationsroboter oder HighTech Hybrid-Operationssäle kennenzulernen. Gleichzeitig war ich erstaunt, wie langsam und träge das Gesundheitssystem vor allem im administrativen Bereich funktioniert, wie veraltet teilweise Infrastrukturen, Geräte und Prozesse sind und wie wenig eigentlich der Patient im Mittelpunkt der Abläufe steht. 2015 startete ich meine Ausbildung an der HWZ mit dem Ziel den Abschluss MAS Digital Business zu erlangen. Schnell war mir klar, dass meine Abschlussarbeit sich um die Digitalisierung im Gesundheitswesen drehen wird, denn es war zu offensichtlich, dass speziell in Kliniken und Spitälern ein enormes Potenzial schlummert, um mittels digitalen Technologien Prozesse effizienter zu gestalten, Kosten einzusparen oder sogar neue Geschäftsfelder zu erschliessen. Bei der Themenfindung für meine Maser-Thesis fand ich heraus, dass ein StatusQuo zur Digitalisierung in Kliniken und Spitälern fehlt. Diverse Studien suggerieren, dass sich die Gesundheitsbranche mit ihren Digitalisierungsbemühungen noch ganz am Anfang befindet. Doch wie weit ist die Digitalisierung in den Spitälern tatsächlich fortgeschritten? Wo stehen sie in Sachen digitale Transformation zu Zeiten der «Platform-Economy» wo Giganten wie Amazon, Apple und Google in den Gesundheitsmarkt drängen? Welche digitalen Strategien verfolgen sie und lässt sich auch ihr Geschäftsmodell digitalisieren? Welches sind die meistgenutzten (disruptiven) Technologien? Wie sieht das digitale Ökosystem der Spitäler aus: bestehen Kooperationen mit (Health-)Start-Ups oder Universitäten? Gibt es in Schweizer Spitälern schon so etwas wie eine digitale Unternehmenskultur? Mit diesen Fragen war mein Interesse endgültig geweckt und das Thema für die Forschungsarbeit gefunden: die Ermittlung des digitalen Reifegrads der Schweizer Kliniken und Spitäler. VI Glossar Beim Bio-Printing können Gewebe, Haut oder Organe aus einem 3DBio-Printing Printer gedruckt werden. Die Forschung steckt zwar immer noch in der Experimentierphase, die Technologie könnte aber die Medizin durchaus revolutionieren (Zukunftsinstitut, o.J.). «Bei der Blockchain handelt es sich um eine gemeinsam genutzte Blockchain Datenbanktechnologie, bei der Verbraucher und Lieferant einer Transaktion direkt miteinander verknüpft werden» (Gründerszene, o.J.). «Der Begriff Chatbots bezeichnet textbasierte Dialogsysteme, die im Chatbots Rahmen der Mensch-Maschine-Kommunikation mit Konsumenten in den Dialog treten» (DigitalWiki, 2016). Co-Working ist eine moderne Arbeitsform, bei der sich Menschen auf Co-Working flexibler und freiwilliger Basis, in einem offenen Büro zum (Zusammen-) Arbeiten einfinden (coworkit, 2016). Digital Health Digital Health ist der Oberbegriff, welcher die beiden Begriffe eHealth und Mobile Health umfasst (ZHAW, 2017, S. 8). Digital Leadership charakterisiert die Aufgaben, Rollen und Fähigkeiten, Digital Leadership welche Führungskräfte im Zuge der Digitalisierung übernehmen bzw. sich aneignen sollten (Lindner, 2017). «Disruptive Technologien unterbrechen die Erfolgsserie etablierter Technologien und Verfahren und verdrängen oder ersetzen diese in Disruptive Technologien mehr oder weniger kurzer Zeit. Oft sind sie zunächst qualitativ schlechter oder funktional spezieller, was mit ihrer Digitalisierung zusammenhängen kann, und gleichen sich dann nach und nach an ihre Vorgänger an bzw. übertreffen diese in bestimmten Aspekten» (Gabler, 2018a). eHealth Der Begriff «eHealth» beschreibt die Möglichkeit des elektronischen Informationsaustauschs im Gesundheitswesen (ZHAW, 2017, S. 7). «Das EPD ist eine Sammlung von persönlichen Dokumenten Ihrer Elektronisches Patientinnen und Patienten. Diese Dokumente enthalten für die Patientendossier Behandlung wichtige Informationen wie zum Beispiel den Übertrittsbe- (EPD) richt eines Spitals, den Pflegebericht der Spitex, die Medikationsliste, Röntgenbilder oder den Impfausweis. Dank des EPD sind diese VII Dokumente online verfügbar und können jederzeit abgerufen werden» (eHealth Suisse, 2018, S. 7). HybridOperationssaal Hybrid-Operationssäle ermöglichen die Kombination von hochpräziser radiologischer Bildgebung mit minimalinvasiven Eingriffen und offener Chirurgie (Hirslanden, o.J.). «Lean Management bezeichnet die Gesamtheit der Denkprinzipien, Methoden Lean Management und Verfahrensweisen zur Gestaltung der Wertschöpfungskette innerhalb einer Unternehmung. Die Ausrichtung auf den Kundennutzen bzw. das Erschaffen von Werten für den Kunden hat oberste Priorität. Das Ergebnis sind Prozesse mit einer enorm hohen Kundenorientierung» (Jordan Consulting, o.J.). Mobile Health ist die Weiterentwicklung von «eHealth», welche dank Mobile Health dem Durchbruch von mobilen Geräten ermöglicht wurde, es ist ein Unterbegriff oder eine Dimension von «eHealth» (ZHAW, 2017, S. 7). Mobile Working ist ein Arbeitsplatzkonzept bei dem keine fixen Mobile Working Arbeitsplätze mehr existieren und mit welchem die Flexibilität der Mitarbeitenden gefördert wird (CareerBuilder, 2011). «Unter Multimorbidität versteht man das gleichzeitige Vorhandensein Multimorbidität mehrerer Erkrankungen oder medizinischer Probleme zur selben Zeit in einem Patienten» (Universitätsspital Zürich, o.J.). «Die Platform Economy oder Digital Platform Economy bezeichnet Platform-Economy Geschäftsformen oder -modelle, die auf der Grundlage von internetbasierten Plattformen operieren» (Lammenett, 2017). VIII 1. Einleitung Das Einleitungskapitel schildert die Ausgangslage, präsentiert das Forschungsproblem und die Forschungsfragen. Es erklärt die Zielsetzung und nimmt die Abgrenzung zu verwandten Themen vor. Weiter beschreibt die Einleitung die Vorgehensweise und den Aufbau der Arbeit. Die Welt befindet sich im Wandel. Nach der Mechanisierung, der Elektrifizierung und Automatisierung folgt das Zeitalter der Digitalisierung und Vernetzung von Produkten, Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodellen, auch vierte industrielle Revolution (Abbildung 1) genannt. «Bemerkenswert ist, dass man bei Industrie 4.0 bereits jetzt von einer industriellen Revolution spricht, noch bevor sich das Konzept durchgesetzt hat und breit in der Praxis umgesetzt wurde. Bei den ersten drei industriellen Reformen hat man erst Jahre später von Revolution gesprochen» (Moser, 2016). Abbildung 1: Entwicklungsstufen von Industrie 1.0 zu Industrie 4.0 Quelle: Moser (2016) Die «Digitalisierung» und die «Digitale Transformation» gelten als absolute Megatrends der Neuzeit (ZHAW, 2017, S. 2). Nach Naisbitt & Aburdene (1992, S. 9ff) sind Megatrends «tiefgreifende und nachhaltige gesellschaftliche, ökonomische, politische und technologische Veränderungen, die sich langsam entfalten und deren Auswirkungen über Jahrzehnte hinweg spürbar bleiben». Die beiden Themen sind omnipräsent und sie prägen unser Zeitalter wie kaum eine andere Erscheinung. Ihre Auswirkungen betreffen die Wirtschaft, Gesellschaft, Individuen aber auch 1 unsere Umwelt. Sie machen vor keiner Branche oder Unternehmen halt. Sie bedingen von Entscheidungsträgern sich mit ihren derzeitigen Geschäftsmodellen und Wertschöpfungsketten auseinanderzusetzen und diese grundsätzlich zu überprüfen oder hinterfragen (PWC, 2014; PWC Schweiz, Google Switzerland GmbH, & digitalswitzerland, 2016). Digitalisierung ist gekennzeichnet durch die Verschmelzung von virtueller und realer Welt. Alles ist mit allem vernetzt und verbunden, wodurch enorme Datenmengen entstehen und Gegenstände plötzlich intelligent werden (Swisscom, o. J.). Daraus entwickelt sich eine Vielzahl an neuen, so genannten «disruptiven», Technologien. Deloitte Digital und Heads! (2015, S. 2) ergänzen: «Jede dieser Technologien hat bereits die Art und Weise verändert, in der wir kommunizieren, interagieren, arbeiten und leben. Für all jene, die immer noch glauben, dass Digitalisierung bedeutet eine Social-Media-Präsenz aufzubauen oder eine mobile Webseite zu entwickeln, kommt hier die Wahrheit: Digitale Technologien werden nicht nur Wertschöpfungsketten, Organisationsstrukturen, operative Prozesse und Geschäftsmodelle grundlegend verändern, sondern gesamte Unternehmen. […] Die erfolgreiche Umsetzung der digitalen Transformation wird demnach massgeblich dafür sein, welche Unternehmen überleben werden und welche nicht». Es geht also um weit mehr, als einen reinen Technologie-Trend. Die Digitalisierung steht für einen Paradigmenwechsel, welcher die Gesamtausrichtung eines Unternehmens genauso beeinflusst wie die Strukturen, die Kultur und die Kommunikation. Fähigkeiten wie Innovationskraft, Geschwindigkeit und Veränderungsbereitschaft werden plötzlich zum Schlüssel für eine erfolgreiche digitale Transformation (Hille, Janata, & Michel, 2016, S. 6 - 9). Je nach Branche und Unternehmen werden Technologiezyklen immer kürzer, so dass eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema besser heute als morgen beginnt (Deloitte Digital & Heads!, 2015, S. 6). Auch im Schweizer Gesundheitswesen ist das Thema Digitalisierung angekommen. Die Konsequenzen sind aber bei weitem noch nicht so spürbar wie beispielsweise in der Finanzwelt. Die Branche verspricht sich einiges vom digitalen Wandel, vor allem von den neuen technologischen Errungenschaften. Begriffe wie «eHealth» oder «Mobile Health» und Technologien wie die Telemedizin oder Roboter sollen zu einer deutlichen Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit führen. Die Hoffnung besteht nicht zuletzt darin, dass mit der Digitalisierung eine besser integrierte und patientenzentrierte Gesundheitsvorsorge ermöglicht wird (ZHAW, 2017). Ähnlich schätzt auch die Schweizerische Akademie für Wissenschaften SAMW (2017, S. 1) die potenziellen Auswirkungen der Digitalisierung im Gesundheitsbereich ein: «Die Medizin wird dadurch stärker partizipativ, personalisiert, prädiktiv und präventiv». Eine zentrale und tragende Rolle in jedem Gesundheitswesen spielen die Spitäler und Kliniken. Wie sie mit den digitalen Chancen und Herausforderungen umgehen, ist deshalb wegweisend für die künftige digitale Entwicklung der gesamten Branche. 2 1.1. Ausgangslage Einer der bedeutendsten Leistungserbringer im Schweizer Gesundheitswesen sind die Kliniken und Spitäler, welche als höchst komplexe Expertenorganisationen einzustufen sind. Sie werden in einer zunehmend alternden Gesellschaft zu wichtigen und zentralen Knotenpunkten (HoferFrei, 2015; ZHAW, 2016, S. 6ff). Mit der Digitalisierung werden auch im Gesundheitsmarkt die Karten neu gemischt. Eine der spannendsten Fragen, welche sich dabei stellt, ist, welches Blatt die Kliniken und Spitäler in den Händen halten (werden). Wie digital sind die «wichtigsten medizinischen Kompetenzzentren der Gesundheitsversorgung» (Sigrist, 2006, S. 42)? Sind sie bereit für die vielschichtigen technologischen und kulturellen Herausforderungen der Gegenwart? Festigen sie ihre zentrale Rolle im System und werden zu Vorreitern des digitalen Gesundheitswesens? Oder verpassen sie vielleicht sogar den Anschluss und verlieren sukzessive Marktanteile an innovative Healthcare Start-Ups und branchenfremde Unternehmen? In der Schweiz existieren verschiedene Untersuchungen, welche die digitale Bereitschaft und Reife von Branchen durchleuchten. Die Studien umfassen das Gesundheitswesen jeweils nur als Ganzes, mitsamt Pharmaunternehmen, Krankenversicherern und Spitälern. Was bislang fehlt, ist eine isolierte und gleichzeitig ganzheitliche Betrachtung des digitalen Fortschritts im Spitalwesen. 1.2. Zielsetzungen Mit der vorliegenden Masterarbeit will der Autor diese Forschungs- und Wissenslücke schliessen. Anhand von unterschiedlichen Themenfeldern bzw. Dimensionen, wird die digitale Kompetenz von Schweizer Kliniken und Spitälern untersucht und so der digitale Reifegrad der Spitalbranche ermittelt. Die übergeordnete Forschungsfrage lautet deshalb: «Wie weit ist die Digitalisierung in den Schweizer Spitälern fortgeschritten und welche Kompetenz- oder Handlungsfelder lassen sich daraus ableiten?» Um diese Frage beantworten zu können, werden drei unterstützende Fragestellungen (Tabelle 1) formuliert, welche zum Schluss der Arbeit, in Kapitel sechs, beantwortet werden. Tabelle 1: Forschungsfragen der Masterarbeit in der Übersicht (eigene Darstellung) 1. Frage Welche Relevanz hat das Thema «Digitalisierung» für Kliniken und Spitäler? 2. Frage Welches ist der digitale Reifegrad von Schweizer Kliniken und Spitälern? 3. Frage Welches sind die hemmenden Faktoren für eine erfolgreiche Digitalisierung? 3 Die Studie hilft Kliniken und Spitälern dabei, ein gemeinsames Verständnis für die durch die Digitalisierung tangierten Themenfelder herzustellen und entsprechende Diskussionen anzustossen. Die Auseinandersetzung mit Fragen rund um den digitalen Reifegrad soll in den betroffenen Unternehmen eine intensivere Reflexion über die Auswirkungen der Digitalisierung auslösen und als praktisches Instrument zur Standortbestimmung dienen. Anhand von objektiven Kriterien kann so ein Quervergleich innerhalb der Branche vorgenommen werden. Mit der Arbeit werden Hürden und Treiber im Zusammenhang mit der Digitalisierung sichtbar gemacht und digitale Kompetenz- oder Handlungsfelder in Spitalbetrieben identifiziert. Generiert wird ein konsolidiertes Gesamtbild über den Stand und die Herausforderungen von Spitälern bei der Digitalisierung. Die Arbeit leistet auf diese Weise ihren eigenen Beitrag zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema Digitalisierung im Spitalumfeld. 1.3. Vorgehensweise In einem ersten Schritt sichtet der Autor die theoretischen Grundlagen und untersucht die bestehende Literatur. Er analysiert Studien und Umfragen zum Stand der Digitalisierung im Gesundheits- und Spitalwesen mit besonderem Fokus auf deren Fortschritt. Aufbauend auf dem aktuellen Wissenstand formuliert er im methodischen Teil Hypothesen, welche im Anschluss mittels empirischer Forschung geprüft und abschliessend bestätigt oder widerlegt werden. Die Erhebung von eigenem Datenmaterial geschieht in zweifacher Weise: primär in quantitativer Form durch eine (Online-)Umfrage in Schweizer Spitälern und sekundär durch vier Experteninterviews, welche die Forschungsarbeit in qualitativer Art ergänzen. Dieser Ansatz ermöglicht einen vollumfänglichen und geschärften Blick auf den Stand der Digitalisierung in Schweizer Spitälern. Die damit gewonnenen Hintergrundinformationen lassen eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema zu. 1.4. Aufbau und Struktur der Arbeit Die Arbeit gliedert sich in insgesamt sechs Hauptkapitel (Tabelle 2). Nach dem Management Summary und den formellen Teilen der Arbeit führt die Einleitung den Leser an das Thema und die Forschungsfragen heran. Weiter werden die Zielsetzungen erläutert und eine inhaltliche Abgrenzung vorgenommen. Im zweiten Teil präsentiert der Autor die theoretischen Grundlagen. Im Fokus des dritten Kapitels steht die Digitalisierung im Gesundheits- und Spitalwesen. Der Autor erörtert relevante Studien oder Untersuchungen und bringt den Leser auf den neusten Stand des Wissens. Zu Beginn des vierten Kapitels formuliert er, anknüpfend an die Theorie, die im Forschungsteil zu untersuchenden Hypothesen. Anschliessend werden das konkrete Vorgehen und die Methodik zur Durchführung der empirischen Analyse erklärt. In Kapitel fünf wertet der Schreibende die Erkenntnisse aus der Forschung aus und fasst sie zusammen. Kapitel sechs löst die Hypothesen auf und beantwortet die Forschungsfragen. Abgerundet wird die Arbeit wiederum mit einem formellen Schlussteil. 4 Tabelle 2: Aufbau der Masterarbeit (eigene Darstellung) 1. Kapitel Einleitung 2. Kapitel Grundlagen & Definitionen 3. Kapitel Digitalisierung im Gesundheits- und Spitalwesen 4. Kapitel Empirische Untersuchung 5. Kapitel Auswertung der Ergebnisse 6. Kapitel Schlussbetrachtung & Handlungsempfehlungen 1.5. Abgrenzung Die quantitative Forschung ignoriert, vor allem aus Gründen der sprachlichen Umsetzbarkeit im Rahmen der Arbeit, die Kliniken und Spitäler der französischen und italienischen Schweiz. Davon ausgenommen sind die beiden Universitätsspitäler in Genf (HUG - Hôpitaux Universitaires de Genève) und in Lausanne (CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois). Diese Institute sind in den Augen des Autors, es gibt schweizweit nur fünf Universitätsspitäler, zu relevant, als dass sie bei der Befragung hätten ausser Acht gelassen können. Der digitale Reifegrad wird als Gesamtes für die Branche und nicht für einzelne Institute ermittelt. Er stellt lediglich eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Befragung, im März 2018, dar. Ein Vergleich des Reifegrades mit anderen Branchen wird wegen des individuellen Charakters der Umfrage nicht vorgenommen. 5 „Unsere Welt ändert sich sehr rasch. Diejenigen, die darauf reagieren, überleben. Die anderen verschwinden wie die Dinosaurier.“ (Trawnicek, o.J.) 6 2. Grundlagen & Definitionen Im zweiten Kapitel werden die für die Arbeit relevanten Begriffe und Zusammenhänge erklärt und wo nötig Definitionen vorgenommen. So wird die Basis für das weitere Verständnis und die Nachvollziehbarkeit des Forschungsvorhabens geschaffen. Die «Digitalisierung» und die «Digitale Transformation» zählen zu den Buzzwords der Neuzeit – auch im Gesundheitswesen. Ihr teilweise inflationär anmutender und inkonsistenter Gebrauch führt zwangsweise zu einer Verwässerung der Begriffe und einer folglich unklaren Abgrenzung (Talin, 2018; BDI und Roland Berger, 2015, S. 4). Dem Autor erscheint es deshalb notwendig, die wichtigsten Begrifflichkeiten zu erklären und deren Abhängigkeiten aufzuzeigen. 2.1. Digitalisierung Die unterschiedlichen Auslegungen und Interpretationen des Terms Digitalisierung begründet der Autor vor allem damit, dass sich der Begriff in den letzten Jahren stark gewandelt hat. An ihrem Ursprung war Digitalisierung sehr technologisch geprägt, sie stand vor allem für die Umwandlung von Analogem in Digitales. «[…] Traditionell ist die technische Interpretation. Danach bezeichnet Digitalisierung einerseits die Überführung von Informationen von einer analogen in eine digitale Speicherform und andererseits thematisiert er die Übertragung von Aufgaben, die bisher vom Menschen übernommen wurden, auf den Computer» (Online-Lexikon der Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik, 2016). «Digitalisierung bezeichnet einen technischen Prozess, bei welchem analoge Daten oder Abläufe in digitale umgesetzt werden» (Peter, 2017, S 9.). «Die Digitalisierung ist – abstrakt ausgedrückt – das Darstellen real vorhandener Informationen in einer physisch nicht an einen Ort gebundenen Form. Es handelt sich bei der Digitalisierung also um die digitale Darstellung von messbaren Informationen» (Thönnessen, 2018). «Heute ist der Begriff wesentlich breiter gefasst, neben digitalisierten Daten stehen vor allem Prozesse im Vordergrund sowie Technologien und Devices, welche diese Prozesse managen. Diese Technologien, Prozesse und die Anwendung der Geräte betrifft Wirtschaft und Gesellschaft, also Unternehmen sowie Menschen im Arbeits-, Berufs- und im Privatleben» (MoneyToday, 2018a). Diese veränderte Wahrnehmung wird auch in anderen Quellen bestätigt: «Im Zentrum der Digitalisierung stehen nicht nur Daten, Maschinen, Algorithmen oder einzelne Anwendungen, sondern die Menschen» (economiesuisse und Think Tank W.I.R.E., 2017, S. 5) 7 oder wie Sigrist in einer Studie von KPMG (2017, S. 10) präzisiert: «Oft, wenn von Digitalisierung gesprochen wird, meint man eigentlich Technologisierung. Die Digitalisierung geht jedoch weiter und beschreibt einen umfassenden Prozess, der nach und nach alle unsere Lebensbereiche erfasst und verändert. In diesem Sinne definiere ich Digitalisierung als Megatrend, der Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft gleichzeitig verändert». 2.2. Digitale Transformation Über den Begriff digitale Transformation scheint in der Literatur bessere Klarheit und ein einheitlicheres Verständnis zu herrschen. Sie wird mittlerweile stark mit Change-Management verglichen oder teilweise sogar gleichgesetzt: «Der Begriff Digital Transformation beschreibt einen durch digitale Technologien ermöglichten Veränderungsprozess der gesamten Gesellschaft. Wesentliche Treiber der Digital Transformation sind Informationstechnologien wie Vernetzung, Hardware und digitale Anwendungen. […] Der Wandel betrifft das komplette Spektrum der Gesellschaft inklusive der Wirtschaft mit ihren Unternehmen. […]» (Litzel, 2017). «Die Digitale Transformation hingegen ist ein Wandel, der sowohl die Wirtschaft, als auch die ganze Gesellschaft betrifft. Damit ist die digitale Transformation als ganzheitlicher und umfassender Change Prozess zu betrachten» (Peter, 2017, S. 9). «Digitale Transformation ist die Kombination von Veränderungen in Strategie, Geschäftsmodell, Organisation / Prozessen und Kultur in Unternehmen durch Einsatz von digitalen Technologien mit dem Ziel die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern» (Back & Berghaus, 2016, S. 2). «Digitale Transformation steht für die Folgen und Auswirkungen der Digitalisierung. Wie müssen sich Menschen, Unternehmen und damit Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Bildung verändern oder anpassen? Welche Strategien und Entscheidungen sind notwendig, damit die Möglichkeiten der Digitalisierung optimal genutzt und die Auswirkungen für alle Beteiligten möglichst positiv ausgestaltet werden können? Die digitale Transformation fasst in einem Begriff zusammen, wie wir unsere digitale Zukunft gestalten» (MoneyToday, 2018b). Aus Sicht des Autors liegt bei der Beziehung der beiden Begriffe eine typische Kausalität vor: er selbst versteht, vereinfacht gesagt, die Digitalisierung (Technologie) als Ursache und die digitale Transformation (Veränderung) als deren logische Wirkung. 8 2.3. Phasen und Handlungsfelder der digitalen Transformation Unternehmen durchlaufen auf ihrer «Digitalisierungsreise» verschiedene Stufen der Transformation, weshalb ein strukturiertes Vorgehen, vor allem für traditionelle Organisationen, empfehlenswert ist. Digitale Transformation kann als typsicher Veränderungs- und Reifeprozess verstanden werden. Abhängig vom jeweiligen Unternehmen, bietet sich eher ein schrittweiser oder ein radikaler Ansatz an. Einige Organisationen sind mit einer fundamentalen Veränderung vielleicht schnell überfordert und bauen deshalb das Vertrauen in ihre digitalen Fähigkeiten besser über die Anpassung von Bestehendem auf (Diehl, o. J.). Back und Berghaus (2016, S. 6) bestätigen dies, denn «es gibt keinen idealen Weg der digitalen Transformation, der zwingend nach demselben Schema durchlaufen wird. Es gibt keinen Zielzustand, der «richtig» ist». Vor allem Beratungsfirmen im digitalen Umfeld haben für den Umgang mit der Digitalisierung unterschiedliche Strategieansätze entwickelt. Deloitte Digital und Heads! (2015, S. 7) propagieren beispielsweise ein Vorgehen anhand von vier Phasen (Abbildung 2). Abbildung 2: Die 4 Phasen der digitalen Transformation Quelle: Deloitte Digital und Heads! (2015, S. 7) Diese Herangehensweise an das Thema gefällt, denn sie widerspiegelt die Gemeinsamkeiten der allermeisten Strategien: praktisch sämtliche Modelle sehen in einer ersten Phase eine digitale Standortbestimmung bzw. Bestandsaufnahme vor. Im Zuge dieser, werden verschiedene Handlungsfelder oder Dimensionen der Transformation (Abbildung 3) genauer untersucht. Als Voraussetzung für die Akzeptanz einer Dimension verlangen Neff et al. (2014, S. 897), dass sie wissenschaftlich fundiert und praktisch begründet sein muss. «Unter einem Handlungsfeld 9 werden Tätigkeiten, Prozesse und Aktionen zusammengefasst, die in einem Teilaspekt der digitalen Transformation von Unternehmen definiert, umgesetzt und angewendet werden können» (FHNW, 2017). Abbildung 3: Die 7 Handlungsfelder der Transformation Quelle: Peter (2017, S. 61) Wenn ein Unternehmen seinen Ist-Zustand bezüglich eines spezifischen Handlungsfeldes oder einer konkreten Fragestellung ermitteln will, kommen häufig sogenannte Reifegradmodelle zum Einsatz. Doch wie ist Reife im digitalen Kontext zu interpretieren? 2.4. Digitale Reife Reife per-se bezeichnet im Allgemeinen «[…] die Veränderung eines Ausgangszustands in einen anderen, fortgeschrittenen Zustand. Somit drückt das Konzept eine stufenweise Entwicklung über dazwischenliegende Zustände aus, bis schliesslich «the most advantage stage in a process» erreicht wird» (Stevenson, 2010 und Antoniades, 2014 in Egeli, 2016, S. 12ff). Die Wirtschaftsinformatik konkretisiert den Begriff als «[…] a measure to evaluate the capabilities of an organization in regards to a certain discipline» (Paulk et al., 1993 in De Bruin & Rosemann, 2005, S. 1). Back, Berghaus und Kaltenrieder (2017, S. 75) nehmen im Zusammenhang mit Digitalisierung folgende Reife-Definition vor: «Digitale Reife bedeutet, dass ein Unternehmen über die nötigen organisationalen Fähigkeiten verfügt, um in der digitalen Transformation erfolgreich zu sein. Diese Fähigkeiten sind in den Dimensionen des Reifegradmodells definiert». 10 2.5. Das «Digital Maturity Model» In der Praxis dienen Reifegradmodelle (engl. Maturity Models) unterstützend als Instrument zur Standortbestimmung und sie ermöglichen ein pragmatisches Aufzeigen von Kompetenzen und Verbesserungspotenzialen. Anhand von objektiven Kriterien erlauben sie einen Vergleich mit anderen Unternehmen und fördern konkrete Handlungsbereiche zu Tage (Back & Berghaus, 2016, S. 4ff). Heute werden verschiedenste Modelle genutzt, die sich, abhängig vom Überthema, in der Breite und Tiefe der untersuchten Dimensionen stark unterscheiden. In der Schweiz hat sich das neundimensionale «Digital Maturity Model» (Abbildung 4) des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität St.Gallen, in Form eines Online-Fragebogens, als praktisches Tool zur Messung der digitalen Reife etabliert. «Das Digital Maturity Model zeigt in seinen Dimensionen Fähigkeiten auf, die in der digitalen Transformation eine besondere Rolle spielen. […]. Jede Dimension des Modells enthält ca. 3 Reifekriterien. Um diese Fähigkeiten in der Online-Umfrage messen zu können, werden für jedes Reifekriterium im Fragebogen ca. 2 - 3 Fragen mit konkreten Merkmalen definiert. Dabei schätzen die Teilnehmer ein, wie stark die beschriebenen Merkmale auf ihr Unternehmen zutreffen» (Back & Berghaus, 2016, S. 6 - 9). Zur Errechnung des Reifegrads wird anhand der Antworten für jeden Indikator ein Schwierigkeitsgrad definiert, welcher schlussendlich, nach weiteren ergänzenden Berechnungen wie Cluster- und Punktereifegrad, einen Gesamtreifegrad ergibt (Back, Berghaus, & Kaltenrieder, 2017, S. 9). Abbildung 4: Die neun Dimensionen des Digital Maturity Model (eigene Darstellung) Quelle: Back, Berghaus, und Kaltenrieder (2017, S. 8) 11 2.6. Die neun Dimensionen des «Digital Maturity Model» In den Augen des Autors gelingt dem St.Galler-Modell die aktuell ganzheitlichste Erfassung der Wirkungsfelder des digitalen Wandels. Er wird sich deshalb bei seiner Analyse auf genau diese Dimensionen stützen, weshalb sie an dieser Stelle näher erklärt werden. 1. Customer Experience «Unternehmen verstehen die Anforderungen und Bedürfnisse ihrer digitalen Kunden und sind in der Lage, ihr Kundenerlebnis konsequent auf das veränderte Verhalten auszurichten» (Back, Berghaus, & Kaltenrieder, 2017, S. 23). Diese Dimension analysiert das Kundenerlebnis, on- und offline. Es wird geprüft, ob und wie ein Unternehmen Kundendaten zusammenführt, analysiert und diese z.B. für eine crossmediale, personalisierte Kommunikation mit seinen Zielgruppen nutzt. Die Dimension umfasst auch die Untersuchung des Automatisierungsgrads und in welchem Masse gesammelte Interaktionsdaten in künftige Marketing-/Kommunikationsmassnahmen einfliessen. 2. Produktinnovation «Unternehmen nutzen digitale Technologien, um neue Services und Produkte zu entwickeln und durch ein innovatives Angebot einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen» (Back, Berghaus, & Kaltenrieder, 2017, S. 25). Die Dimension Produktinnovation untersucht vor allem den Umgang mit digitalen Technologien und Innovationsthemen. Es wird erfragt, ob und wie Produkte, Services und Geschäftsmodelle an die digitale Welt adaptiert oder sogar neu geschaffen werden. Weiter wird nach der Existenz von Innovationsprozessen gesucht und ermittelt, inwiefern Mitarbeitende und Kunden in diese eingebunden werden. 3. Strategie «Die Geschäftsstrategie ist konsequent darauf ausgerichtet, neue Möglichkeiten von digitalen Technologien zu nutzen und das Unternehmen wettbewerbsfähig in der digitalen Welt zu machen» (Back, Berghaus, & Kaltenrieder, 2017, S. 27). 12 In der Dimension Strategie interessieren die Rolle, die Priorität und die strategische Verankerung des Themas Digitalisierung in der Gesamtstrategie des Unternehmens. Gefragt wird nach der digitalen Vision und den damit verfolgten Zielen sowie inwiefern die notwendigen Kernkompetenzen für die digitale Zukunft von der Führungsebene wahrgenommen und verstanden werden. Aspekte aus dem Innovations-Monitoring runden diesen Bereich ab. 4. Organisation «Das Unternehmen hat die strategische Aufstellung der Organisation an die neuen Herausforderungen angepasst und kann digitale Kompetenzen effizient im Unternehmen zur Verfügung stellen» (Back, Berghaus, & Kaltenrieder, 2017, S. 29). Die Dimension Organisation durchleuchtet vor allem die abteilungsübergreifende Einbettung und Koordination wie auch die Zuständigkeit für das Thema Digitalisierung. Untersucht werden Methoden des Trend-Monitorings, der Umgang mit Partnerschaften oder Kooperationen und die generelle Ausgestaltung des digitalen Ökosystems. 5. Prozessdigitalisierung «Alle Prozesse rund um Kommunikation, Transaktion und Führung sind auf digitale Strukturen ausgerichtet und werden, wo möglich, automatisiert» (Back, Berghaus, & Kaltenrieder, 2017, S. 31). Diese Dimension beschäftigt sich mit dem Einsatz von digitalen Kommunikationskanälen sowie deren Nutzung und Integration im Tagesgeschäft. Es wird ermittelt, ob und wie Unternehmen dank Erkenntnissen aus der Datenanalyse ihre (Routine-)Prozesse adaptieren oder sogar neu modellieren. Fokussiert werden auch Themen wie die Datenanalyse, speziell, ob Big Data eine Rolle bei der Entscheidungsfindung und Gestaltung von neuen Angeboten oder Produkten spielt. 6. Zusammenarbeit «Digitale Technologien werden innerhalb des Unternehmens genutzt, um die Kollaboration, Kommunikation und mobile und flexible Arbeitsformen der Mitarbeitenden zu unterstützen» (Back, Berghaus, & Kaltenrieder, 2017, S. 33). 13 Die Reife-Indikatoren in dieser Dimension sind die interdisziplinäre Nutzung von Kollaborationsplattformen, der Umgang mit Wissensmanagement und generell die Form wie unternehmensintern digitales Knowhow geteilt und nachhaltig aufgebaut wird. Zur Dimension gehören ebenso Aspekte der modernen Arbeitswelt wie Mobile Working, Arbeitszeitmodelle etc. «Betrieb und Entwicklung von digitalen Technologien sind auf 7. Informationstechnologie die neuen Herausforderungen der digitalen Transformation ausgerichtet, so dass sowohl IT-Infrastruktur als auch Informationssysteme neue Kommunikation Transaktion und digitale Produkte, Services, ermöglichen» (Back, Berghaus, & Kaltenrieder, 2017, S. 35). Die Dimension Informationstechnologie beleuchtet primär die Professionalität und Beratungsqualität der ICT-Abteilung. Bewertet werden ferner Faktoren wie Agilität, Stabilität und Schnittstellen (Offenheit der Systeme) oder die Aktualität der technischen Infrastruktur. Die Kategorie umfasst weiter Kriterien wie den Umgang, die Verfügbarkeit und den Schutz von Daten sowie zusätzlich gewisse IT-Security-Aspekte. 8. Kultur & Expertise «In der Unternehmenskultur besteht Offenheit und Verständnis gegenüber digitalen Technologien. Ausserdem sind Fähigkeiten und Verhaltensweisen verankert, welche Veränderungsprozesse im Unternehmen unterstützen» (Back, Berghaus, & Kaltenrieder, 2017, S. 37). Der Bereich Kultur & Expertise sucht unter anderem nach der Existenz von Digital Leadership und einer digitalen Unternehmenskultur. Erhoben werden Informationen zum Umgang mit Themen wie Mitarbeiterentwicklung und -rekrutierung, Silodenken, Fehlerkultur oder die Haltung der Führungskräfte bezüglich des Change-Managements, gegenüber Investitionsrisiken und allgemeinen Innovationsthemen. 9. Digitale Transformation «Die digitale Transformation des Unternehmens ist ein von der obersten Führungsebene unterstützter, geplanter und gesteuerter Prozess, der durch eine klare Roadmap geführt wird» (Back, Berghaus, & Kaltenrieder, 2017, S. 39). 14 Bei dieser Dimension steht der digitale Veränderungsprozess im Zentrum der Untersuchung. Sie thematisiert strategische, organisatorische und kulturelle Aspekte in Bezug auf die digitale Transformation. Dazu gehören auch der Umgang mit Ressourcen, die Zieledefinition und das Engagement sowie die Rolle und Vorbildfunktion der Management- und Führungsebene. 15 «Culture eats strategy for breakfast!» (Drucker, o.J.) 16 3. Das Gesundheits- und Spitalwesen Das dritte Kapitel gibt dem Leser einen Überblick über den Stand der Digitalisierung im Gesundheits- und Spitalwesen. Der Autor präsentiert aktuelle Studien, Untersuchungen und Trends und arbeitet so den aktuellen Wissensstand auf. Das Schweizer Gesundheitswesen geniesst einen ausgezeichneten Ruf. In internationalen Vergleichsstudien schneidet es regelmässig auf Spitzenpositionen ab. Zu den Stärken gehören der garantierte und leichte Zugang zur Gesundheitsversorgung, die umfassende Deckung der obligatorischen Krankenversicherung, und die hohe Qualität der med. Leistungen. Als grösste Defizite gelten Intransparenz, eine mangelnde Steuerung und Fehlanreize im System, welche «zu Ineffizienzen und unnötigen Kosten führen» (BAG - Bundesamt für Gesundheit, 2013, S. 4). Diese Faktoren tragen dazu bei, dass das Gesundheitssystem zwar zu den weltbesten gehört, gleichzeitig aber auch eines der teuersten ist. «In kaum einer Branche sind die Herausforderungen durch politische Entscheidungen, gesellschaftliche Veränderungen und technische Ansprüche derzeit so hoch wie im Gesundheitswesen» (Swisscom, 2016, S. 4). Zahlreiche Entwicklungen haben die Branche in den vergangenen Jahren geprägt. Dazu gehören hauptsächlich zwei gesetzliche Vorgaben: das 2012 in Kraft getretene Tarifsystem SwissDRG, welches «[…] die Vergütung der stationären Spitalleistungen nach Fallpauschalen schweizweit einheitlich regelt […]» (swissdrg, 2017) und das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPD), welches Spitäler dazu zwingt, ihren Patienten bis im April 2020 ein ebensolches (eHealth Suisse, 2017) anzubieten. Vor allem diese regulatorisch verordnete Vernetzung mit anderen Leistungserbringern beschäftigt speziell Spitäler gleich auf mehreren Ebenen. Sie hat in vielen Organisation die Hinterfragung und Modernisierung der IT-Systeme losgetreten und gleichzeitig Diskussionen rund um den Schutz und die Sicherheit von Patientendaten entfacht. Es wäre aber falsch, die digitalen Möglichkeiten im Gesundheitswesen nur auf das EPD oder eHealth zu reduzieren, denn diese gehen weit über die beiden Themen hinaus. Der Bund sieht in der Digitalisierung ein wichtiges und zentrales Instrument zur Erreichung seiner gesundheitspolitischen Ziele. Er will die digitale Transformation aktiv und koordiniert vorantreiben und versteht die Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit als Voraussetzung, damit die Digitalisierung vollumfänglich ins Rollen kommen kann. Investiert werden soll vor allem in Infrastrukturen, Schnittstellen und in die digitale Kompetenz der Bürger im Umgang mit Gesundheitsdaten (eHealth Suisse, 2018, S. 3 - 4). Die Digitalisierung der Branche liegt im Interesse aller Akteure und die Erwartungen sind dementsprechend gross. Man verspricht sich von ihr, dass sie langjährige Branchenprobleme löst. Sie soll zu Qualitätsverbesserungen, einer Erhöhung der Patientensicherheit, einer Vereinfachung der Behandlungsprozesse und zu deutlichen Effizienzsteigerungen führen (Microsoft, 2017, S. 4; ZHAW, 2016, S. 4). 17 3.1. Digitalisierung im Gesundheitswesen «Lange Lunte, grosser Knall!» prophezeite 2015 die «Disruption Map nach Industrien» (Abbildung 5) dem Gesundheitswesen. Das bedeutet, dass die Branche erst spät, dafür umso heftiger von den Auswirkungen der Digitalisierung getroffen wird. Drei Jahre später ist die Digitalisierung definitiv im Schweizer Gesundheitswesen angekommen und sie schreitet unaufhörlich voran (eHealth Suisse, 2018, S. 3; MSM Research AG, 2017, S. 3; ZHAW, 2017). Entscheidungsträger sollten sich deshalb nicht mehr die Frage stellen, ob das digitale Gesundheitswesen das Ökosystem, die Arbeitsweise oder den Umgang mit Patienten verändert, sondern wann und wie wuchtig es die eigene Institution trifft (MSM Research AG, 2017, S. 9). Abbildung 5: Disruption Map nach Industrien Quelle: Deloitte Digital und Heads! (2015, S. 5) Die Digitalisierung der Branche führt unweigerlich zu einem stark vernetzten, digitalen Ökosystem. Dieses wiederum bewirkt eine spürbare Verbesserung der Datenqualität, deren professionelle Analyse und Auswertung die Türen für eine individualisierte und personalisierte Medizin öffnet (PWC Schweiz, Google Switzerland GmbH, & digitalswitzerland, 2016, S. 13). «Allerdings entwickeln sich die Werkzeuge und Anwendungen schneller als die beruflichen und gesellschaftlichen Normen. […] Angesichts autonomer, befähigter Patienten und einer Automatisierung der Prozesse ändern sich auch die Rollen der Gesundheitsfachleute. All das erfordert eine sorgfältige Reflexion über den Platz des Menschen in einer Welt der Technologie und der künstlichen Intelligenz» (SAMW, 2017, S. 3). 18 3.2. Digital Health Wenn man Studien über die Digitalisierung des Gesundheitswesens liest, trifft man unweigerlich auf Ausdrücke wie eHealth, Mobile Health oder Digital Health. Die ZHAW (2017, S. 7 - 8) hat diese Begriffe in ein Modell (Abbildung 6), eingeordnet, um ein einheitliches Verständnis dafür zu schaffen. Das Thema eHealth hat sich mit der Verbreitung des Web als Inbegriff für den elektronischen Austausch von med. Informationen etabliert. Mit dem Durchbruch und der Nutzung von mobilen Endgeräten war Mobile Health als Unterbegriff von eHealth plötzlich in aller Munde. Heute spricht man von Digital Health als Oberbegriff, welcher beide Themen umfasst. Abbildung 6: Das WIG-Ordnungsmodell Quelle: ZHAW (2017, S. 10) Trend Health umfasst hauptsächlich Lifestyle-Themen wie Fitnessarmbänder oder Social Media wo hingegen eHealth, historisch geprägt, für die Vernetzung und den Informationsaustausch im med. Bereich steht, mit der Telemedizin oder dem EPD als bekannteste Beispiele. Tech Health wird vor allem durch Geräte und disruptive Technologien geprägt und die Themen Datensammlung, -analyse und -interpretation gehören schliesslich zu Data Health (ZHAW, 2017, S. 8 - 9). Weitere wichtige Technologie-Trends für die Branche sind die Telemedizin, Wearables, Big Data, künstliche Intelligenz und Robotertechnologien (SAMW, 2017, S. 3). 19 3.3. Digitalisierung in Schweizer Spitälern «Die Spitallandschaft der Schweiz ist geprägt von einer Vielzahl von Akteuren, einer starken Fragmentierung und einem hohen Komplexitätsgrad. Zudem unterliegt sie einem stetigen Wandel: der demografischen Entwicklung, der Zunahme chronischer Krankheiten, mangelnder Steuerbarkeit und Transparenz, steigendem Kostendruck und neuen Versorgungs- und Finanzierungsformen» (ZHAW, 2016, S. 4). Hinzu kommen Trends wie die Verlagerung von stationären zu ambulanten Eingriffen oder der Überkonsum von med. Leistungen (santésuisse, 2016; Swisscom, 2016, S. 4). Gepaart mit den bekannten Branchenproblemen wie zunehmendem Mangel an Fachpersonal (Hausärzte und Pflegefachkräfte), steigendem Wettbewerb, oder fehlender Transparenz, ergibt sich aus dieser Konstellation ein akuter Handlungsbedarf für Kliniken und Spitäler und zwar auf multiplen Ebenen (ZHAW, 2017). Nun sehen sich die Kliniken und Spitäler zusätzlich mit der Digitalisierung konfrontiert, welche auch in der Gesundheitsbranche in raschem Tempo voranschreitet und dem Strukturwandel zusätzliche Dynamik verleiht. Dass das Thema die Branche erfasst und in den Köpfen vieler Entscheidungsträger angelangt ist, zeigt sich an der Zunahme von Events und Kongressen zu digitalen Fragestellungen, wie auch in aktuellen Branchenstudien, welche sich immer stärker auf die neuen Technologien und Herausforderungen fokussieren. Trotz dieser in Gang gekommenen Digitalisierungsdebatte scheinen sich die Leistungserbringer mit der Digitalisierung noch eher schwer zu tun. In verschiedenen Untersuchungen schneidet die Branche als Ganzes nicht allzu gut ab. 3.3.1. Stand der Digitalisierung Zum effektiven Stand des digitalen Fortschritts von Spitälern existiert kaum Literatur. Konsultiert man die wenigen, zugänglichen Analysen und betrachtet deren Resultate, so fällt das Fazit auf den ersten Blick ernüchternd aus. Aus einer subjektiven Perspektive betrachtet, lassen die Ergebnisse vermuten, dass die meisten Akteure mit dem Thema überfordert zu sein scheinen und drohen in eine Art Angststarre zu verfallen. «Die Unternehmen, die am stärksten digitalisiert sind, kommen oft aus der Telekommunikations- und der Medienbranche sowie aus dem öffentlichen Sektor, wobei zu Letzteren auch Stiftungen gezählt werden. Die Energie- und Versorgungsbranche sowie der Gesundheitsbereich haben hingegen den grössten Rückstand» (PWC Schweiz, Google Switzerland GmbH, & digitalswitzerland, 2016, S. 5). «Im Gesundheitssystem Kommunikationstechnologien ist der weniger Einsatz weit von fortgeschritten Informationsals in und anderen Dienstleistungsbereichen» (ehealthsuisse, 2018, S. 3). 20 «Die Digitalisierung ist im Gesundheitswesen weniger weit fortgeschritten als in anderen Branchen» (MSM Research AG, 2017, S. 3). Die Fachzeitschrift «Clinicum» stellt in ihrer digitalen Spitalanalyse kein sehr gutes Zeugnis aus und stellt fest, dass die Spitäler der digitalen Transformation hinterherhinken, insbesondere bei der Integration von Self-Services (clinicum, 2015). «digital.swiss», eine gemeinsame Initiative von ICTswitzerland, economiesuisse und digitalswitzerland, beurteilt die digitale Reife der Branche auch nicht allzu optimistisch. Laut Einschätzungen steht die Digitalisierung noch ganz am Anfang – sie ist erst zu 24 % vollzogen. Die Initiative fordert denn auch mehr Innovation mit Fokus auf den Patientennutzen ohne aber dabei die Themen Datenschutz und -hoheit zu vernachlässigen (digital.swiss, 2017). Im «Digital Maturity & Transformation Report 2017» (Back, Berghaus, & Kaltenrieder, 2017, S. 19), bildet die Branche mit 2,57 von 5 möglichen Punkten das Schlusslicht und hat sich bezügliche der digitalen Reife im Vergleich zu 2016 sogar leicht verschlechtert. Begründet wird dieser Rückstand damit, dass im Gesundheitswesen der persönliche Austausch noch immer oberste Relevanz hat und Vertrauen einen hohen Stellenwert geniesst. Weiter hat die starke Regulierung der Branche einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das schlechte Abschneiden. Nicht zuletzt halten auch die hohen Anfangsinvestitionen Spitäler davon ab, digitale Strategien und Projekte voranzutreiben (PWC Schweiz, Google Switzerland GmbH, & digitalswitzerland, 2016, S. 12ff). Microsoft (2017, S. 2) ergänzt, dass sich die Branche mit ihren Sicherheitsansprüchen selber im Wege steht. Die Angst vor Cyberkriminalität und Datenklau gelten als Hauptursachen für die schleppenden Digitalisierungsbemühungen. Als weitere Stolpersteine werden die vielen Brüche im Behandlungsprozess, die mangelnde Vernetzung der Akteure untereinander oder das veraltete Tarif-/Abrechnungssystem genannt. 3.4. Studien & Analysen Nachfolgend präsentiert der Autor relevante Studien für seine Arbeit. Sie zielen auf digitale Themen im Gesundheitswesen ab, wenn auch mit teils divergierendem Fokus. 3.4.1. Analyse von KPMG Die Analyse von KMPG (2017) mit dem Titel «Clarity on Healthcare. Digitalisierung: Wo liegen die Potentiale für das Gesundheitswesen?» untersucht mit Dr. sc. Stephan Sigrist, Gründer des Think Tanks W.I.R.E., politische, kulturelle, technologische und rechtliche Fragestellungen. Die zentralen Aussagen im Überblick: 21 Digitalisierung ist ein kultureller Prozess, der die gesamte Organisation durchdringt, wobei die Politik in der Ausgestaltung von innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen für neue Geschäftsmodelle der Wirtschaft noch hinterherhinkt (KPMG, 2017, S. 3). Mit dem Einsatz von neuen Technologien und der Möglichkeit einer schnelleren, genaueren und umfassenderen Datenverarbeitung verändert und reduziert sich die Art und Weise wo und wie Leistungen im Gesundheitswesen künftig erbracht werden (KPMG, 2017, S. 3). Das Thema Cyberkriminalität und -sicherheit hat drastisch an Bedeutung gewonnen und steht auf der Agenda der IT-Verantwortlichen weit oben (KPMG, 2017, S. 3). Am Anfang der Debatte über die Digitalisierung im Gesundheitsbereich steht die Auseinandersetzung mit der technischen Machbarkeit und der ethischen Wünschbarkeit (KPMG, 2017, S. 12). Der grösste Benefit der Digitalisierung wird bei der Nutzung von Algorithmen und künstlicher Intelligenz zur schnelleren und präziseren Diagnostik erkannt. Das Erheben und Interpretieren von Daten kann erhebliche Veränderungen im präventiven Bereich hervorbringen. Informationsasymmetrien in Systemen werden als potenzielles Risiko eingestuft (KPMG, 2017, S. 13). Die Grundsatzfragen welche man sich bei der Digitalisierung stellen muss, drehen sich um die Themen Datenschutz und Datenhoheit, d.h. es muss geklärt werden, wo diese gespeichert werden, wer darauf Zugriff hat und wem diese schlussendlich gehören. Nur der Patient kann und soll über die Zurverfügungstellung seiner persönlichen, intimen Daten entscheiden (KPMG, 2017, S. 13). Die Studie kommt zum Schluss, dass Spitäler noch ein eher klassisches Verständnis von Digitalisierung haben. Noch liegt der primäre Fokus auf der Verbesserung des internen Informationsflusses, auf der Optimierung der Kapazitäten oder der Entlastung des Personals. Die Analyse stellt fest, dass vorwiegend Insellösungen, schwerfällige Schnittstellen und eine starre Organisation das Bild im Spital prägen (KPMG, 2017, S. 15). Als Fazit gibt die Analyse Spitälern Empfehlungen ab, wie sie die Digitalisierung erfolgreich anpacken können. Gefordert ist eine Digitalisierungsstrategie mit Blick auf den Gesamtkontext und dass die Thematik zur Chefsache erklärt wird. Betroffene sollen zu Beteiligten gemacht, Etappenziele formuliert und externe Experten konsultiert werden (KPMG, 2017, S. 16). 22 3.4.2. Branchenreport der ZHAW Der Branchenreports der ZHAW (2016), beleuchtet die wichtigsten Entwicklungen der Schweizer Spitalbranche und leitet daraus neun Trends für die nächsten Jahre ab: Mobile Health wird sich in Form von Überwachungs- und Betreuungsgeräten weiter ausbreiten. Wearables und Apps gewinnen an Bedeutung in der Betreuung von chronischen Krankheiten (ZHAW, 2016, S. 38). Die eHealth-Abstinenz von Patienten oder Gesundheitspersonal führen zu Doppelspurigkeiten. Dokumente existieren weiterhin sowohl in Papierform wie auch elektronisch, was Ineffizienzen fördert und die Patientensicherheit gefährdet (ZHAW, 2016, S. 39). Berufsbilder verändern sich und somit werden Aufgaben, welche bislang von Ärzten erledigt wurden, künftig an andere Gesundheitsfachpersonen delegiert, bzw. von diesen übernommen (ZHAW, S. 39). Der Fachkräftemangel spitzt sich in den kommenden Jahren weiter zu, nicht nur in der Pflege, sondern auch in med. Fachrichtungen wie z.B. in der Allgemeinmedizin (ZHAW, 2016, S. 40). Der Trend zu «Lean Management» weitet sich auch in der Spitalbranche aus und wird zu einer vielversprechenden Management-Philosophie für Spitalbetreiber (ZHAW, 2016, S. 40). Die Zusammenarbeit von Kliniken in Form von Spitalnetzwerken oder durch eine vertikale Integration von vor- und nachgelagerten Leistungserbringern schreitet weiter voran (ZHAW, 2016, S. 41). Der Trend von stationären zu ambulanten Aufenthalten führt dazu, dass sich vermehrt Patientenhotels entwickeln, in welchen Patienten zwar noch gepflegt aber nicht mehr so ausgeprägt betreut werden (ZHAW, 2016, S. 41). Der Medizin-Tourismus führt dazu, dass sich vermehrt Schweizer kostengünstig im Ausland behandeln lassen (ZHAW, 2016, S. 42). Patienten fordern eine bessere Transparenz von Leistungen und med. Qualität, was zu einer zunehmenden Relevanz von Vergleichsplattformen bei der Arzt- und Spitalwahl führt (ZHAW, 2016, S. 42). 23 3.4.3. CEO Survey «Spitalmarkt Schweiz» von PWC Schweiz PWC (2017) hat die rund 250 CEOs von Schweizer Kliniken und Spitälern zu aktuellen Trends und Herausforderungen befragt. Zusammenfassend ergeben sich daraus fünf Handlungsfelder, welche die Branche beschäftigen und die Entscheidungsträger auf Trab halten. Die Stabilisierung der Profitabilitätsmargen ist aktuell die grösste Herausforderung. Die Spitaldirektoren rechnen mit einer weiteren Steigerung der Fallzahlen bei gleichzeitig sinkenden Preisen – im stationären und ambulanten Bereich. Dennoch gehen sie nicht von Profitabilitätseinbussen aus, was darauf schliessen lässt, dass nach wie vor genügend Spar- und Optimierungspotenzial besteht (PWC, 2017, S. 6 - 7). Der Gewinndruck verlangt von Spitälern Effizienzsteigerungen und die Verbesserung von Abläufen und Prozessen. «Über 90 % der befragten CEOs geben an, die Optimierung von Support- und med. Kernprozessen geplant zu haben. 66 % […] streben strategisch eine Erhöhung der Patientenzentrierung an» (PWC, 2017, S. 9). Zudem rechnen die meisten mit einer Verschärfung des Wettbewerbs um Zusatzversicherte. Die Branche geht von einer geografischen Ausweitung der beiden grossen Privatklinikgruppen (Swiss Medical Network und Hirslanden) aus. Dies obwohl die Studie erklärt, dass «[…] Kooperationen mit vor- und nachgelagerten Institutionen wichtiger sind, als Kooperationen mit direkten Mitbewerbern» (PWC, 2017, S 10). Worüber sich die CEOs wenig Sorgen machen, ist der Eintritt von neuen Marktteilnehmern. Die Studie legt den Direktoren ausdrücklich nahe, die Veränderung des Umfelds nicht zu verschlafen und gleichzeitig offen zu sein für konventionelle aber auch branchenfremde Kooperationen (PWC, 2017, S. 10). 90 % der Direktoren gehen von einer Zunahme der Erwartungshaltung von Patienten aus und zwar hinsichtlich Qualität, Effizienz und Komfort. Im Bereich Datenschutz wird aber nicht erwartet, dass sich die Ansprüche stark verändern. Jedoch wird erwartet, dass Patienten künftig einen einfacheren Zugang zu ihren Daten verlangen. PWC (2017, S. 15) empfiehlt Spitälern trotz anfänglich hoher Investitionskosten dennoch in die Digitalisierung und Automatisierung zu investieren, weil bereits mittelfristig mit positiven Effekten in Bezug auf Effizienz und Prozessqualität zu rechnen ist. Weiter fortsetzen wird sich der Trend von stationären zu ambulanten Aufenthalten, was sich vor allem darin zeigt, dass 90 % der Spitäler eine Ausweitung ihrer ambulanten Versorgung planen. Ähnlich hoch ist der Anteil an Institutionen, welche mit vorgelagerten Leistungserbringern wie Hausärzten zusammenarbeiten. PWC (2017, S. 18) prognostiziert, dass sich damit auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, welche wiederum neue bzw. branchenfremde Markteilnehmer anziehen. 24 3.4.4. Weitere Quellen Das Beratungsunternehmen Roland Berger (2017) hat in seiner «Krankenhausstudie 2017» das Management der 500 grössten deutschen Krankenhäuser zur wirtschaftlichen Lage, Trend und Entwicklungen befragt. Die Digitalisierung wird von den Befragten als Chance wahrgenommen und deren Auswirkungen positiv bewertet. Knapp 90 % geben an, eine Digitalisierungsstrategie zu verfolgen und sie erzielen damit durchaus spürbare wirtschaftliche Verbesserungen. Roland Berger (2017) begründet dies damit, dass die Spitäler zielgerichteter investieren. Zwei Drittel der Institutionen wurden bereits Opfer von Hackerangriffen. Trotzdem fliessen von den Investitionen bei 91 % der Häuser lediglich 2 % oder weniger ihres Umsatzes in die Informationstechnologie. Die IT wird demnach noch nicht als relevantes Investitionsfeld angesehen, auch wenn ohne moderne IT-Infrastruktur die Digitalisierung kaum bewältigt werden kann. Immerhin bestehen bei 24 % der Umfrageteilnehmer bereits Kooperationen mit Start-Ups. Als grösste Hürden für die Digitalisierung werden der hohe Investitionsbedarf, die Zusatzbelastung für Organisation und Mitarbeitende, Probleme beim Datenaustausch/bei der Datensicherheit und mangelndes digitales Wissen genannt (Roland Berger, 2017). PWC Schweiz, Google Switzerland GmbH und digitalswitzerland (2016) untersuchen in einer Studie, wo Schweizer KMUs in Bezug auf Digitalisierung stehen. Die Analyse erkennt, dass die Gesundheitsbranche fast den grössten Rückstand aufweist (1,84 von 4 Punkten) und sich mit der Digitalisierung offensichtlich schwertut. Sie warnt die Leistungserbringer davor, nicht stehen zu bleiben, sondern die Entwicklungen im Markt gut zu beobachten und stärker auf Innovation zu setzen (PWC Schweiz, Google Switzerland GmbH, & digitalswitzerland, 2016, S. 12). Die Ergebnisse zeigen, dass die Konkurrenzfähigkeit mit Investitionen in die Digitalisierung bereits mittelfristig steigt. Die erfolgreichen KMUs fördern die digitale Unternehmenskultur proaktiv indem sie Mitarbeitende gezielt schulen und punktuell Experten hinzuziehen. Die Studie belegt, dass der digitale Wandel unterschiedlichste Bereiche tangiert, dass sie kein isoliertes IT-Projekt sein darf, sondern im Gesamtkontext betrachtet werden und deshalb zwingend Chefsache sein sollte. Wenn sie mit Fokus auf die Erfahrung und den Nutzen der Kunden geschieht und mit dem kulturellen Wandel und prozessualen Verbesserung einhergeht, werden die Erfolgschancen am besten eingeschätzt. Die grössten Herausforderungen liegen gemäss den Autoren der Studie beim fehlenden Knowhow und im finanziellen Bereich, denn «Wer die Digitalisierung vorantreiben will, muss Geld in die Hand nehmen» (PWC Schweiz, Google Switzerland GmbH, & digitalswitzerland, 2016, S. 14). 3.4.5. Zusammenfassung des Status Quo Die Analyse und Auswertung der Theorie zeigen eindrücklich auf, dass für Kliniken und Spitäler ein enormer Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen besteht. Sie stehen richtiggehend unter Zugzwang und sind sowohl dem Druck der Wirtschaft, der Konsumenten und Mitarbeitenden, des Regulators und nicht zuletzt der Technologie ausgesetzt (SAMW, 2017, S. 1). 25 Zum Abschluss des Kapitels, werden die wichtigsten Trends und Entwicklungen (Tabelle 3) innerhalb der Branche nochmals in einer Übersicht zusammengefasst. Tabelle 3: Trends und Entwicklungen im Gesundheitswesen (Eigene Darstellung) Ökonomische Trends Soziokulturelle Trends Verschärfung des Wettbewerbs (Über-)Alterung der Gesellschaft Zunehmender Kostendruck Zunahme von chronischen Erkrankungen Sinkende Margen Multimorbidität Erhöhter Investitionsbedarf Ältere erwarten menschliche Pflege Start-Ups und branchenfremde Junge wollen raschen und einfachen Unternehmen treten in den Markt ein Zugang zum Gesundheitssystem Zunehmender Mangel an Hausärzten Gesteigerte Erwartungshaltung von Personalmangel in der Pflege Patienten und Mitarbeitenden gegenüber Personalisierung der Medizin Spitälern Verbreitung von Walk-In Praxen und ambulanten Zentren Wandel von der spital- zur Gesundheit wird ein Lifestyle-Thema Machtverschiebung vom Arzt zum Patienten («Patient Empowerment») patientenzentrierten Medizin Politische und rechtliche Trends Technologische Trends Einführung des elektronischen Digitalisierung Patientendossiers (EPD) Disruptive Technologien Revision des Tarifsystem SwissDRG o Big Data & Analytics Fehlanreize im System o Roboter & künstliche Intelligenz («Krankheits- statt Gesundheitswesen») Innovationsfeindliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen Strenge gesetzliche Vorgaben in Bezug auf Verwendung von Gesundheitsdaten o Virtual Reality o Telemedizin o Wearables o 3D-Druck Cyberkriminalität nimmt zu Datenschutz, -verfügbarkeit und -hoheit gewinnen an Relevanz Vor diesem Hintergrund interessiert es umso mehr, zu erforschen, inwiefern die Auswirkungen des digitalen Wandels in den Strategieüberlegungen von Schweizer Kliniken und Spitäler berücksichtigt sind und welche Rolle sie dabei spielen. Es reizt, in Erfahrung zu bringen, in welchen Dimensionen der Digitalisierung Problem- oder Kompetenzfelder bestehen und den Handlungsbedarf aufzuzeigen. 26 «Spitäler, die am Status quo festhalten, werden Marktanteile einbüssen. Was zählt, sind die Fähigkeit sich zu wandeln, die Bereitschaft, aktiv in Gestaltungsprozesse einzugreifen und die Kenntnis der eigenen digitalen Position.» (KPMG, 2017, S. 31) 27 4. Empirische Untersuchung Bevor die Forschungsergebnisse präsentiert werden, beschreibt dieses Kapitel das konkrete Vorgehen und die Methodik. Die Erörterung der Vorgehensweise gewährleistet die Nachvollziehbarkeit und berücksichtigt die wissenschaftlichen Anforderungen, welche an die Arbeit gestellt werden. Vereinfacht gesagt geht es bei der empirischen Sozialforschung darum, die Theorie an der Realität zu testen. Atteslander (2010, S. 4ff) beschreibt sie als «[…] die systematische Erfassung und Deutung sozialer Erscheinungen. Empirisch bedeutet, dass theoretisch formulierte Annahmen an spezifischen Wirklichkeiten überprüft werden». Abhängig vom Forschungsziel, dem Wissensstand des Forschenden oder den Faktoren Zeit und Machbarkeit, kommen in der Praxis unterschiedliche Erfassungsinstrumente wie Befragungen, Beobachtung oder Interviews zum Einsatz. Im Folgenden wird dem Leser das Forschungsdesign näher erläutert. «Ob es sich um Betreten von Neuland und den Versuch einer Feststellung komplexer Zusammenhänge handelt oder um relative Routineuntersuchungen, die ähnlich schon oft durchgeführt worden sind […]: Für alle Vorhaben der empirischen Sozialforschung gelten im Grunde die gleichen Regeln» Atteslander (2010, S. 21). Der weitere Verlauf der Untersuchung orientiert sich an der Vorgehensweise von Kornmeier (2016, S. 123ff), denn im Falle von hypothesenprüfenden Untersuchungen verlangt die Wissenschaft die Erläuterung der einzelnen Schritte im Forschungsprozess (Tabelle 4). Tabelle 4: Schritte im Forschungsprozess (eigene Darstellung) 1. Schritt Ziele und Forschungsgegenstand 2. Schritt Hypothesenbildung 3. Schritt Potenzielle Informationsquellen 4. Schritt Forschungsmethoden 5. Schritt Wahl der Erhebungsinstrumente 6. Schritt Planung der Stichprobe 7. Schritt Methoden zur Datenanalyse 28 4.1. Ziele und Forschungsgegenstand Die Master-Thesis verfolgt das Ziel, den digitalen Reifegrad der Schweizer Kliniken und Spitäler zu ermitteln und Aussagen zum Fortschritt der Digitalisierung im Spitalwesen zu machen. Zur Vereinfachung wird die übergeordnete Fragestellung in drei Teilfragen zerlegt. Geforscht wird nach der allgemeinen Relevanz des Themas Digitalisierung in Kliniken und Spitälern, nach dem eigentlichen Reifegrad der Spitäler sowie nach hemmenden Faktoren für eine schneller voranschreitende Digitalisierung. 4.2. Hypothesenbildung Hypothesen spielen in der Forschung eine wichtige Rolle, weil sie der Überprüfung von theoretischen Vermutungen und Annahmen in der Realität dienen. Sie müssen allgemeingültig, empirisch überprüfbar, falsifizierbar und widerspruchsfrei sein um die wissenschaftlichen Akzeptanzkriterien zu erfüllen (Kornmeier, 2016, S. 125 - 131). Als Basis für die Formulierung der Hypothesen (Tabelle 5) dienen die gewählten Forschungsfragen und der aktuelle Wissensstand, aufbauend auf den theoretischen Grundlagen. Tabelle 5: Zu untersuchende Hypothesen (eigene Darstellung) 1. Hypothese 2. Hypothese 3. Hypothese 4. Hypothese 5. Hypothese 6. Hypothese 7. Hypothese Die Digitalisierung wird im Spital als «eher wichtig» eingeschätzt. Die Mehrzahl (>50 %) der Schweizer Spitäler verfügt über keine Digitalstrategie. Das Thema Digitalisierung ist in Spitälern mehrheitlich «Bottom-Up» bei der IT angesiedelt und nicht «Top-Down» in der Geschäftsleitung. Die Dimension «Patientenerlebnis» weist den höchsten, die «digitale Unternehmenskultur» den tiefsten Reifegrad auf. In den Kliniken und Spitälern zählen Operations-Roboter zu den am meist verbreiteten Technologien. Universitätsspitäler weisen den höchsten digitalen Reifegrad im Spitalwesen auf. Der meistgenannte Hemmfaktor der Digitalisierung sind fehlende finanzielle Mittel. 29 4.3. Potenzielle Informationsquellen Bei der Art der Informationsbeschaffung wird zwischen Primär- und Sekundärforschung unterschieden, bei der Herkunft der Daten zwischen Literatur und Empirie (Kornmeier, 2016, S. 97). Für die Beantwortung der Forschungsfragen stehen keine Daten zur Verfügung. In den bisherigen Studien zur digitalen Bereitschaft erscheint das Gesundheitswesen jeweils nur gesamthaft ohne spezifische Details über Spitäler. Der Autor entschliesst sich deshalb dazu, selber Primärforschung zu betreiben und so die notwendigen originären Daten zu erheben. Abhängig von der Problemstellung des Forschungsprojektes eignen sich dazu verschiedene Vorgehen und Methoden (Röbken & Wetzel, 2016, S. 12). «Selten wird es dabei möglich sein, eine eindeutige Entscheidung für ein Datenerhebungsinstrument zu treffen. Diese hängt ab vom speziellen Interesse, den entwickelten Detailfragen der geplanten Untersuchung, den vorhandenen personellen und finanziellen Arbeitsmöglichkeiten und […] von den schon vorhandenen empirischen Untersuchungen» (Atteslander, 2010, S. 208 - 211). 4.4. Forschungsmethoden Die Literatur unterscheidet zwischen quantitativen und qualitativen Erhebungsmethoden, wobei die beiden Formen auch gekoppelt zum Einsatz kommen (Atteslander, 2010, S. 5; Mayring, 2015, S. 17). Beim «Mixed Methods»-Ansatz (Hussy, Schreier, & Echterhoff, 2010, S. 279ff) werden die Vorteile der beiden Methoden kombiniert. Dies sind bei quantitativen Methoden die Messbarkeit und Vergleichbarkeit der Daten, die Chance zur Analyse einer grossen Stichprobe, tiefe Kosten und ein geringer Zeitaufwand. Qualitative Methoden punkten durch ihre Flexibilität und Offenheit sowie der Möglichkeit einen tieferen Informationsgehalt generieren zu können. Zu den Nachteilen zählen bei quantitativen Vorgehen deren Starrheit durch Standardisierung, den eher zeit- und kostenintensiven qualitativen Ansätzen wird hingegen Interpretation vorgeworfen. Zudem sind die Anforderungen an die Qualifikation des Interviewers relativ hoch (Röbken & Wetzel, 2016, S. 15). Während die quantitative Forschung objektbezogen ist, vorab festgelegten Mustern folgt und experimentell nach Erklärungen oder Beweisen sucht, ist die qualitative Vorgehensweise subjektbezogener Natur und zeichnet sich durch Exploration und Interpretation aus (Lamnek, 2006 in Röbken & Wetzel, 2016, S. 12; Scheibler, o.J.). Quantitative Methoden versuchen theoriegeleitet Daten zu sammeln, welche den Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität entsprechen und sie dienen primär der Hypothesenprüfung (Mayring, 2015, S. 17 - 25). Atteslander (2010, S. 6) ergänzt und präzisiert: «Angestrebt wird Objektivität. Das Erfassen gesellschaftlicher Daten muss intersubjektiv nachvollziehbar sein. Unabhängig von Neigungen und Fähigkeiten einzelner Forscher sind die einzelnen Schritte der Erforschung sozialer Tatbestände sowie ihre Deutung durch Dritte kontrollierbar zu gestalten. […] Ein Befragungsinstrument ist dann verlässlich, wenn es so exakt misst, dass bei Wiederholungen unter gleichen Bedingungen identische Ergebnisse erzielt werden. Die Gültigkeit betrifft die Frage, ob ein Messinstrument auch das misst, was es messen soll». 30 4.5. Wahl der Erhebungsinstrumente Nach Abwägung der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Methoden und unter Berücksichtigung der praktischen Umsetzbarkeit, entscheidet sich der Autor für die Kombination von quantitativen und qualitativen Instrumenten. Die Vorteile der beiden Verfahren überwiegen die Nachteile und sind der Wissenschaftlichkeit und Qualität der Untersuchung zuträglich. Die Erhebung der Rohdaten geschieht in Form eines Online-Fragebogens welcher als standardisiertes, strukturprüfendes Erhebungsinstrument dient und geschlossene Fragen umfasst. Dabei werden Entscheidungsträger von Schweizer Kliniken und Spitäler aufgefordert, ihre persönliche und subjektive Einschätzung zum Stand der Digitalisierung bei ihrem Arbeitgeber abzugeben. Damit die Ergebnisse der Umfrage besser verstanden und eingeordnet werden können, führt der Autor ergänzend vier Interviews mit Experten aus der Gesundheitsbranche durch. Diese finden als teilstrukturierte Leitfadeninterviews statt und kennzeichnen sich durch ihre offenen Frageformulierungen (Atteslander, 2001, S, 86 - 96). Durch die Gespräche erhofft sich der Autor an wertvolle Hintergrundinformationen über die untersuchten Themenfelder zu gelangen. Letzten Endes ermöglichen sie eine realitätsnahe Einschätzung der aktuellen Lage und die Formulierung von praxistauglichen Handlungsempfehlungen. 4.6. Online-Umfrage Der Studierende hat das Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität St.Gallen vor der Konzeption der Umfrage angefragt, um nicht nur Zugang zum Fragebogen des «Digital Maturity Model», sondern auch zur Gewichtung der einzelnen Fragen zu erhalten. Leider wurde ihm diese nicht zur Verfügung gestellt, weshalb die Erarbeitung eines eigenen Bewertungssystems den Rahmen der Arbeit gesprengt hätte. Bei einer Wiederholung der Befragung wird es sich anhand der Ergebnisse aus dieser ersten Erhebung weitaus einfacher gestalten, ein solches Raster zu kreieren. Vor allem wegen der Zeitkomponente verzichtet der Verfasser der Arbeit darauf, selber von Grund auf einen Fragebogen zu konzipieren. Er stützt sich im weiteren Verlauf der Forschung auf probate Erhebungsinstrumente zur Ermittlung des digitalen Reifegrades und adaptiert bzw. kombiniert diese zweckmässig. Der Anfangs- und Schlussteil der neu entstandenen Umfrage besteht aus Fragen der Erhebung «Digital Switzerland 2017» (Institute for Digital Business, o.J.), der Hauptteil untersucht die Reife anhand der Dimensionen des «Digital Maturity Model» (vgl. Kapitel 2.6.). 31 4.6.1. Aufbau des Fragebogens Der Online-Fragebogen umfasst gesamthaft 24 Fragen (Tabelle 6). Für die Beantwortung der Umfrage werden maximal 15 Minuten benötigt. In der Einleitung wird der Bezug der Umfrage zur Master-Thesis erklärt, dann wird auf die ungefähre Dauer sowie die anonyme und vertrauliche Behandlung der Daten verwiesen. Um die Teilnahmequote zu erhöhen und gleichzeitig die Abbruchrate auf möglichst tiefem Niveau zu halten, weist der Autor zu Beginn auf die Zurverfügungstellung der Umfrageresultate hin. Vor jedem der neun zentralen Themenblöcke werden die relevanten Begriffsdefinitionen vorgenommen, um bei den Befragten ein möglichst einheitliches thematisches Verständnis zu schaffen. Im Hauptteil der Befragung stehen die neun Dimensionen des «Digital Maturity Model» im Zentrum. Die Teilnehmenden müssen pro Dimension bis zu neun Aussagen in einer fünfstufigen Likert-Skala einordnen. Diese Abstufung gewährleistet eine rasche Orientierung für die Teilnehmenden und trägt deren Ermüdung, der Fragebogen ist eher umfangreich, Rechnung. Die Antwortoptionen reichen von «trifft gar nicht zu» (2 Punkte) bis zu «trifft völlig zu» (5 Punkte). Aufgrund der thematisch breiten Ausprägung der Fragen wurde auch die Antwortmöglichkeit «keine Aussage/weiss nicht» (1 Punkt) hinzugefügt, mit der Idee, dass Unkenntnis als Reifeindikator mit der Minimalnote bewertet werden sollte. Der digitale Reifegrad errechnet sich pro Dimension aus dem Mittelwert der Antworten und schlussendlich aus dem Durchschnitt aller Dimensionen – ein Beispiel: Die Dimension «XYZ» beinhaltet 7 Fragen zu ihrem Themengebiet. Pro Frage ist ein Punktemaximum von 5 Punkten möglich. Die Summe der Punkte aller Fragen, dividiert durch 7, ergibt den Reifegrad für diese Dimension. Zur Ermittlung des Reifegrads für die Branche wird wiederum das Total aller Dimensionsreifegrade durch die Anzahl der Dimensionen geteilt. Der erste Themenblock umfasst die Fragen 1 bis 5 und startet mit der Relevanz der Digitalisierung in der Spitalbranche. Weiter wird abgefragt, wie wichtig die Digitalisierung im eigenen Unternehmen eingestuft wird und wie sich diese in den nächsten zwei Jahren verändern wird. Dieser Teil schliesst mit der Frage, ob eine formulierte Digitalstrategie vorhanden ist und welcher Unternehmensbereich für das Thema zuständig zeichnet. Frage 6 fragt nach dem «Patientenerlebnis», welches entlang der Customer Journey auch Marketing- und Kommunikationsaktivitäten umfasst. Dazu gehören digitale Kanäle und Services gleichwohl wie die Nutzung von CRM-Systemen und Analysedaten zur Personalisierung und Individualisierung der Kundenkommunikation. Frage 7 nimmt das Thema «Produktinnovation» unter die Lupe und erfragt, ob und wie Innovationsthemen bereits in neuen digitalen Produkten und Dienstleistungen gründen. Auch die mögliche Einbindung von Kunden und Mitarbeitenden im Innovationsprozess interessiert in diesem Abschnitt. Die «Digitalstrategie» ist Untersuchungsgegenstand in Frage 8. Sie berücksichtigt die strategische Ausrichtung des 32 Unternehmens und die Prioritätensetzung insbesondere von digitalen Projekten. Frage 9 fokussiert auf die «Organisation» und zielt dabei auf die Hierarchiestruktur, die Agilität und interdisziplinäre Projektzusammenarbeit ab. Auch das Ressourcenthema und das digitale Ökosystem des Unternehmens wird abgefragt. Bei Frage 10 steht die «Prozessdigitalisierung» im Mittelpunkt. Sie forscht beispielsweise danach, ob und wenn ja wie Unternehmensprozesse an digitale Neuerungen angepasst und mit bestehenden IT-Systemen vernetzt werden. Im Vordergrund der elften Frage steht die «Zusammenarbeit» im Gesamtunternehmen. Untersucht werden hauptsächlich Thematiken wie Interdisziplinarität oder Wissensmanagement. Weiter werden auch Fragen zum Einsatz von Arbeitsformen wie Homeoffice oder Co-Working oder gestellt. Frage 12 dreht sich um das Themenfeld «Informatik & Technologie (ICT)», allen voran um den Einsatz und die Performance der zur Verfügung stehenden Systeme und Applikationen. Die Relevanz und Rolle der IT ist ebenso Thema wie Aussagen zur Datensicherheit oder der Umgang mit möglichen Bedrohungsszenarien. Die «digitale Unternehmenskultur» ist Gegenstand von Frage 13. Sie fragt danach, ob und wie stark bereits im Rekrutierungsprozess Wert auf digitales Knowhow gelegt wird. In diesem Abschnitt wird auch ermittelt, wie fortgeschritten der unternehmensinterne Wissensaufbau rund um digitale Themen organisiert ist. Diese Dimension beinhaltet auch die Einordnung von Digital Leadership, sprich, ob und wie digitales Denken und Handeln vom Management vorgelebt wird. Der Hauptteil schliesst ab mit der Frage 14, zur «digitalen Transformation». Es wird erfragt, in welchem Ausmass sich das Unternehmen mit seiner langfristigen Weiterentwicklung auseinandersetzt und ob Ideen oder Initiativen zur Digitalisierung des aktuellen Geschäftsmodelles bestehen. Mit Aussagen zur Erschliessung von neuen Geschäftsfeldern, zur Zieldefinition und -überprüfung endet dieser Themenblock. Frage 15 dreht sich um die im Unternehmen eingesetzten, disruptiven Technologien. Als Beispiele können hier 3D-Druck, Roboter oder Wearables genannt werden. Frage 16 thematisiert die potenziellen Hemmfaktoren für die Digitalisierung. Die Umfrage schliesst mit allgemeinen Fragen welche gewählt wurden, um die Antworten nach relevanten Kriterien kategorisieren und in sinnvolle Cluster fassen zu können. Frage 17 fragt nach dem offiziellen Spitaltyp nach BAG (2017, S. 3), Frage 18 ist die einzige optionale Antwortmöglichkeit – die Teilnehmenden können hier den Namen der Klinik/des Spitals angeben – und Frage 19 erfragt, ob eine Zugehörigkeit zu einer Spitalgruppe oder einem Spitalnetzwerk besteht. Frage Nummer 20 bezieht sich auf die Unternehmensgrösse. Hier wurde die Skala zur Beantwortung nach einem Pretest mit fünf Probanden aus dem Umfeld des Autors von vier auf sechs Antwortoptionen verfeinert. Bei Frage 21 und 22 interessieren die Abteilung und Position der Befragten. Formell endet der Fragebogen mit der Danksagung des Studierenden. Interessierten wird die Möglichkeit geboten, sich für die Zustellung der Resultate, ab Juli 2018, einzutragen. Abschliessend können die Befragten dem Autor ihr Feedback oder ihre Fragen zukommen lassen. 33 Tabelle 6: Die Gliederung der Online-Umfrage im Überblick (eigene Darstellung) Einleitung (Informationen zur Umfrage) Frage 1 Frage 2 Allgemeine Fragen zur Bedeutung der Digitalisierung Frage 3 Frage 4 Frage 5 Relevanz der Digitalisierung in der Spitalbranche Veränderung der Relevanz im eigenen Unternehmen in den nächsten 2 Jahren Heutige Relevanz der Digitalisierung im eigenen Unternehmen Vorhandensein einer Digitalstrategie Zuständigkeit für das Thema Digitalisierung Beschreibung des Patientenerlebnisses, «Patientenerlebnis» Frage 6 Einsatz und Nutzung von Marketing- und Kommunikationskanälen Umsetzung von neuen «Produktinnovation» Frage 7 Geschäftsmodellen oder digitalen Services, Gestaltung des Innovationsprozesses «Digitalstrategie» Frage 8 Umgang mit digitalen Themen und Projekten, strategische Implementation Organisatorische Aspekte wie «Organisation» Frage 9 Interdisziplinarität, Flexibilität, Ressourcen und Partnerschaften Integration in bestehende Prozesse und «Prozessdigitalisierung» Frage 10 Abläufe, Qualitäts- und Zieldefinition, Datenanalyse «Zusammenarbeit» Frage 11 Kollaboration, Wissensmanagement, Expertentum, neue Arbeitsformen IT-Systeme und -Infrastruktur, «Informatik & Technologie» Frage 12 Datensicherheit, Schnittstellen und Anbindungsmöglichkeiten 34 «Digitale Unternehmenskultur» Mitarbeitende, Rekrutierung, Aufbau von Frage 13 Wissen, Management Support, Fehlerkultur Zielsetzung und -überprüfung, «Digitale Transformation» Frage 14 Messbarkeit, Leadership, Zukunftsgestaltung Disruptive Technologien Herausforderungen der Digitalisierung Angaben zum Unternehmen und zur Person Frage 15 Einsatz von innovativen Technologien Frage 16 Hemmfaktoren Frage 17 Spitaltyp Frage 18 Name des Unternehmens (optional) Frage 19 Spitalgruppe Frage 20 Unternehmensgrösse Frage 21 Abteilung Frage 22 Position Frage 23 Information über die Ergebnisse Frage 24 Feedbackmöglichkeit Administratives Abschluss (Danksagung) 4.6.2. Planung der Stichprobe Die Auswahl der Befragten ist ausschlaggebend für den Erfolg der Untersuchung, denn durch sie sollen Daten gewonnen werden, welche Rückschlüsse auf die Allgemeinheit zulassen. Die Zielgruppe muss deshalb repräsentativ für diese Grundgesamtheit sein, damit die Erkenntnisse verallgemeinert werden können (Berekoven, Eckert, & Ellenrieder, 2009, S. 45). Zu den Zielpersonen der quantitativen Datenerhebung gehören Entscheidungsträger von Schweizer Spitälern, welche den Stand der Digitalisierung in ihrer Organisation aus einer möglichst ganzheitlichen Sicht beurteilen sollen. Es handelt sich bei der Zielgruppe hauptsächlich um Mitglieder der Geschäftsleitung oder des mittleren und höheren Kaders, welche in administrativen, nichtmedizinischen Bereichen arbeiten. Es interessieren die Einschätzungen von Mitarbeitenden der unterschiedlichen Spitaltypen und -grössen, sowie von Spitalgruppen und 35 Instituten welche keinem Spitalnetzwerk angeschlossen sind. Gemäss dem Bfs Bundesamt für Statistik (2017a) arbeiten in der Schweiz rund 161 945 Personen in Spitälern und davon 24 499 in der Administration. Wie viele davon zur anvisierten Zielgruppe gehören, wird bis dato nirgends offiziell beziffert. Die Grundgesamtheit wird dennoch als zu gross beurteilt, weshalb eine Vollerhebung, vor allem aus finanziellen und organisatorischen Gründen, undenkbar ist. Deshalb wird mit einer selbst selektierten Stichprobe gearbeitet. Davon ausgehend, dass jede zehnte administrativ tätige Person zur Zielgruppe gehört, umfasst die Grundgesamtheit ca. 2 500 Leute. Bei einem geschätzten Konfidenzniveau von 95 % und einer tolerierten Fehlermarge von 5 % beträgt die benötigte Stichprobengrösse 334 Personen (SurveyMonkey, o.J.). 4.6.3. Evaluation Umfrage- & Auswertungstool Bei der Evaluation der Software für die Online-Befragung, fällt die Wahl auf die kostenpflichtige Premium-Version des Tools «SurveyMonkey», eines der weltweit meist genutzten Systeme für webbasierte Umfragelösungen (SurveyMonkey, 2018). Das Programm ist äusserst variabel und bietet vielfältige, praktische Auswertungsmöglichkeiten. Zur weiteren Verarbeitung besteht eine Exportmöglichkeit in das Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel, mit welchem die Auswertung der Daten vorgenommen wurde. 4.7. Experteninterviews Ergänzend zur Online-Umfrage in den Spitälern, welche eine Innensicht abbildet, interessiert auch die persönliche Meinung von Branchenspezialisten, welche die Aussenwahrnehmung wiederspiegelt. Als qualitatives Instrument zur Erhebung dieser Daten, erscheinen dem Autor Experteninterviews als adäquat. Diese sind nicht über eine bestimmte methodische Form definiert (Witzel & Reiter, 2012 in Bogner, Littig, & Menz, 2014, S. 9), sondern vielmehr über den Gegenstand des effektiven Interesses: den Experten (Bogner, Littig, & Menz, 2014, S. 9). Verschiedene Definitionen beschreiben diesen als Person, welche über ein spezielles, nicht allen Menschen zugängliches Wissen über soziale Sachverhalte besitzt (Gläser & Laudel, 2010, S. 13). Gabler (2018b) versteht den Term Expertenwissen bzw. Expertise als «Kenntnisse und intellektuelle Fähigkeiten einzelner Personen, deren Leistung auf einem bestimmten Fachgebiet weit über dem Durchschnitt liegen. […]». 4.7.1. Leitfaden Aus der Theorie und den Studien werden spezifische Fragestellungen und besondere Aspekte aufgegriffen und daraus Kategorien gebildet, welche abgefragt werden sollen. Man spricht in diesem Falle von deduktiver Kategorienbildung (Mayring, 2015, S. 97ff). Darauf aufbauend wird ein flexibler, teilstandardisierter Interviewleitfaden (vgl. Kapitel 8.6.2.) konzipiert, welcher die 36 Fragen in übergeordnete Themenblöcke einteilt. Es wird ausschliesslich mit offenen Fragen gearbeitet, so dass die Befragten ihre subjektive Sichtweise darstellen können. Nach Atteslander (2010, S. 148) hilft dies dabei, Unwissenheit oder Missverständnisse zu entdecken. Weiter sieht er darin den Vorteil, dass sie dem Gesprächsklima zuträglich sind und das Interesse am Interview fördern, weil sie einem Alltagsgespräch nahekommen. Die Strukturierung der Fragen in Form eines Leitfadens bietet dem Interviewer zusätzlich eine Orientierungshilfe im Gesprächsverlauf und erleichtert andererseits die Vergleichbarkeit und Auswertung der Antworten (Berekoven, Eckert, & Ellenrieder, 2009, S. 250; Lamnek, 2005). 4.7.2. Auswahl der Interviewpartner Die Personengruppe, welche über umfangreiches Wissen zum Stand der Digitalisierung in Schweizer Spitälern verfügt, ist überschaubar klein. Parallel zur Literaturrecherche hat der Autor eine Liste mit Wunschkandidaten für die persönlichen Gespräche erstellt. Um eine möglichst heterogene Sichtweise zu gewährleisten, wird dem Background der Experten bei deren Auswahl ein besonderes Augenmerk gerichtet. Für die Interviews werden Personen gewählt, die in ihrer täglichen Arbeit mit verschiedenen Spitälern in Kontakt kommen und über eine mehrjährige Branchenerfahrung verfügen. Weitere wichtige Kriterien bei der Wahl der Gesprächspartner sind die unterschiedlichen Blickwinkel auf und ihr Interesse am Thema. Diese Kandidaten wurden vom Autor per E-Mail kontaktiert (vgl. Kapitel 8.6.1.), über das Forschungsvorhaben aufgeklärt und zur Teilnahme an den Interviews angefragt. Nachfolgend werden die vier Interviewpartner vorgestellt. Herr Raphael Frangi ist seit drei Jahren Senior Marketing Manager (Head of Marketing) bei der Swisscom Health AG. In dieser Funktion zeichnet er für die Marktbearbeitung der ambulanten und stationären Leistungserbringer verantwortlich. Sein Team beschäftigt sich hauptsächlich mit Beratungsaufgaben im administrativen, prozessualen und im digitalen Bereich (Frangi, 2018). Er ist tagtäglich im Austausch mit Kliniken und Spitälern und bringt eine umfassende Branchenkenntnis mit. Er ist zudem Dozent im Bereich Digital Marketing an verschiedenen Hochschulen und ein langjähriger Bekannter des Autors. Herr Prof. Dr. Alfred Angerer arbeitet seit neun Jahren an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur und leitet dort das Management im Gesundheitswesen. Das Institut berät Spitäler, Krankenversicherer und Pharmaunternehmen in betriebswirtschaftlichen Fragen. Seine drei Themenschwerpunkte im Geschäftsalltag sind «Prozessoptimierung Lean», «Marketing und Qualität im Gesundheitswesen» und neu «Digital Health» (Angerer, 2018). Herr Angerer bringt ein umfangreiches und fundiertes Fachwissen mit sich und war (Co-)Autor verschiedenster Studien, welche der Schreibende im Rahmen seiner Vorbereitung für die Master-Thesis gelesen hat. 37 Herr Yves Laukemann war bis vor einem Jahr Leiter Informatik im Basler St. Claraspital. Seitdem verantwortet er dort das Applikationsmanagement, welches zur neu geschaffenen Abteilung Innovations- und Technologiemanagement gehört. Das St. Claraspital hat sich schon vor einigen Jahren mit dem Thema Innovation und Digitalisierung auseinandergesetzt und hat den Bereich Informatik mitsamt Prozessen und digitalen Services bereits gut im Unternehmen verankert (Laukemann, 2018). Laukemann referierte bereits an diversen Fachkongressen innerhalb der Branche und setzt sich persönlich intensiv mit dem Thema eHealth auseinander. Herr Stefan Märke ist seit zwei Jahren «Consultant Lean Hospital» bei der Agentur Walkerproject AG. Er begleitet hauptsächlich prozessuale Transformationsprojekte im «Lean»-Bereich und auf Abteilungsebene in Spitälern. Seine Beratungstätigkeit umfasst strategische Problemstellungen wie die Angebotsplanung oder Zukunftsfragen wie z.B. wie ein Spital der Zukunft baulich umgesetzt werden kann (Märke, 2018). Die Agentur Walkerproject AG hat etliche Fachliteratur zum Thema «Lean Hospital» veröffentlicht, welche der Autor für die vorliegende Arbeit aufmerksam gelesen hat. 4.7.3. Auswertung der Interviews Die vier Interviews wurden zwischen dem 06. und 16. März 2018, jeweils persönlich und mündlich, am Arbeitsplatz der Befragten durchgeführt. Der Austausch gestaltete sich in allen Fällen sehr offen und angeregt, so dass die Gesprächsdauer zwischen 35 und 65 Minuten variierte. Die Befragungen wurden per Smartphone als Audio-Datei aufgezeichnet und in der Folge durch die Firma Transkripto.de professionell transkribiert. Die zurückgespielten Texte wurden vom Autor in eine besser lesbare Form gebracht und sind zur Nachlese als Vollversion im Anhang (Kapitel 8.6.3. bis 8.6.6.) zu finden. Die Inhaltsanalyse der Experteninterviews geschieht theoriegeleitet und erfolgt nach einer vorgegebenen Methodik. «Die Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument, das immer gleich aussieht; sie muss an den konkreten Gegenstand, das Material angepasst sein und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden. […] Das Kategoriensystem stellt das zentrale Instrument der Analyse dar. Auch sie ermöglichen das Nachvollziehen der Analyse, die Intersubjektivität des Vorgehens» (Mayring, 2015, S. 51). Das Ziel einer Inhaltsanalyse ist es, Material, welches durch Kommunikation entstanden ist, zu untersuchen und eine bestimmte Struktur daraus zu filtern (Mayring, 2015, S. 11 und S. 97). Das geschieht indem ein deduktiv gebildetes Kategoriensystem an das Textmaterial herangetragen wird und sämtliche Textstellen, welche auf eine Kategorie passen, systematisch extrahiert und subsumiert werden. Der Ablauf (Abbildung 7) sieht vor, dass zuerst Kategorien definiert, dann passende Ankerbeispiele gesucht und, wo nötig, Kodierregeln angewendet werden (Mayring, 2015, S. 97). 38 Abbildung 7: Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse Quelle: Gläser und Laudel (2010, S. 200) Auch die qualitative Analyse muss sich Gütekriterien stellen, wenn sie wissenschaftlichen Ansprüchen genügen will. Jedoch können die quantitativen Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität nicht direkt auf qualitative Forschungsmethoden übersetzt werden. Mayring (2015, S. 123 - 129) schlägt deshalb für qualitative Methoden andere Gütekriterien vor. Die Verfahrensdokumentation soll die Nachvollziehbarkeit garantieren, weshalb die Durchführung und Analyse sowie die Datenauswertung der Interviews im Anhang belegt wird. Die argumentative Interpretationsabsicherung besagt, dass Interpretationen am Material abgesichert werden, argumentativ begründet und in sich schlüssig sein müssen. Weiter wird Regelgeleitetheit erwartet, was heisst, dass die Analyseschritte im laufenden Forschungsprozess angepasst und verändert werden können. Die Nähe zum Gegenstand wird gewährleistet, indem die Forschung möglichst nahe am Alltag der Befragten anknüpft. Bei der kommunikativen Validierung soll die Gültigkeit der Ergebnisse schliesslich überprüft werden, indem die Kategorien und Codierungen im Forschungsteam besprochen werden. 39 «Wenn Sie einen Scheissprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiss digitalen Prozess.» (Dirks, 2015) 40 5. Auswertung der Ergebnisse In Kapitel fünf liegt der Fokus auf der Präsentation und Interpretation der Resultate aus der empirischen Untersuchung. Nach der Auswertung der Online-Umfrage erfolgt die Zusammenfassung der vier Experteninterviews. 5.1. Online-Umfrage Die Online-Umfrage war während drei Wochen, vom 07. bis zum 27. März 2018, unter dem Link https://de.surveymonkey.com/r/digitaler-reifegrad-spital aktiv. Um die relevanten Personen möglichst präzise zu erreichen, liess der Autor sein persönliches Netzwerk in der Spitalbranche spielen: via privater Nachrichtenfunktion von Social-MediaKanälen oder per E-Mail wurden potenzielle Zielpersonen direkt für die Teilnahme an der Umfrage angefragt. Unterstützung leistete auch der Branchenverband der Schweizer Spitäler H+, der die Leiter Human Resources der 30 grössten Schweizer Spitäler in seinem Namen direkt angeschrieben und zum Ausfüllen und internen Weiterleiten der Erhebung angehalten hat. Weiter wurden von den schweizweit 283 anerkannten Kliniken und Spitäler (Bfs, 2017b) sämtliche 216 Institute der Deutschschweiz per E-Mail via allgemeine Kontaktadresse angeschrieben (vgl. Kapitel 8.5.1.), mit der Aufforderung zur Weiterleitung an die relevanten und thematisch zuständigen Stellen. Dem Autor ist bewusst, dass hier mit qualitativen Abstrichen zu rechnen ist, da die Umfrage für alle Personen, welche über den Umfragelink verfügten, offen zugänglich war. 5.1.1. Teilnehmende Personen Total beteiligten sich 208 Personen an der Umfrage, wovon deren 144 (69 %) den Fragebogen bis zur letzten Frage vollständig ausgefüllt haben. Für die Auswertung werden sämtliche zurückgespielten Antworten berücksichtigt und genutzt. Die benötigte Stichprobengrösse von 334 Umfrageteilnehmer wurde damit klar verfehlt. Zu den Zielpersonen der Befragung gehörten Mitglieder der Geschäftsleitung oder des mittleren und höheren Kaders aus administrativen, nichtmedizinischen Bereichen von Schweizer Spitälern. Diese wurden relativ gut erreicht, wie die Verteilung der Teilnehmenden nach Abteilung und Position (Abbildung 8) zeigt. Insgesamt stammen 83 % der Antworten von Managementpersonen, wovon 24 % von Direktoren, oder zumindest Geschäftsleitungsmitgliedern, und 38 % von Bereichsleitern kommen. Weitere 21 % der Antwortenden gehören der Stufe Teamleiter an und lediglich 17 % der Antworten wurden von Personen ohne Führungsfunktion zurückgespielt. 41 Abbildung 8: Teilnehmende nach Abteilung und Position (n = 144) Am prominentesten sind bei der Umfrage die Bereiche Marketing & Kommunikation (25 %), IT & Projekte (23 %) und Administration (21 %) vertreten. Hinzu kommen 14 % Teilnehmende aus dem Bereich Unternehmensentwicklung und Innovation, 12 % aus der Personalabteilung und 5 % sind in med. Berufen tätig. Diese Verteilung lässt bereits darauf zurückschliessen, dass die Zuständigkeiten für digitale Themen und Anliegen von Spital zu Spital sehr unterschiedlich geregelt sind. 5.1.2. Teilnehmende Kliniken & Spitäler Die Abbildung 9 stellt die Verteilung der teilnehmenden Personen auf die verschiedenen Spitaltypen nach BAG (2017, S. 3) dar. Den grössten Teilnehmerkreis verzeichnen demzufolge die Privatkliniken (30), gefolgt von Zentrumsspitälern, (24), Kantonsspitälern (23) und Universitätsklinken (22). Aus Spezial- und Rehabilitationskliniken sowie aus Alters- & Pflegeheimen nahmen nur wenige Personen an der Umfrage teil. Die reinen Geburtshäuser (nicht zu verwechseln mit Geburtskliniken) sind überhaupt nicht in der Befragung vertreten. Das Thema Digitalisierung scheint für diese beiden Spitaltypen von geringer Relevanz zu sein. Aber auch sie tun gut daran, sich ernsthaft mit der digitalen Welt auseinanderzusetzen. Nur weil deren Patienten nicht oder womöglich nur reduziert über digitale Kanäle erreichbar sind, bedeutet das nicht automatisch, dass die Digitalisierung nicht auch ihnen interessante Möglichkeiten bietet. Vor allem hinsichtlich Steigerung der Effizienz und Qualität oder bei der Prozessoptimierung, besteht genügend Verbesserungspotenzial. Es existiert keine Aufschlüsselung der offiziell in der Administration tätigen Personen auf die unterschiedlichen Spitaltypen, was die Einordnung der Teilnehmerinformationen erschwert. In Anbetracht der Gesamtmitarbeiterzahl der einzelnen Spitaltypen, ist jedoch davon auszugehen, 42 dass diese Verteilung nicht ganz der Realität entspricht. Die Zentrums- und Kantonsspitäler, wie auch die Psychiatriekliniken, scheinen in der Erhebung leicht übervertreten, während die Universitätsspitäler und Rehakliniken eher untervertreten sind. Begründet wird dies unter anderem damit, dass bei der anonymen Umfrage kaum oder nur wenige Angestellte der beiden grossen Universitätsspitäler in Lausanne und Genf, mitgemacht haben. Dieser Beweis kann nicht endgültig erbracht werden, da die Teilnehmenden bei der Umfrage nur den Spitaltyp, nicht aber den Namen ihres Arbeitgebers, angeben mussten. Abbildung 9: Teilnehmende nach Spitaltyp (n = 144) Privatklinik 30 Zentrumsspital 24 Kantonsspital 23 Universitätsspital 22 Andere Kategorie 18 Psychiatrie 12 Spezialklinik 9 Rehabilitation Alters- & Pflegeheim 4 2 Abbildung 10 zeigt auf, dass 56 % der Befragten einzelnen Kliniken oder Spitälern zugehörig sind und dass 44 % mit ihrem Arbeitgeber einer Spitalgruppe oder einem Spitalnetzwerk angeschlossen sind. Der Trend hin zu Kooperationen und regionalen Zusammenschlüssen ist im Schweizer Spitalwesen seit längerem zu beobachten, was diese praktisch ausgeglichenen Teilnehmerzahlen unterstreichen. Abbildung 10: Zugehörigkeit zu Spitalgruppe/Spitalnetz (n = 144) Nein Ja 80 64 43 Abbildung 11 illustriert die Teilnehmer nach Spitalgrössen. Aus den kleinen Instituten mit bis zu 200 Mitarbeitenden nahmen 16 % teil, während nur 8 % der Befragten aus Kliniken mit 201 bis 500 Angestellten stammen. Spitäler mit 501 bis 1 000 Personaleinheiten sind mit 18 % vertreten und solche mit 1 001 bis 2 000 Beschäftigten durch 19 %. Weiter arbeiten rund 15 % der Antwortenden bei Unternehmen mit 2 001 bis 5 000 Angestellten und mit 24 % verzeichnen die Grossspitäler ab 5 000 Mitarbeitenden die höchste Teilnehmerquote. Abbildung 11: Teilnehmende nach Spitalgrösse (n = 144) Verglichen mit den offiziellen Zahlen des Bfs (2017a) zur Anzahl Spitäler pro Spitalgrösse, ist eine anteilsmässig frappante Untervertretung der kleineren Spitäler festzustellen. Unternehmen mit mehr als 1 001 Mitarbeitenden sind dagegen stark übervertreten. Erklärt wird dies damit, dass die Schweizer Spitallandschaft geprägt ist von vielen kleineren Organisationen mit wenig Mitarbeitenden und einer geringen Anzahl an Grossen mit dafür sehr vielen Angestellten. Folglich ist es gerade in grösseren Kliniken zu Mehrfachantworten gekommen, während in kleineren Instituten höchstwahrscheinlich nicht allzu viele Personen die Fragen beantworten konnten. Dem entgegengewirkt hätte nur eine Einschränkung auf maximal eine Antwort pro Klinik, was wiederum der Repräsentativität geschadet hätte. Indes gestaltete sich auch die Kontaktaufnahme mit den Zielpersonen bei kleineren Spitälern um einiges herausfordernder, als bei Grossunternehmen. 5.1.3. Relevanz der Digitalisierung in der Spitalbranche Das Thema Digitalisierung ist für das Spitalwesen von enormer Wichtigkeit, darüber sind sich, wie Abbildung 13 deutlich macht, eindrückliche 88 % der Antwortenden einig. Berücksichtigt man auch die Antwortoption «eher wichtig», dann erachten sogar 98 % der Befragten den digitalen 44 Wandel als Trend, welchem sich die Branche unausweichlich zu stellen hat. Nur gerade 2 % schätzen die Thematik als eher unwichtig ein und nicht einmal 1 % fand darauf keine Antwort. Abbildung 12: Relevanz der Digitalisierung in der Spitalbranche (n = 208) In den letzten Monaten hat die mediale Berichterstattung über Digitalisierungsthemen markant zugenommen und auch in der Gesundheitsbranche finden immer mehr Events zu digitalen Themen statt. Die Mitarbeitenden in den Spitälern scheinen dadurch ein Bewusstsein für die Möglichkeiten, welche der digitale Wandel mit sich bringt, entwickelt und die Wichtigkeit sich mit dessen Chancen und Herausforderungen auseinanderzusetzen, verstanden zu haben. Trotzdem war vorab nicht zu erwarten, dass das Resultat bei dieser Frage derart eindeutig ausfällt. Anhand der Antworten waren überdies keine erkennbaren Unterschiede zwischen den Spitalgrössen oder -typen auszumachen. 5.1.4. Relevanz der Digitalisierung im Unternehmen Angesprochen auf die Wichtigkeit der Digitalisierung bei ihrem eigenen Arbeitgeber, zeigt sich in Abbildung 13, dass das Thema zwar in vielen Unternehmen auf dem Radar erscheint, jedoch längst nicht überall strategische Relevanz geniesst. Gut ein Drittel der Antwortenden ist der Ansicht, dass ihr Spital digitale Themen als sehr wichtig erachtet, wo hingegen eine Mehrheit von 51 % Digitalisierung in ihrem Unternehmen als «eher wichtig» einstuft. Immerhin 11 % geben an, dass ihre Organisation dem digitalen Wandel eine «eher unwichtige» Bedeutung beimisst. Nur ein kleiner Anteil von 2 % konnte bei dieser Frage keine Einschätzung abgeben. Zwischen der Relevanz der Digitalisierung für die gesamte Branche und der Wichtigkeit des Themas im eigenen Unternehmen ist somit eine deutliche Lücke festzustellen. Viele Spitäler scheinen sich damit schwer zu tun, sich auf digitale Herausforderungen einzulassen und diese aktiv anzugehen, obwohl sie die thematische Dringlichkeit absolut erkennen. 45 Abbildung 13: Relevanz der Digitalisierung im Unternehmen (n = 208) Die Folgefrage lautete, wie sich diese Relevanz in den nächsten 2 Jahren unternehmensintern verändern wird. Auch hier fällt das Verdikt eindeutig aus, wie Abbildung 13 darlegt. Beeindruckende 85 % der Teilnehmer schätzen, dass das Thema Digitalisierung in naher Zukunft bei ihrem Arbeitgeber deutlich wichtiger wird. Immerhin 13 % denken, dass die Wichtigkeit zumindest gleichbleibt und nur 2 % sind der Meinung, dass diese in naher Zukunft eher abnimmt. Eine tiefergehende Analyse der Rückmeldungen mit den Kriterien Unternehmensgrösse oder Spitaltyp liess keine auffälligen Muster erkennen. 5.1.5. Vorhandensein einer Digitalstrategie Bei der nächsten Fragestellung (Abbildung 14), interessiert das Bestehen einer formulierten Digitalstrategie. Praktisch jeder Fünfte konnte diese Frage nicht beantworten, was darauf hindeutet, dass nicht überall transparent über das Thema kommuniziert wird. Daher besteht bei vielen Mitarbeitenden eine Unkenntnis oder Unsicherheit, ob Digitalisierung in ihrem Unternehmen einer klaren Vorgehensweise folgt. Eine Mehrzahl von 55 % verneint die Existenz einer digitalen Strategie und nur etwas mehr als ein Viertel bestätigt, dass ihr Arbeitgeber über einen entsprechenden Plan verfügt und das Vorgehen strukturiert erfolgt. Je grösser das Spital, desto wahrscheinlicher ist das Vorhandensein einer Digitalstrategie. Angesichts der geschätzten Relevanz, welche die Umfrageteilnehmer der Digitalisierung zusprechen und unter Berücksichtigung der steigenden Wichtigkeit des Themas in den kommenden Jahren, erstaunen diese Resultate. Sie zeigen auf, dass die Spitalbranche anderen Branchen ziemlich hinterherhinkt und dass vorab noch ein gewisses Mass an strategischer Grundlagenarbeit erfolgen muss, bevor sich die Spitäler koordiniert und zielgerichtet an die Digitalisierungsthemen heranwagen können. 46 Abbildung 14: Vorhandensein einer Digitalstrategie (n = 208) 5.1.6. Zuständigkeit für das Thema Digitalisierung Auf die Frage, wer in ihren Organisationen für Digitalisierungsthemen zuständig ist, konzentrieren sich die Antworten auf zwei Bereiche, wie auf Abbildung 15 zu sehen ist. Hier gibt es bei den Spitalgrössen geringe Unterschiede: in kleinen Spitäler ist vor allem die IT, in den Spitälern mit mehr als 1 001 Mitarbeitenden, tendenziell eher die Geschäftsleitung für digitale Angelegenheiten im Lead. Abbildung 15: Zuständigkeit für die Digitalisierung (n = 208) 47 Die Verantwortung für digitale Angelegenheiten ist mit 42 % am häufigsten bei den Abteilungen IT & Projekte aufgehängt. Bei 31 % der Befragten kümmert sich die Geschäftsleitung persönlich um digitale Fragestellungen und bei 9 % fallen diese in den Zuständigkeitsbereich der Unternehmensentwicklung. Interessanterweise konnten 9 % dazu gar keine Angabe machen bzw. wussten anscheinend nicht, wer in ihrem Unternehmen für die Digitalisierung verantwortlich ist. Eher selten liegt die Verantwortung bei Marketing & Kommunikation (5 %) oder bei einer Innovationsabteilung (2 %). Die vom Bund gesetzlich verordnete Einführung des elektronischen Patientendossiers hat auf diese Resultate mit hoher Wahrscheinlichkeit einen erheblichen Einfluss, denn es handelt sich um ein stark technologiegetriebenes Projekt, welches sich in seiner ersten Phase hauptsächlich um die Entwicklung und Anbindung von IT-Schnittstellen und -Systemen dreht. Die etwas gar ITlastigen Antworten erscheinen daher als logisch. 5.1.7. Dimension «Patientenerlebnis» Die Umfrageresultate (Abbildung 16) zeigen auf, dass Spitäler in diesem Themenbereich höchstens ihre Pflicht erfüllen. Drei Viertel der Befragten geben an, dass in ihrem Unternehmen mobil- und suchmaschinenoptimierte Websites in Betrieb sind. Auch die aktive Präsenz auf Social Media hat sich bei über der Hälfte der Teilnehmenden etabliert. Am meisten Potenzial zeigt sich bei der Nutzung von Mobile Apps im Patientendialog. Lediglich 11 % bestätigen den Einsatz einer entsprechenden Lösung, wo hingegen bei 79 % das Thema App noch keine Relevanz zu haben scheint. Auch beim Angebot von digitalen Services und der Verknüpfung von Interaktions- mit Kundendaten besteht Nachholbedarf. Nur knapp ein Drittel der Spitäler nutzt Informationen aus CRM-Systemen für Marketing- und Kommunikationszwecke. Bei 43 % der Antwortenden findet die Interaktion mit Patienten on- und offline statt. Immerhin geben 46 % an, dass bereits eine personalisierte Kommunikation stattfindet. 48 Abbildung 16: Dimension «Patientenerlebnis» (n = 187) Mobil- und suchmaschinenoptimierte Website 3%4% Kundenkommunikation via Social Media 3% Kundenkommunikation via Mobile App 5% Kundenerlebnis auf On- und Offlinekanälen 17% 36% 14% 10% 40% 29% 20% 63% 14% 33% 16% 37% 5% 33% 11% 6% Interaktionen mit Patienten über On- und Offlinekanäle 6% 12% 39% 30% 13% Personalisierte Kommunikation 7% 10% 37% 35% 11% Anbieten digitaler Services 5% Nutzung von CRM-System 10% Nutzung der CRM-Daten für Marketing- und Kommunikation 9% keine Angabe/weiss nicht trifft gar nicht zu 24% 25% 22% trifft wenig zu 48% 32% 36% 18% 22% 27% trifft überwiegend zu 4% 12% 5% trifft völlig zu Bei jeder der neun untersuchten Dimensionen können pro Frage zwischen 1,00 («keine Angabe/weiss nicht») bis 5,00 («trifft völlig zu») Punkte erreicht werden. Der Reifegrad pro Dimension ergibt sich, indem der jeweilige Mittelwert errechnet wird. Insgesamt erlangen die Spitäler in der Dimension «Patientenerlebnis» eine Reife von 3,21 Punkten. Mit einem Gesamtwert von 3,60 dominieren die Privatkliniken gleich in mehreren Bereichen: sie glänzen beim Einsatz von modernen Kommunikationskanälen sowie bei der Nutzung von CRM-Systemen für ihre Marketingaktivitäten. Universitätsspitäler hingegen sind bezüglich des Angebots von digitalen Services am fortgeschrittensten. Die Psychiatriekliniken liegen dafür in Sachen personalisierter Kommunikation in Front (3,42). Die tiefste Reife erlangen die Alters- und Pflegeheime mit einem Total von 2,61. Die Grösse der Spitäler hat hier durchaus Einfluss auf die Resultate, die Institute mit > 5 000 Mitarbeitenden erreichen mit 3,43 die höchste Punktzahl, während Spitäler mit 201 bis 500 Angestellten mit 3,06 Punkte den tiefsten Wert erzielen. Patientenerlebnis = 3,21 Punkte 49 5.1.8. Dimension «Produktinnovation» Bei der «Produktinnovation» zeigt sich bei allen Fragen ein ähnliches Muster (Abbildung 17). Die meisten Aussagen treffen in den Kliniken und Spitälern nur wenig bis gar nicht zu. Nur gerade bei 3 % ergänzen digitale Produkte bereits das bestehende Angebot. Berücksichtigt man auch die Antwortmöglichkeit «trifft überwiegend zu» sind es immerhin schon 28 %. Bei der grossen Mehrheit von 60 % ist dies aber noch wenig der Fall. Neue, digitale Geschäftsideen oder -modelle sind bei maximal 30 % der Befragten entstanden. Immerhin arbeiten 37 % an der Schaffung von innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen. Auch hinsichtlich des Innovationsprozesses besteht Handlungsbedarf: 62 % geben an, dass es keinen oder kaum einen solchen gibt. Die Zielgruppe wird bei 31 % der Teilnehmenden aktiv in den Innovationsprozess miteingebunden und eine systematische Befragung zur Optimierung von digitalen Angeboten findet bei höchstens 28 % statt. Abbildung 17: Dimension «Produktinnovation» (n = 174) Digitale Innovationen ergänzen Produkte und Dienstleistungen 5% 8% Erfolgreiche Umsetzung von neuen digitalen Geschäftsideen oder Geschäftsmodelle 5% Schaffung von Rahmenbedingungen für digitale Innovation 7% 17% Klar definierter Innovationsprozess 6% 23% Aktive Einbindung der Zielgruppen in digitale Innovationen 6% 28% 36% 26% 5% Systematische Befragung der Zielgruppen zur Verbesserung der digitalen Angebote 6% 25% 40% 21% 7% keine Angabe/weiss nicht trifft gar nicht zu 60% 16% 25% 49% trifft wenig zu 24% 39% 28% 39% 25% trifft überwiegend zu 3% 6% 9% 7% trifft völlig zu Der Mittelwert der Spitäler kommt bei der «Produktinnovation» auf 3,05 zu liegen. Die Kantonsspitäler schneiden mit einem durchschnittlichen Reifegrad von 3,28 Punkten am besten ab. Punkto Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für digitale Innovation erreichen die Psychiatriekliniken den Höchstwert (3,42). In einigen wenigen Alters- und Pflegeheimen scheinen sich durch digitale Technologien oder Anwendungen schon neue Geschäftsideen zu entwickeln, was den Höchstwert von 3,50 in dieser Kategorie erklärt. Im Schnitt am wenigsten Punkte erzielen trotzdem die Alters- und Pflegeheime (2,67). 50 Pauschal ist zu beobachten, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Spitaltypen nur geringfügig sind. Spitäler ab 1 000 Mitarbeitenden erreichen zwar die leicht höheren Reifegrade als kleinere Spitäler, die Differenz liegt aber jeweils nur bei maximal 0,35 Punkten. Produktinnovation = 3,05 Punkte 5.1.9. Dimension «Digitalstrategie» Wie Abbildung 18 illustriert, sind nur gerade 10 % der Teilnehmer der Meinung, dass die digitale Strategie einen zentralen Stellenwert in ihrem Unternehmen geniesst und dementsprechend gut verankert ist. Mit 57 % geben mehr als die Hälfte an, dass dies wenig oder gar nicht zutrifft und die Digitalisierung bei ihrem Arbeitgeber keinem strategischen Plan folgt. Zwar wird sie bei zwei Dritteln der Befragten als kontinuierliche strategische Weiterentwicklung verstanden, trotzdem geniessen digitale Projekte nur bei 44 % eine hohe Priorität. Knapp drei Viertel der Spitäler geben an, in der Branche nicht oder kaum als Treiber von digitalen Innovationen wahrgenommen zu werden. Nur 3 % sind überzeugt, dass diese Aussage völlig auf sie zutrifft und bei 14 % stimmt die Aussage überwiegend. Trotzdem findet bereits bei 35 % eine systematische Evaluation von neuen Technologien oder Veränderungen im Kundenverhalten für digitale Innovationen statt. Abbildung 18: Dimension «Digitalstrategie» (n = 168) Zentraler Stellenwert von "Digital Business" in Gesamtstrategie Bewusstsein über Kernkompetenzen für Geschäftserfolg in der digitalen Zukunft 4% 18% 39% 4% 11% 33% Hohe Priorität von digitalen Projekte und Innovationen 3% 14% Digitalisierung als kontinuierliche strategische 2%10% Weiterentwicklung Wahrnehmung als Treiber von digitalen Innovationen in der Branche 10% Systematische Evaluation von neuen Technologien und Veränderungen im Kundenverhalten für digitale Innovation 7% keine Angabe/weiss nicht trifft gar nicht zu 30% 40% 39% trifft wenig zu 11% 48% 33% 23% 12% 33% 24% 16% 40% 36% trifft überwiegend zu 10% 14% 4% 32% 3% trifft völlig zu 51 In der Dimension «Digitalstrategie» erreicht die digitale Reife einen Durchschnittswert von 3,23. Sowohl die Kantons- wie auch die Universitätsspitäler erreichen mit 3,45 den höchsten Punktewert, die Alters- und Pflegeheime kommen bei einem Tiefstwert von 2,67 zu stehen. Betrachtet man die Ergebnisse nach Unternehmensgrösse, so ist festzustellen, dass diese offenbar ausschlaggebend für die Existenz einer digitalen Strategie ist. Die Unterschiede sind durchaus nennenswert, denn kleine Spitäler mit weniger als 200 Angestellten erreichen lediglich 2,99 Punkte, wo hingegen Häuser mit mehr als 5 000 Lohnbezügern eine Reife von 3,41 Punkte erlangen. Digitalstrategie = 3,23 Punkte 5.1.10. Dimension «Organisation» Bei der Analyse der Art und Weise wie digital die Spitäler organisiert sind, kommen interessante Erkenntnisse zu Tage, wie Abbildung 19 deutlich macht. So geben 55 % der Umfrageteilnehmer an, dass ihre Organisation grösstenteils durch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege gekennzeichnet ist. Bei knapp zwei Dritteln werden digitale Projekte interdisziplinär angegangen und umgesetzt. Wenn es um das Monitoring von Trends geht oder um die schnelle Reaktion auf Veränderungen im Markt, so zeigt sich hingegen die Trägheit vieler Organisationen. Nur 14 % sind der Ansicht, dass ein Trend-Monitoring zur Identifikation von neuen Technologien und Businessopportunitäten mehrheitlich sichergestellt ist. Und nur gut jedes vierte Spital hält sich für agil genug, um angemessen auf Trends im Technologie- oder Marktumfeld zu reagieren. Auch die Bereitstellung von genügend Ressourcen für digitale Innovationen im Tagesgeschäft bewerten 75 % als wenig bis gar nicht zutreffend. Ein echtes digitales Ökosystem, mit Start-UpPartnerschaften oder Kooperationen im universitären Umfeld, existiert nur bei einer Minderheit von 17 %. Knapp 70 % sind der Auffassung, dass in ihrem Spital selten oder überhaupt keine solche Zusammenarbeit besteht. 52 Abbildung 19: Dimension «Organisation» (n = 165) Organisation ist gekennzeichnet durch flache 2% Hierarchien und kurze Entscheidungswege Digitale Projekte werden abteilungs- und funktionsübergreifend geplant und umgesetzt 18% 24% 4% 8% 23% Systematisches Trend-Monitoring zur Identifikation von neuen Technologien oder Geschäftsmodellen 9% 33% Schnelle Raktion auf Veränderungen im Technologieoder Marktumfeld 5% 19% Bereitstellung von genügend Ressourcen für digitale Innovation im normalen Geschäftsbetrieb 2% 28% Pflege eines digitalen Netzwerks mit externen Partnern (Agenturen, Start-Ups, Universitäten/ ETH) keine Angabe/weiss nicht 15% trifft gar nicht zu trifft wenig zu 36% 19% 48% 17% 43% 50% 47% 36% 13% 1% 22% 4% 21% 2% 33% trifft überwiegend zu 13% 4% trifft völlig zu Im Schnitt liegt der Reifegrad in der Dimension «Organisation» bei 3,04 Punkten. Mit 3,24 erreichen die Kantonsspitäler die höchste Punktzahl und die Alters- und Pflegeheime mit 2,67 den niedrigsten Wert. In Bezug auf ihr digitales Netzwerk müssen sich die Kantonsspitäler von den Universitätskliniken, welche dort 3,27 Punkte erzielen, geschlagen geben. Dass diese häufiger mit Universitäten oder mit Start-Ups kooperieren, ist nachvollziehbar und kann z.B. mit dem grossen Netzwerk dieser Institute sowie mit dem Forschungs- und Ausbildungsauftrag, welchen sie zu erfüllen haben, begründet werden. Interessant ist, dass die Spitäler mit einer Grösse von bis 200, bzw. mit 201 - 500 Mitarbeitenden je die höchste Punktzahl (3,21) ausweisen, die grossen Kliniken mit mehr als 5 000 Angestellten kommen dagegen nicht über 2,91 Punkte hinaus. Je kleiner die Spitäler, desto flacher und übersichtlicher ist die Organisation, was sich bei dieser Frage im sehr hohen Score (4,26) der kleinsten Spitäler, gegenüber den Grössten (3,06) deutlich macht. Organisation = 3,04 Punkte 5.1.11. Dimension «Prozessdigitalisierung» 40 % der Befragten bestätigen die mehrheitliche bis ganze Integration von digitalen Kanälen im Bereich Kommunikation und Service. Bei 57 % findet diese nur schwach oder überhaupt nicht statt. Knapp ein Drittel gibt an, dass keine periodische Zielüberprüfung der digitalen Kanäle stattfindet wo hingegen dieser Fakt nur bei 5 % voll und ganz zutrifft. Die Kernprozesse werden 53 bei 17 % gar nicht oder bei 42 % nur unregelmässig auf ihr digitales Verbesserungspotenzial geprüft, wie Abbildung 20 verdeutlicht. Die Mehrheit sagt aus, dass die digitalen Möglichkeiten in ihrem Spital kaum (45 %) oder gar nicht (19 %) ausgeschöpft werden, um Routineprozesse zu automatisieren. 17 % geben an, dass Big Data-Technologien nicht als Grundlage zur Entscheidungsfindung genutzt werden, bei 38 % trifft diese Aussage wenig zu und lediglich 6 % bestätigen, dass dies völlig zutrifft. Aktuell werden die Fähigkeiten im Bereich Datenanalyse nur bei 3 % zur Entwicklung von neuen Services genutzt. Abbildung 20: Dimension «Prozessdigitalisierung» (n = 154) Integration digitaler Kanäle im Kommunikations- und 3% 10% Serviceprozess 47% Regelmässige Überprüfung der Qualitätsmerkmale und Ziele für digitale Kanäle 9% Regelmässige Überprüfung der Kernprozesse auf Verbesserungspotenzial durch digitale Technologien 5% 17% Digitale Möglichkeiten werden ausgeschöpft um Routineprozesse zu automatisieren 5% 19% Nutzung von Erkenntnissen aus der Datenanalyse als Grundlage für Entscheidungen (Big Data & Analytics) 6% 17% Aktive Nutzung der Expertise im Bereich der Datenanalyse zur Entwicklung von Services etc. 8% keine Angabe/weiss nicht trifft gar nicht zu 34% 27% 36% 42% 23% trifft wenig zu 6% 24% 31% 45% 38% 28% 32% 42% trifft überwiegend zu 5% 5% 3% 6% 24% 3% trifft völlig zu Der Mittelwert der Dimension «Prozessdigitalisierung» erreicht 3,06 Punkte. Hier stehen die Privatkliniken an vorderster Stelle mit einem Wert von 3,33, gefolgt von den Kantonsspitälern (3,17) und weit vor dem Schlusslicht, den Alters- und Pflegeheimen (2,58). Es zeigt sich, dass die Grösse der Organisation eine direkte, wenn auch nur geringe, Auswirkung auf die Reife in diesem Themenfeld hat. Spitäler mit > 5 000 Arbeitnehmern erreichen mit 3,20 Punkten die höchste und jene mit 201 - 500 Angestellten mit 2,94 die tiefste Punktzahl. Prozessdigitalisierung = 3,06 Punkte 54 5.1.12. Dimension «Zusammenarbeit» Abbildung 21 macht klar, dass Kollaborationsplattformen nur bei jedem zehnten Spital im Einsatz sind und bei 19 % gar nicht. Bei gut einem Drittel (34 %) trifft dieser Umstand kaum zu und nur knapp ein Drittel nutzt diese Art von Tools überwiegend bei der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit. Etwas dramatischer sieht es beim Wissensmanagement und dem strukturierten Teilen von Knowhow aus. 26 % geben an, dass Wissen gar nicht geteilt wird und bei 46 % der Spitäler trifft dies nur selten zu. Um in den einzelnen Unternehmen nachhaltig digitales Wissen aufzubauen, findet nur bei knapp jedem dritten Spital ein organisierter Austausch mit externen Experten statt. Bei der Mehrheit der Befragten trifft dies überhaupt nicht (17 %) oder nur ausnahmsweise (38 %) zu. In den einzelnen Spitälern existieren nur gerade bei jedem zehnten Spital interne Anlaufstellen für digitale Fragestellungen. Je 30 % vermelden, dass dies überwiegend oder wenig zutrifft und in fast jedem vierten Spital gibt es keine Ansprechpersonen für derartige Anliegen. Bezüglich des Einsatzes von neuen Arbeitsformen fallen die Resultate eindeutig aus. In 8 von 10 Spitälern bestehen keine (35 %) oder nur selten (46 %) entsprechende Möglichkeiten. Nur jedes zehnte Spital kennt flexible Arbeitsweisen und setzt diese gezielt zur Förderung der Kreativität und zum Austausch unter den Mitarbeitenden ein. Abbildung 21: Dimension «Zusammenarbeit» (n = 151) Nutzung von digitalen Kollaborationsplattformen für bereichsübergreifende Zusammenarbeit 5% 19% Mitarbeitenden teilen Wissen proaktiv und strukturiert in digitalen Kollaborationsplattformen 4% 26% Austausch mit externen Experten zur Entwicklung von zusätzlichem Wissen auf dem Gebiet der Digitalisierung 9% 17% 38% Definition einer Anlaufstelle für digitale Fragen von Mitarbeitenden oder Externen 6% 23% 30% Einsatz neuer Arbeitsformen zur Förderung von Kreativität und Austausch zw. Mitarbeitenden 4% keine Angabe/weiss nicht trifft gar nicht zu 35% trifft wenig zu 34% 32% 46% 10% 23% 31% 30% 46% trifft überwiegend zu 1% 6% 11% 11% 4% trifft völlig zu Im Durchschnitt liegt der Reifegrad der Spitäler hier bei 3,03 Punkten. Die höchste Punktzahl erreichen in dieser Dimension die Kantonsspitäler (3,24), die tiefsten Werte erzielen die Rehakliniken sowie die Alters- und Pflegeheime mit 2,70 Punkten. Auch hier sind es die grösseren 55 Spitäler, welche mit eine Reife von 3,17 deutlich höhere Werte erzielen als beispielsweise Spitäler mit 201 bis 500 Mitarbeitenden (2,73). Tendenziell gilt auch bei der Zusammenarbeit, dass der Reifegrad proportional zur Grösse der Spitäler zunimmt. Zusammenarbeit = 3,03 Punkte 5.1.13. Dimension «Informatik & Technologie (ICT)» Eher weniger verbreitet sind in den IT-Abteilungen der befragten Spitäler agile Projektmethoden zum Testen und Modifizieren von digitalen Produkten und Services, wie Abbildung 22 verbildlicht. Nur 4 % geben an, dass der Einsatz solcher Methoden in ihren Betrieben voll und ganz zutrifft – bei 13 % trifft dieser Fakt überwiegend zu. Schwer tun sich die Unternehmen auch bei der schnellen Anbindung von Systemen an bestehende oder neue digitalen Services. Mehr als zwei Drittel (67 %) gaben zu Protokoll, dass dies gar nicht oder kaum zutrifft. Deutlich besser sehen die Resultate bei der Aktualisierung der IT-Infrastruktur aus. Hier geben 17 % an, dass diese regelmässig an neue Bedürfnisse angepasst wird und weitere 48 % sind der Ansicht, dass dies überwiegend stimmt. Der Einsatz von digitalen Technologien wird bei 13 % völlig und bei 47 % weitestgehend sichergestellt. Auffallend ist die hohe Zustimmung bei der Bekanntheit von ITSicherheitsrichtlinien. Bei gut einem Fünftel werden diese Regeln aktiv im Unternehmen kommuniziert und periodisch überprüft. Bei 40 % der Spitäler trifft dies überwiegend zu und nur bei 3 % ist das gar nicht der Fall. Auch den Massnahmen zur Sicherstellung des IT-Betriebs und der Verfügbarkeit der Daten wird offenbar eine hohe Priorität beigemessen. 24 % der Teilnehmenden bestätigen, dass dies völlig zutrifft und 40 % geben an, dass dies eher zutrifft. Beim Thema Datenschutz wird bei 37 % der Organisationen überwiegend proaktiv über die Speicherung und Nutzung von persönlichen Daten informiert, in jedem zehnten Spital trifft diese Aussage sogar völlig zu. Andererseits trifft dieser Umstand bei 32 % kaum und bei weiteren 10 % gar nicht zu. 56 Abbildung 22: Dimension «Informatik & Technologie (ICT)» (n = 149) Testen und Modifizieren von digitale Produkten und Services mittels agilen Projektmethoden 7% Rasche Anbindung von Systemen an neue eigene oder fremde Angebote dank offener Schnittstellen 6% Regelmässige Aktualisierung der IT-Infrastruktur an neue Anforderungen 5%4% IT stellt Einsatz relevanter digitalen Technologien im Unternehmen sicher 6% 6% Verhaltensregeln zur IT Security sind bekannt und Einhaltung wird regelmässig überprüft 7%3% 30% 23% 10% 10% trifft wenig zu 13% 40% 15% 28% 42% 32% 3% 17% 47% 22% Proaktive Information gegenüber Kunden zur Speicherung und -nutzung von persönlichen Daten trifft gar nicht zu 48% 28% 15% 3% keine Angabe/weiss nicht 23% 44% 26% Massnahmen zur Sicherstellung des ITBetriebs/Verfügbarkeit der Daten sind geplant und getest 13% 4% 46% 24% 37% trifft überwiegend zu 11% trifft völlig zu Der Mittelwert der Spitalbranche kommt hier bei 3,36 Punkten zu stehen. Die Kantonsspitäler liegen mit 3,67 deutlich über diesem Schnitt, die Alters- und Pflegeheime mit 3,00 klar darunter. Diese erreichen zwar in Sachen IT-Agilität, Offenheit der Systeme und Schnittstellen sowie bei der Sicherstellung des Einsatzes von relevanten Technologien jeweils Bestwerte, vernachlässigen aber bislang offenbar eher IT-Sicherheitsthemen und den Datenschutz. Im IT-Bereich hat die Spitalgrösse eher einen negativen Einfluss auf die digitale Reife. Spitäler mit 1 001 - 2 000 Mitarbeitenden sind mit 3,53 Punkten am reifsten, die Grossspitäler mit mehr als 5 000 Angestellten schneiden mit einem Wert von 3,27 am schlechtesten ab. Auffällig ist, dass vor allem rund um die Themen IT-Security und Datenschutz der Grossteil der Unternehmen hohe bis sehr hohe Punktezahlen erzielt. Informatik & Technologie (ICT) = 3,36 Punkte 5.1.14. Dimension «Digitale Unternehmenskultur» Auf Abbildung 23 ist zu sehen, dass fast bei der Hälfte der befragten Unternehmen das digitale Knowhow nur eine kleine Rolle bei der Entwicklung der Mitarbeitenden spielt, bei weiteren 22 % sogar überhaupt keine. Nur in jedem fünften Spital geniesst digitales Wissen eine gewisse Relevanz. Funktionsbezogene, digitale Fähigkeiten sind bei einem Viertel der Spitäler ein 57 Auswahlkriterium bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden. Die eigenen digitalen Services kennen zwar 51 % der Spitalangestellten mehrheitlich, aber 38 % geben an, dass dies für ihre Organisation eher nicht zutrifft. In jedem vierten Unternehmen sind die Führungskräfte eher nicht und in jedem fünften Spital gar nicht bereit, durch den Einsatz von digitalen Lösungen Risiken für ihr Unternehmen einzugehen. Das hat zur Folge, dass fast bei der Hälfte die Führungskräfte digitale Initiativen kaum oder gar nicht fördern, wenn sie gewisse Investitionsrisiken mit sich bringen. Auch das Leben einer offenen Fehlerkultur hat vielerorts noch Entwicklungspotenzial. In jedem vierten Spital werden Fehler kommuniziert und ausgewertet, um digitale Prozesse und Lösungen zu fördern und zu verbessern. Für einen Drittel der Antwortenden trifft dies selten und für fast einen Fünftel gar nicht zu. Abbildung 23: Dimension «Digitale Unternehmenskultur» (n = 147) Aufbau von digitaler Expertise ist eine zentrale Komponente in der Mitarbeiterentwicklung 5% Funktionsbezogene digitale Fähigkeiten sind wichtiges Auswahlkriterium bei der Rekrutierung 12% Mitarbeitenden kennen die eigenen digitalen Angebote & Services 4%3% Führungskräfte sind bereit, durch Einsatz von digitalen Lösungen Risiken für das Geschäft einzugehen 8% Führungskräfte fördern trotz Investitionsrisiken die Entwicklung von digitalen Lösungen 7% Gemachte Fehler werden kommuniziert und ausgewertet um digitale Prozesse und Lösungen zu verbessern 7% keine Angabe/weiss nicht trifft gar nicht zu 22% 18% 48% 20% 5% 44% 21% 5% 38% 51% 20% 14% 17% trifft wenig zu 3% 42% 44% 33% 22% 29% 37% trifft überwiegend zu 7% 7% 6% trifft völlig zu Beim Themenfeld «digitale Unternehmenskultur» liegt der Durchschnittswert aller Spitäler bei 3,10 Punkten. Die Psychiatriekliniken erreichen in dieser Dimension die besten Werte (3,35) und die Zentrumsspitäler mit 2,92 die niedrigste Punktzahl. Bemerkenswert ist, dass hier die Psychiatriekliniken bei drei und die Alters- und Pflegeheime bei zwei Fragestellungen die höchsten Werte erzielen. Die Unternehmensgrösse spielt für diese kulturellen Aspekte eine untergeordnete Rolle in Bezug auf die Reife. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Spitalgrössen sind marginal und deshalb nicht erwähnenswert. Digitale Unternehmenskultur = 3,10 Punkte 58 5.1.15. Dimension «Digitale Transformation» Wie Abbildung 24 illustriert, folgt die «digitale Transformation» nur in jedem zehnten Spital einem strategischen Plan. In 35 % der Unternehmen trifft diese Aussage wenig bis gar nicht zu. Demnach gestaltet sich auch deren Steuerung über Rollen, Zuständigkeiten und Prozesse eher schwierig. Bei einer Mehrheit von 56 % findet diese kaum oder überhaupt nicht statt. 45 % sind der Meinung, dass die Ziele der digitalen Transformation nur wenig bekannt oder messbar sind, 28 % sind sogar der Ansicht, dass dies in ihren Unternehmen gar nicht zutrifft. Als Folge findet in jedem dritten Spital keine regelmässige Zielüberprüfung statt, dies trifft nur bei einem Fünftel überwiegend und in jedem zehnten Spital völlig zu. Weiter ist zu erkennen, dass bei nur gerade 13 % die Relevanz von Digital Business für ein Spital vom Management erkannt wird und dieses Statement bei einem Anteil von 36 % mehrheitlich nicht bzw. bei 15 % gar nicht zutrifft. Abbildung 24: Dimension «Digitale Transformation (n = 145) Digitale Transformation folgt einem strategischen Plan 6% 21% 35% 26% 11% Steuerung der digitalen Transformation über Rollen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse 6% 19% 37% 29% 8% Die Ziele der digitalen Transformation sind bekannt und messbar 7% Periodische Überprüfung der Zielerreichung im Zusammenhang mit der digitalen Transformation Die Führungsebene erkennt Bedeutung von Digital Business und stellt Ressourcen zur Verfügung Führungskräfte fördern Eigenverantwortung/Veränderungsbereitschaft für die digitalen Transformation keine Angabe/weiss nicht trifft gar nicht zu 28% 11% 28% 6% 12% 6% 45% 14% trifft wenig zu 14% 34% 36% 41% 21% 33% 32% trifft überwiegend zu 6% 7% 13% 8% trifft völlig zu Gesamthaft erreicht das Spitalwesen in der Dimension «digitale Transformation» einen Reifegrad von 3,08 Punkten. Die Lücke zwischen dem Höchstwert der Privatkliniken mit 3,32 und dem Tiefstwert der Alters- und Pflegeheime (2,75) ist sehr gut erkennbar. Die Privatkliniken liegen in vier der untersuchten Themenfelder deutlich vor ihren Mitbewerbern. Die Differenzen zwischen den Organisationsgrössen sind verschwindend klein und deshalb kaum erwähnenswert. Digitale Transformation = 3,08 Punkte 59 5.1.16. Reifegrad der Branche An dieser Stelle werden die Reifegrade aller Dimensionen zusammengetragen und daraus der Reifegrad für die Kliniken und Spitäler ermittelt (Tabelle 7). Der digitale Reifegrad der Spitäler errechnet sich durch das Teilen der Summe aller Dimensionsreifegrade durch die Anzahl der Dimensionen (neun). Die digitale Reife der Schweizer Kliniken und Spitäler liegt bei einem Wert von 3,13 von 5 möglichen Punkten. Zu berücksichtigen gilt es bei der Einordnung dieses Resultates, dass es für die Antwort «keine Angabe/weiss nicht» bereits 1 Punkt gab und die Skala somit erst bei 2 Punkten («trifft wenig zu») beginnt. Daraus lässt sich folgern, dass die Branche tatsächlich noch ganz am Anfang ihrer digitalen Reise steht. Die Ergebnisse decken auf, dass die höchste Reife im Bereich «Informatik & Technologie ICT» erzielt wird und dass es keinen Themenbereich gibt, welcher klar abfällt. Die Reifegrade der Dimensionen «Produktinnovation» (3,05), «Organisation» (3,04), «Prozessdigitalisierung» (3,06), «Zusammenarbeit» (3,03) und «digitale Transformation» (3,08) liegen nur 0,5 Punkte auseinander und machen klar, dass Handlungsbedarf nicht nur auf einer spezifischen Ebene, sondern in mehrdimensionaler Art besteht. Tabelle 7: Reifegrad der Kliniken und Spitäler (eigene Darstellung) 3,21 3,05 3,23 3,04 3,06 3,03 3,36 3,10 3,08 = 3,13 Insgesamt kommen damit vier Spitaltypen über dem mittleren Reifewert für die Spitalbranche zu liegen. Die Kantonsspitäler, Privatkliniken, Psychiatriekliniken und die Universitätsspitäler schneiden überdurchschnittlich ab, während die anderen Spitaltypen allesamt unter dem Schnitt liegen. Unterzieht man die Spitalgrössen demselben Vergleich so fällt auf, dass Spitäler ab 1 001 Mitarbeitenden den Durchschnittsreifegrad des Spitalwesens übertreffen. Die kleinen und kleineren Institute hingegen liegen mit ihrem Reifegrad unter dem Branchenmittelwert von 3,13 Punkten. Im Folgenden werden diese beiden Vergleichskriterien, die Spitaltypen und -grössen, sowie deren Einfluss auf den Reifegrad im Detail ausgewertet und erläutert. 60 5.1.17. Reifegrad nach Spitaltypen Betrachtet man die Reifegrade pro Dimension und Spitaltyp (Tabelle 8), so lässt sich ein gewisses Muster erkennen. Entweder die Kantonsspitäler oder die Privatkliniken erzielen, bis auf eine Dimension («Digitale Unternehmenskultur»), jeweils die Höchstwerte und schneiden im Durchschnitt aller Themenbereiche am besten ab. Tabelle 8: Reifegrad nach Spitaltypen (eigene Darstellung) Kantonsspital 3,28 3,28 3,45 3,24 3,17 3,24 3,67 3,26 3,22 3,30 Privatklinik 3,60 3,11 3,27 3,03 3,33 3,11 3,34 3,12 3,32 3,25 Psychiatrie 3,31 3,15 3,22 3,24 3,01 2,88 3,48 3,35 3,28 3,21 Universitätsspital 3,26 3,20 3,45 2,96 3,03 3,14 3,35 3,11 2,99 3,17 Spezialklinik 3,31 2,78 2,98 3,07 3,06 2,91 3,44 3,04 2,94 3,06 Reha 2,89 3,00 3,21 3,13 2,88 2,70 3,07 3,13 3,13 3,03 Zentrumsspital 3,06 2,82 3,10 2,88 2,97 3,01 3,33 2,92 2,85 2,99 Andere 2,88 2,83 3,01 3,02 2,94 2,82 3,24 3,15 3,00 2,99 2,61 2,67 2,67 2,67 2,58 2,70 3,00 3,25 2,75 2,76 Alters- und Pflegeheime Die Kantonsspitäler erreichen einen digitalen Reifegrad von gesamthaft 3,30 Punkten, die Privatkliniken 3,25 und die Psychiatriekliniken einen Durchschnittswert von 3,21. Am Schluss der Rangliste stehen die Alters- und Pflegeheime, welche mit dem Tiefstwert von 2,76 Punkten klar die niedrigste digitale Reife besitzen. Aus den Resultaten lässt sich interpretieren, dass die Kantonsspitäler vor allem den Themen Innovation, strategische Verankerung oder aufbrechen von klassischen Organisationsstrukturen und Hierarchien am meisten Beachtung schenken und möglicherweise gezielt in diese Bereiche investieren. Anscheinend probieren sie auch bei der interdisziplinären Zusammenarbeit neue Formen und Wege aus und können dabei auf eine moderne IT-Infrastruktur sowie auf effiziente Systeme und Tools zurückgreifen. Die Privatkliniken stechen besonders beim Patientenerlebnis hervor und sie glänzen in der Kommunikation und Nutzung von modernen Kommunikationsmedien. Auch in Bezug auf die Digitalisierung von Prozessen und Abläufen haben sie die Nase vorne und sie messen dem Thema digitale Transformation offenbar die 61 höchste Wichtigkeit bei. Erstaunlich gute Werte erlangen auch die Psychiatriekliniken, welche bei der digitalen Unternehmenskultur die anderen Spitaltypen hinter sich lassen und auch in Sachen Organisation gleich gut abschneiden wie die Kantonsspitäler. Auf der anderen Seite stehen die Alters- und Pflegeheime welche, bis auf die digitale Unternehmenskultur, jeweils am schlechtesten abschneiden. Angesichts dieser Tatsache ist unklar, ob die Antworten in dieser Dimension tatsächlich ein Abbild der Realität sind. Unabhängig davon, gilt es für die Verantwortlichen in diesen Unternehmen, sich Gedanken darüber zu machen, mit welcher Intensität sie dem Thema Digitalisierung zukünftig begegnen wollen. 5.1.18. Reifegrad nach Spitalgrösse Die Organisationsgrösse hat im Spitalwesen nur einen geringen Einfluss auf die digitale Reife eines Unternehmens, wie Tabelle 9 verbildlicht. Aus der untenstehenden Darstellung lässt sich trotzdem ablesen, dass, über alle digitalen Handlungsfelder hinweg, die Grösse des Spitals schlussendlich über die Höhe des digitalen Reifegrades entscheidet. Tabelle 9: Reifegrad nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) 1 - 200 3,13 2,95 2,99 3,21 3,02 2,82 3,30 3,12 3,13 3,07 201 - 500 3,06 3,02 3,08 3,21 2,94 2,73 3,31 3,24 3,02 3,07 501 - 1 000 3,19 2,96 3,18 3,08 3,03 2,98 3,51 3,16 3,12 3,13 1 001 - 2 001 3,21 3,12 3,19 2,97 3,10 3,13 3,53 3,17 3,12 3,17 2001 - 5 000 3,23 3,05 3,39 3,05 3,08 3,15 3,41 3,10 2,98 3,16 >5 000 3,43 3,10 3,41 2,91 3,20 3,17 3,27 3,05 3,13 3,19 Der Reifewert steigt fast ausnahmslos proportional zur Unternehmensgrösse an. Bis auf wenige Ausnahmen zählen in der Schweiz die fünf Universitätsspitäler in Bern, Zürich, Basel, Genf und Lausanne zu den Grossspitälern. Die Spitäler mit mehr als 5 000 Mitarbeitenden erreichen eine digitale Reife von 3,19 Punkten und die Kleinspitäler mit 3,07 den niedrigsten Wert. Die Floskel «Big is beautiful!» fasst diese Untersuchungskategorie sehr gut zusammen, auch wenn die Unterschiede im Vergleich zu den Spitaltypen verschwindend klein sind. Im Vorfeld der Analyse wurden seitens des Autors bei dieser Auswertung grössere Differenzen vermutet. 62 5.1.19. Einsatz von disruptiven Technologien In Sachen disruptiven Technologien (Abbildung 25) dominieren in Spitälern mit Abstand Roboter oder roboterassistierte Systeme (74 Nennungen), welche vor allem im Operationssaal zum Einsatz kommen. Dahinter folgen die Telemedizin (58 Erwähnungen) und tragbare Technologien in Form von Wearables, welche von 55 Personen genannt wurden. Auch Big Data & Analytics zählt hier mit 48 Stimmen zu den am häufigsten eingesetzten Technologietrends. Eine weniger relevante Rolle spielen in der Branche Themen wie die Sensorik, 3D- oder BioPrinting, das Internet of Things und Virtual bzw. Augmented Reality. Eine geringe oder gar keine Wichtigkeit haben hingegen Technologien wie die künstliche Intelligenz, Drohnen, Chatbots oder die Blockchain-Technologie. Fast ein Drittel der Personen gab zu Protokoll, dass in ihren Organisationen aktuell keine der genannten Technologien zum Einsatz kommt. Der technologische Fortschritt und die (Weiter-)Entwicklung dieser Anwendungen schreiten jedoch rapide voran, sie werden jedoch vermutlich erst in anderen Branchen Verbreitung und Akzeptanz finden. Abbildung 25: Einsatz von disruptiven Technologien (n = 145) Roboter (Cyberknife, Da Vinci etc.) 74 Telemedizin (Videokonsultationen) 58 Wearables (tragbare Technologien) 55 Big Data & Analytics 48 Keine 43 Sensorik 29 3D- oder Bio-Printing 29 Internet of Things (smarte Objekte) 29 Virtual oder Augmented Reality 18 Artificial Intelligence 11 Drohnen 7 Chatbots 6 Blockchain 1 5.1.20. Hemmfaktoren der Digitalisierung Bei der Frage nach möglichen Hemmfaktoren für den digitalen Fortschritt in den Spitälern waren Mehrfachantworten möglich. Abbildung 26 veranschaulicht, dass die Hinderungsgründe dafür bei den Teilnehmenden als vielfältig eingeschätzt werden. Am häufigsten genannt wurden finanzielle Aspekte (90 Antworten), eine fehlende Vision und/oder Strategie (86 Antworten) sowie fehlendes Know-how bei der Führung (76 Antworten). Auch eine unklare Rollen- und Kompetenzverteilung wird von der Hälft der Befragten als hindernd erachtet. Einschränkungen der IT-Systeme, eine 63 fehlende Veränderungskultur oder das bekannte Silodenken in Abteilungen wurden auch vielerorts als Ursachen erachtet. Die Teilnehmenden sahen auch im unklaren Business Case und im teilweise fehlenden Knowhow bei den Mitarbeitenden Hürden für eine schnellere digitale Weiterentwicklung in ihrem Unternehmen. Den regulatorischen Einschränkungen wurde am wenigsten Einfluss auf das Tempo der Digitalisierung beigemessen. Gesetzesvorgaben setzen branchenintern aber die grundlegenden Rahmenbedingungen und mit der Pflicht ab April 2020 ein elektronisches Patientendossier anbieten zu müssen, wurde vom Regulator ein nicht unwesentliches Zeichen gesetzt. Gut möglich, dass seitens Staat oder Kantone weitere Vorgaben oder Standards für die Spitäler festgelegt werden und diese sogar mit einem Platz auf der kantonalen Spitalliste in Verbindung gebracht werden, um Druck auf die Spitäler auszuüben. Abbildung 26: Hemmfaktoren der Digitalisierung (n = 145) Fehlende finanzielle Mittel 90 Fehlende Vision und Strategie 86 Fehlende Know-how bei der Führung 76 Unklare Rollen und Verantwortlichkeiten 73 IT-Einschränkungen 67 Fehlende Veränderungskultur 65 Silodenken in Abteilungen 56 Unklarer Business Case 53 Fehlendes Know-how bei Mitarbeitenden 52 Keine Dringlichkeit Regulatorische Einschränkungen 46 41 5.1.21. Information über Ergebnisse Das Interesse für die Umfrageergebnisse ist relativ gross, so wünschen 85 Personen im Nachgang über die Resultate informiert zu werden. Den Teilnehmenden wird vom Autor ab Mitte Juli 2018, wie angekündigt, eine Zusammenfassung inkl. einer Infografik per Mail zugestellt. 64 5.1.22. Feedbacks zur Online-Umfrage Der Autor hat von den Befragten wertvolle Inputs, sowie auch einige kritische Rückmeldungen zu den Fragen, erhalten. Diese tragen dazu bei, die Struktur und den Inhalt der Umfrage zu verbessern. Etliche Personen empfanden die Umfrage als zu lang oder ausführlich und sie waren mit der thematischen Breite überfordert. Sämtliche konstruktiven Inputs werden vom Autor sorgfältig zusammengetragen und bei der bereits geplanten zweiten Durchführung der Befragung berücksichtigt. 5.2. Zusammenfassung der Experteninterviews Durch die Interviews mit den vier Branchenexperten konnten interessante Einblicke in die digitale Gesundheitsbranche gewonnen werden. In teils intensiven Gesprächen wurden ergänzende Aspekte der Digitalisierung in Kliniken und Spitälern diskutiert. Die gewählte Form des Austauschs und die offenen Fragestellungen haben die Erwartungen des Autors voll erfüllt. Sie haben ein vertieftes Eintauchen in die Thematik ermöglicht. An dieser Stelle werden die Einschätzungen und Meinungen der Interviewpartner zur Digitalisierung im Gesundheitswesen zusammengefasst. Die original transkribierten Interviews sind im Anhang (siehe Kapitel 8.6.3.ff) vollständig abgebildet. Der Verweis auf die genauen Fundstellen der Aussagen und Zitate aus den Interviews geschieht durch ein Referenzieren im Format «Nachname, Jahr und Nummer der Frage», z.B. Frangi, 2018, F10 (= Frage 10). 5.2.1. Stand der Digitalisierung Die Digitalisierung hat die Gesundheitsbranche erfasst, steht nach Angaben der Experten aber noch ganz am Anfang. Entsprechend gross schätzen sie den Nachholbedarf ein. Als Exempel nennen Angerer (2018, F3) und Laukemann (2018, F2) das Faxgerät als nach wie vor beliebtestes Kommunikationsmittel bei Ärzten. Frangi (2018, F4 & F5) beklagt, dass Patienten von den Digitalisierungsbemühungen noch herzlich wenig zu spüren bekommen, und wenn, dann eher in Privatkliniken. Laukemann (2018, F2) unterscheidet bei der Betrachtung der Digitalisierung den administrativen vom med. Bereich. Der klassische Behandlungsablauf und dessen Prozesse hinken seiner Meinung nach enorm hinterher. Das Tempo der Innovation oder den Fortschritt der Digitalisierung in der Medizin und Forschung empfindet er als ungleich höher. Frangi (2018, F4) teilt diese Auffassung: «Der Trend, den wir feststellen ist, dass vor allem in der Digitalisierung der Medizin sehr viel passiert. […]. Dort wird sehr viel Geld investiert». Als einen der Hauptgründe für den digitalen Rückstand gegenüber anderen Branchen sehen Frangi (2018, F2) und Angerer (2018, F3) den fehlenden Druck zur Optimierung. Einen weiteren relevanten Aspekt vermuten Angerer (2018, F3) und Märke (2018, F5) in der komplexen Expertenorganisation Spital. Der Einfluss von Ärzten und Spezialisten, beides Berufsbilder 65 welche sich erfahrungsgemäss nur ungern führen liessen, sei hier nicht zu unterschätzen. Für Laukemann (2018, F3) stehen die typische Schweizer Behäbigkeit und nicht zuletzt auch die Strukturprobleme der digitalen Entwicklung zusätzlich im Wege. «Meine Hauptbotschaft ist immer, bevor man digital wird, muss man erst effizient werden. Zuerst die Prozesse optimieren und dann kann man über Digitalisierung sprechen» beschwichtigt Angerer (2018, F17). Er legt Spitälern nahe, trotz des Rückstands in Sachen Digitalisierung, nun nichts zu überstürzen, sondern sich schrittweise an das Thema heranzutasten (Angerer, 2018, F10). 5.2.2. Projekte & Initiativen Nach Ansicht der Interviewpartner fehlen die grossen und erfolgreichen digitalen Leuchtturmprojekte im Spitalwesen noch. Für Laukemann (2018, F3) ist mit den Initiativen rund um das EPD zwar Bewegung in die Branche gekommen, er bemängelt aber dessen Rahmenbedingungen und die fehlende Weitsicht der Projektverantwortlichen. Frangi (2018, F3) verweist auf das grösste eHealth-Projekt der Schweiz, den Zusammenschluss der Kantone Bern und Zürich, welche das elektronische Patientendossier gemeinsam anbieten werden. Laukemann (2018, F3) und Märke (2018, F3) erwähnen das Projekt «Epic», die Einführung eines neuen und modernen Klinikinformationssystems, des Kantonsspital Luzern als potenzielles Leuchtturmprojekt. Ansonsten existieren vor allem individuelle Projekte in einzelnen Instituten, welche lediglich als kleine Puzzlesteinchen der Digitalisierung zu verstehen sind. 5.2.3. Trends Angesprochen auf die aktuellen Trends sticht für Frangi (2018, F7) vor allem die steigende Relevanz von «Big Data & Analytics» heraus. Er sieht das Hauptpotenzial bei der Diagnostik mit massiven Auswirkungen für die Bereiche Prävention und Therapie, indem z.B. einzelne Spezialisten plötzlich auf öffentliche, globale Wissensdatenbanken und so auf eine enorme Menge an Falldaten zugreifen könnten. Angerer (2018, F5) hingegen verweist auf eine Studie der ZHAW (2017, S. 9ff), welche digitale Trends aus dem Gesundheitswesen kategorisiert. Dazu gehören eHealth, disruptive Technologien oder das Thema «Lifestyle & Fitness» mitsamt seinen unzähligen digitalen Gadgets und dem Trend zur digitalen Selbstvermessung. Der Befragte erklärt, dass aus diesen Entwicklungen durchaus neue Geschäftsmodelle in der Entstehung sind. Spannend ist aus Sicht von Laukemann (2018, F15) die Tendenz, dass man sich vereinzelt in Spitälern digitales Wissen von aussen ins Unternehmen holt, beispielsweise indem man sich regelmässig mit Start-Ups austauscht und so intern aufzeigt, was technologisch heute überhaupt schon machbar und möglich ist. Märke (2018, F4) wiederum weiss, dass es im Bereich der Robotik etliche interessante Ideen und Umsetzungen gibt bzw. dass solche geplant sind. Eine denkbare Entwicklung ist aus seiner Perspektive die künftige Verknüpfung von Versicherungsleistungen mit der effektiven Leistungserbringung. Er spricht davon, «[…] dass aus 66 dem Krankheits- ein Gesundheitswesen wird und dass der Fokus dadurch wechselt» (Märke, 2018, F4). 5.2.4. Disruptionspotenzial Die Einschätzungen der Interviewten bezüglich Disruptionspotenzial sind fast kongruent. Pauschal sehen alle das Gesundheitswesen als Nachzügler und konstatieren, dass Disruption eher schleichend stattfindet. Angerer (2018, F6) bestätigt das Potenzial von disruptiven Entwicklungen, ihm ist jedoch unklar, wann, wo und wie die Disruption im Gesundheitsbereich über die Bühne gehen wird. Laukemann (2018, F5) und Märke (2018, F4) prognostizieren, dass sie eher im unterstützenden administrativen Bereich eintritt und nicht in der klassischen Medizin. Frangi (2018, F6) sieht das anders und bestätigt, dass gerade im administrativen Bereich keine solchen Tendenzen auszumachen sind. Für Märke (2018, F5) ist das Potenzial zur Disruption zwar durchaus da, er unterstreicht aber, dass das Gesundheitswesen eine höchst komplexe Expertenorganisation ist und sich die Art und Weise wie diese funktioniert in der Vergangenheit nur marginal verändert hat. Für Laukemann stellen Tech-Firmen durchaus eine Gefahr für Spitäler dar. «Ich denke, Player wie Apple sind sich extrem am Vorbereiten im Gesundheitsmarkt eine Rolle zu spielen und die denken halt nicht nur national. Die denken nicht an Gesetze, Grenzen oder Services» (Laukemann, 2018, F5). Frangi (2018, F7) stimmt dem zu und ergänzt, dass Patienten von Spitälern oder Ärzten teilweise ähnliche Lösungen erwarten wie von diesen globalen Giganten. Er relativiert seine Aussage gleich und verweist auf den Faktor Vertrauen, welcher das Gesundheitswesen von anderen Branchen stark unterscheidet. In seiner täglichen Arbeit stellt er fest, dass die meisten Leute keine hochsensitiven Daten wie Blutwerte oder HIV-Testresultate mit diesen Unternehmen teilen wollen. Märke (2018, F6) stellt sich dazu eine schon fast philosophisch anmutende Frage: «Wer lernt schneller? Lernen Spitäler schneller, wie man mit dem Potenzial von Daten umgeht oder lernen die Tech-Firmen schneller, wie man zuverlässig Medizin macht?». Ein Beispiel für eine bereits stattfindende Disruption ist für Frangi (2018, F6) die Telemedizin, welche vor allem im ambulanten Bereich immer mehr Einzug hält. Im Spital stellt er hingegen kaum Bemühungen in diese Richtung fest, sondern spürt eher eine gewisse Zurückhaltung. 5.2.5. Auswirkungen auf Organisation und Unternehmenskultur Bei den Befragten herrscht Einigkeit darüber, dass die Digitalisierung grossen Einfluss auf die Organisation und die Unternehmenskultur hat. Angerer (2018, F9) spricht von einem klassischen Change-Prozess, bei dem er eine Art Doppelblockade befürchtet: er geht davon aus, dass sich die Herausforderungen des Change-Managements multiplizieren, wenn sich die Veränderung auf zwei Ebenen abspielt: Innovation geschieht in digitaler Form. Für Märke (2018, F7) ist klar, dass man Betroffene zu Beteiligten machen muss und so versucht ein gewisses Momentum zu 67 erzeugen. Angerer (2018, F10) und Märke (2018, F6 & F21) empfehlen dabei ein sequenzielles Vorgehen um mit Teilprojekten und dem Aufzeigen des konkreten Nutzens Lust am Digitalisieren zu schaffen. Laukemann (2018, F15) erwartet hier von Spitälern eine gewisse Risikobereitschaft und verlangt gleichzeitig bei der Umsetzung eine gesunde und ehrliche Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten, im Sinne von «weniger ist mehr». Er glaubt auch, dass ein «Test & LearnAnsatz» für Spitäler im nichtmedizinischen Bereich durchaus denkbar sei. 5.2.6. Veränderung der Berufsbilder Dass Digitalisierung auch Berufe im Spital verändert, ist für alle Interviewten unumstritten. Frangi (2018, F8) sieht diesen Change gleichzeitig als grösste kulturelle Herausforderung. Für ihn stellt sich die Frage, ob und wie die digitalen Fähigkeiten der jungen Generation mit dem med. Wissen der älteren Personen kombiniert werden und so eine Art Win-Win-Situation für die Mitarbeitenden und das Spital entstehen kann. Alle Befragten sind der Ansicht, dass das menschliche Element, vor allem im Pflegebereich, in absehbarer Zeit kaum durch Maschinen ersetzt werden kann. Die Pflege zeichnet sich durch einen hohen Grad an Empathie und Menschlichkeit aus und gerade für ältere Patienten ist nach Frangi (2018, F11) der persönliche Kontakt mit Pflegepersonal sehr relevant. Für Angerer (2018, F12) und Märke (2018, F9 & F11) eröffnen sich durch die Digitalisierung eher Chancen. Durch den Einsatz von technologischen Hilfsmitteln sollen administrative Aufgaben erleichtert werden, um mehr Freiräume für die Betreuung der Patienten, die Kernaufgabe der Pflege, zu schaffen. Angerer (2018, F12) versteht Roboter als sinnvolle Ergänzung zum Menschen. Märke (2018, F11) kann sich Roboter vor allem für sicherheitsrelevante Routineprozesse denn als Substitut für den Menschen vorstellen. Durch digitale Technologien werden auch im Spital neue Berufe geschaffen, darüber herrschen bei den Experten keine Zweifel. Angerer (2018, F11) und Laukemann (2018, F14) sehen beide eine Art «Digital Trendscout» entstehen, jemanden, der Trends und Entwicklungen einschätzen, deren Relevanz für das Spital einordnen und in die Sprache der Mitarbeitenden übersetzen kann. Märke (2018, F9) ergänzt, dass all die neuen Geräte oder Systeme ja auch gepflegt, unterstützt und weiterentwickelt werden müssen. Bei der Aus- und Weiterbildung sehen die vier Interviewpartner keine gravierenden Einschnitte. Sie erachten solide Grundkenntnisse in Sachen ICT als erstrebenswert, verneinen aber allesamt, dass ein Arzt oder Mitarbeitender der Pflege selber zum Programmierer mutiere. Märke (2018, F8) hält fest, dass z.B. Ärzte selbstverständlich Operationsroboter bedienen lernen müssten. Insgesamt sehen die Experten den Veränderungen von Berufsbildern eher gelassen entgegen und nach Aussagen von Märke (2018, F9) werden gerade in der Pflege, auch die Patienten ein gewichtiges Wort mitreden, wenn schlussendlich die Frage gestellt wird, ob sie lieber von Robotern oder von Menschen gepflegt werden wollen. 68 5.2.7. Zuständigkeit Bei dieser Frage sind sich die Experten völlig einig: Digitalisierung muss Chefsache sein! Die Interviewpartner tendieren bei der Digitalisierung im Spital eindeutig zu einem «Top-Down»Vorgehen. Frangi (2018, F9) und Laukemann (2018, F7) bestätigen, dass Spitäler gewisse Hierarchien und klare Strukturen benötigen. Aus ihrer Sicht wird Digitalisierung vielerorts noch als Spielwiese verstanden und eher stiefmütterlich behandelt. Für alle vier muss der «Head of Digitalisierung» eine möglichst hohe Position bekleiden und bestenfalls in der Klinikleitung sitzen, damit das Thema eine angemessene Management-Attention erhält. «Wenn man das im Unternehmen nicht zuoberst ansiedelt, dann verpasst man den Zug, weil Sie die Geschäftsleitung schon gar nicht mehr erreichen» (Laukemann, 2018, F7). Angerer (2018, F10) weist darauf hin, dass in diesen Gremien schliesslich die nötigen Gelder gesprochen werden und man deshalb schon auf dieser Ebene gewisse Zeichen setzen sollte. Nach Meinung von Märke (2018, F13) sind die Leute an der Front zudem sehr stark im Tagesgeschäft involviert und wollen primär ihre Patienten pflegen. Ihr Interesse an der Digitalisierung sei deshalb gezwungenermassen sekundär. 5.2.8. Benötigte Ressourcen Die Aussage von Frangi (2018, F16) bestätigt, dass sich hier eine Gretchenfrage auftut: «Investitionen in die Digitalisierung stehen oft in Konkurrenz zu anderen Investitionskosten und das ist für mich eine Gefahr. Wenn Du Dich als Spital vielleicht eher für die Infrastruktur, Küche oder das Bettenhaus entscheidest und weniger für die Digitalisierung, dann wirst Du in ein paar Jahren vor einem Problem stehen». Dieses Statement bringt das Dilemma auf den Punkt, denn Spitäler haben begrenzte finanzielle Ressourcen (Laukemann, F14 und Märke, F17) und müssen für die Digitalisierung zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen. Laukemann (2018, F14) schlägt vor, dass beispielsweise ein fixer Prozentsatz des Umsatzes in digitale Projekte fliessen sollte. Frangi (2018, F16) ist der Meinung, dass jahrelang kaum oder nur sehr wenig in digitale Initiativen investiert wurde und die Spitäler nun die Quittung dafür erhalten. Die Einschätzungen der Experten stimmen auch bei der Ressourcenfrage sehr gut überein, denn die Digitalisierung erfordert relativ hohe Investitionen und wird Spitäler erst einmal Geld kosten. Dabei ist mehrheitlich unklar, welcher direkte Return mit dem gesprochenen Risikokapital erzielt werden kann. 5.2.9. Bereitschaft für Digitalisierung Mitarbeitende und Patienten scheinen gemäss den Befragten durchaus bereit für digitale Anwendungen und Lösungen zu sein. Über das Aufzeigen des konkreten Mehrwerts und Nutzen der Digitalisierung können beide Anspruchsgruppen weiter für digitale Themen begeistert werden. Angerer (2018, F14) verweist auf eine ZHAW-Studie, welche herausgefunden hat, dass die durchschnittliche Veränderungsbereitschaft bei Spitalmitarbeitenden höher ist als beim Rest 69 der Bevölkerung. Auch Märke (2018, F15) verweist darauf, dass Ärzte sich Innovation bereits aus der Medizin gewohnt sind und ihr Mindset deshalb als sehr offen beschrieben werden kann. Laukemann (2018, F12) bestätigt diese Einschätzung, «Ich erlebe bei uns Ärzte, das wären die besten Programmierer». Er stellt gleichzeitig fest, dass das digitale Knowhow der Mitarbeitenden generell eher gering ist, dass aber die private Durchdringung der Digitalisierung dabei hilft, Hemmungen abzubauen. Die jüngere Generation bringt ganz neue Fähigkeiten und Erwartung mit, was den digitalen Wandel im Spital weiter begünstigt. Teilweise stehen Spitäler sogar unter Druck, weil von Arbeitnehmern schon fast übertriebene Erwartungen an IT-Infrastruktur und Systeme gestellt werden. Seitens Patienten ist der Druck vor allem in Bezug auf Services wie WLAN oder auf die Hotellerie & Gastronomie zu spüren und weniger in Bezug auf fehlende digitale Angebote (Laukemann, 2018, F16). 5.2.10. Technologie-Trends Am wenigsten Übereinstimmung gibt es, wohl aufgrund der grossen Bandbreite, bei der Frage nach den dominierenden Technologien-Trends im Gesundheitswesen. Angerer (2018, F18) glaubt, dass die bahnbrechenden Technologien erst in ein paar Jahren in Spitälern ankommen. Frangi (2018, F7 & F18) hebt Virtual Reality hervor, während Laukemann (2018, F2 & F7) künstliche Intelligenz oder das Internet of Things als relevante Entwicklungen einstuft. Märke (2018, F3 & F19) erklärt, dass künstliche Intelligenz, Sensorik, Wearables, Mikro-Chips und nicht zuletzt die Blockchain-Technologie Potenzial haben, um Medizin auf ein neues Level zu bringen. Das Potenzial von Big Data und dessen Auswirkungen auf Gesundheitsinstitutionen wird von allen Interviewten am grössten eingeschätzt. Durch neue Technologien können enorme med. Datenmengen gesammelt und mit intelligenten Algorithmen schneller und präziserer ausgewertet werden. Die Befragten sind der Ansicht, dass diese Entwicklung wünschenswert ist, dass in diesem Zusammenhang dem Datenschutz und der Datenhoheit eine bessere Beachtung geschenkt werden muss. Mit der Zunahme von höchst sensitiven Daten geraten Spitäler mit grosser Wahrscheinlichkeit stärker in den Fokus von Hackerangriffen, weshalb Cyberkriminalität vor allem in der IT immer mehr zum Thema wird (Frangi, 2018, F4 & F14). Angerer (2018, F15) ist bezüglich dem Potenzial von Daten auch skeptisch und wünscht sich, dass die aggregierten Daten primär für die Verbesserung von bestehenden Geschäftsmodellen und nicht für die Entwicklung von neuen genutzt werden. Frangi (2018, F15) sieht bei den Patienten noch eine starke Zurückhaltung bezüglich Freigabe von med. Daten und Märke (2018, F16) denkt, dass die Entscheidung über deren Nutzung eine politische ist und in der Verantwortung des Regulators liegt. 5.2.11. Treiber der Digitalisierung Bei der Frage nach den Treibern sind sich alle Experten einig, dass das EPD eher als «Türöffner» und «Enabler» denn als Motor des digitalisierten Gesundheitswesens zu verstehen ist. Durch das 70 EPD müssen Infrastrukturen, Systeme und Prozesse in Frage gestellt und überprüft werden (Frangi, 2018, F19) und es findet endlich ein gesetzlich verordneter Austausch mit anderen Leistungserbringern statt (Laukemann, 2018, F17). Frangi (2018, F19) fasst das wie folgt zusammen: «Ich bin überzeugt, es ist nicht der einzige und nicht der wichtigste Treiber in der Digitalisierung. Aber, und das ist das Gute, es ist ein gesetzlich verordneter «Turbo-Boost». […]». 5.2.12. Das Spital der Zukunft Spitäler wird es auch in Zukunft benötigen, allerdings werden sie anders funktionieren. Frangi (2018, F21) ist überzeugt, dass sich vor allem im (Self-)Service-Bereich sehr viel verändert und vieles automatisiert wird. Mitarbeitende werden mit Bestimmtheit enorm effizientere Hilfsmittel haben. Die Interviewten sprechen von smarten Spitälern, welche dafür zuerst die Vorstufe, das «Lean Hospital», durchlaufen müssen. Bevor vernetzte und intelligente Spitäler existieren, müssen diese ihre Prozesse verschlanken (Frangi, 2018, F21 und Märke, 2018, F21). Angerer (2018, F20) teilt diese Meinung und fügt an, «[…] Wir werden immer noch die gleichen Grundmuster sehen, aber wir werden sehen, wie dann vieles dank Technologie schneller, einfach und besser gemacht werden kann, als heutzutage». Laukemann (2018, F18) beobachtet den Trend zur Arbeitsteilung und kann sich vorstellen, dass Spitäler immer mehr Hotelcharakter haben. Er spricht auf lange Sicht sogar von Franchising-Modellen wie bei McDonalds, wo Spitäler «nur» noch die Infrastruktur liefern und dadurch so genannte Operationshäuser entstehen. 5.2.13. Reifegrad der Spitäler Bei der Frage nach dem Reifegrad werden die Spitäler als ungenügend bewertet (Mittelwert = 2,5 von 5 Punkten). «Also, wenn man einen Gesamtindex macht aus: welche Technologien haben sie, wie gut sind sie in der Organisation aufgestellt, wie viele strategische Gedanken machen sie sich zum Thema Innovations- und Technologiemanagement und wie ist die Bereitschaft der Mitarbeitenden, würde ich ihnen vielleicht eine 2 geben» (Angerer, 2018, F21). Laukemann (2018, F19) zeigt sich angesichts dessen, was technologisch möglich wäre, sogar etwas konsterniert. Für Märke (2018, F17) ist die Krux an der Sache, dass es nicht nur an Geld, sondern auch an Zeit und Personal mangelt, um Digitalisierung rascher voranzutreiben. «[…]. Das ist die heikle Kombination, dass das Tagesgeschäft einem die Möglichkeit zur Innovation wie aufsaugt» (Märke, 2018, F17). 5.2.14. Kritische Betrachtung der Ergebnisse Wie bei vielen empirischen Forschungsarbeiten sind auch die Ergebnisse der vorliegenden Master-Thesis mit einigen Vorbehalten zu betrachten. Da die benötigte Stichprobengrösse nicht erreicht wurde, dürfen keine allgemeingültigen Aussagen für die Spitalbranche getroffen werden. Die Verteilung der Teilnehmenden auf die einzelnen Spitaltypen und -grössen entspricht nicht dem Abbild der Grundgesamtheit, weil bei der Umfrage bewusst keine Beschränkung auf eine 71 maximale Anzahl Teilnehmer pro Spital eingerichtet wurde. Bei der Umfrage sind z.B. Universitätsspitäler deutlich untervertreten, wo hingegen Kantonsspitäler und Psychiatriekliniken prozentual eher übervertreten sind. Weiter bestand bei der Online-Umfrage keine Zugangsbeschränkung, so dass theoretisch alle Personen, welche auf den Link Zugriff hatten, teilnehmen konnten. Die Befragung wurde aus Gründen der Umsetzbarkeit nur auf Deutsch durchgeführt und die Resultate haben deshalb lediglich für die Deutschschweiz Gültigkeit. Allerdings kann hier davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse in der Westschweiz und im Tessin ungefähr in einem ähnlichen Rahmen ausgefallen wären. Die Antworten der Online-Umfrage wurden bei den neun untersuchten Dimensionen bewusst nicht gewichtet, was bei einer Folgestudie anzupassen ist. Auch die gewählte Antwortskala muss aufgrund der zu ausgeglichenen Resultate hinterfragt und diskutiert werden. Die verschiedenen Antwortoptionen sind möglicherweise zu wenig trennscharf, was teilweise zu unklaren Antworten geführt haben könnte. Den Befragten wurde bei Multiple-Choice-Fragen die Möglichkeit gegeben fehlende Kriterien, Punkte oder Technologien zu ergänzen, was jedoch von keinem der Teilnehmenden gemacht wurde. Insofern scheinen die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten gepasst zu haben, auch wenn sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Auch der Umstand, dass mit einer Antwort «keine Angabe/weiss nicht» bereits 1,00 Punkte gesammelt werden konnte, ist nachträglich betrachtet suboptimal umgesetzt. Bei der Analyse der digitalen Reife wurden vom Autor nebst dem Spitaltyp und der Unternehmensgrösse verschiedene weitere Filterkriterien getestet (z.B. Reifegrad nach Position oder Abteilung der Teilnehmenden), die daraus resultierenden Fallzahlen waren aber entweder zu klein oder aber die Unterschiede kaum sichtbar, um diese für weitere Aussagen nutzen zu können. Die generierten Inhalte aus den Experteninterviews mussten vom Autor bestmöglich interpretiert werden. Die Deutung erfolgte unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie der Vorkenntnis und Position der Interviewten, dem Zeitpunkt und Ort des Interviews sowie der Art des Interesses am Thema. Trotzdem liefert die Analyse genügend Anhaltspunkte und verwertbare Indizien zum Stand der Digitalisierung in den Kliniken und Spitälern. Die gesammelten Informationen sind der Branche und den einzelnen Unternehmen bei ihrer Standortbestimmung dienlich. 72 «Meine Hauptbotschaft ist immer, bevor man digital wird, muss man erst effizient werden. […] Zuerst die Prozesse optimieren und dann kann man über Digitalisierung sprechen». (Angerer, 2018, F17) 73 6. Schlussbetrachtung & Handlungsempfehlungen Im letzten Kapitel werden die Forschungsfragen beantwortet und die Hypothesen aufgelöst. Der Autor formuliert pro Dimension Handlungsempfehlungen und wagt abschliessend einen Blick nach vorne. 6.1. Beantwortung der Forschungsfragen Mit den aus der Studie gewonnenen Ergebnissen, lassen sich die übergeordnete sowie die drei unterstützenden Forschungsfragen für die Master-Thesis wie folgt beantworten. «Wie weit ist die Digitalisierung in den Schweizer Spitälern fortgeschritten und welche Kompetenz- oder Handlungsfelder lassen sich daraus ableiten?» Die Untersuchung hat deutlich gemacht, dass die Digitalisierung der Spitalbranche noch in den Kinderschuhen steckt. Die Kliniken und Spitäler stehen am Anfang eines längeren und grösseren Transformationsprozesses. Die Online-Umfrage und die Experteninterviews haben gezeigt, dass das Bewusstsein für die Digitalisierung in den Unternehmen angelangt ist, dass derzeit aber nur wenige sicht- und spürbare Projekte in diese Richtung anlaufen. Die Digitalisierung vollzieht sich in den Kliniken und Spitälern eher willkürlich, unkoordiniert und daher mehrheitlich schleppend. Die Spitäler haben in sämtlichen untersuchten Dimensionen und Wirkungsfelder der Digitalisierung einen grossen bis sehr grossen Nachholbedarf. Spitaltypen oder -grössen haben, wie auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder der Status eines Privatspitals, lediglich einen minimalen Einfluss auf den digitalen Reifegrad. Am besten schneiden bei der Analyse die Kantonsspitäler ab, am schlechtesten die Alters- und Pflegeheime. Am reifsten sind die Spitäler im Bereich «Informatik & Technologie ICT» aufgestellt, was Mut für die Zukunft macht. Die IT ist schliesslich ein zentraler Dreh- und Angelpunkt bei fast allen Digitalisierungsthemen und sie stellt die Basisinfrastruktur zur Verfügung, welche digitale Projekte und Initiativen überhaupt erst ermöglicht. Am meisten Potenzial besteht in den Bereichen «Produktinnovation», «Organisation», «Zusammenarbeit» und «digitale Unternehmenskultur». Es sind demnach eher die kulturellen Dimensionen und Aspekte der Digitalisierung, in welche es zu investieren gilt. 1. Frage Welche Relevanz hat das Thema «Digitalisierung» für Kliniken und Spitäler? Die Relevanz der Digitalisierung, auf Branchenebene, erachtet die riesige Mehrheit von 88 % der Befragten als «sehr wichtig». Zählt man die Antwortoption «eher wichtig» dazu, so sind es sogar 74 98 %, welche die Wichtigkeit des Themas hoch einschätzen. Ein anderes Bild zeichnet sich bei der Einordnung der Relevanz im eigenen Unternehmen. Nur bei gut einem Drittel der Spitäler wird diese als «sehr wichtig» eingestuft, bei der Hälfte der Spitäler wird sie als «eher wichtig» bewertet. Es zeigt sich somit ein deutliches Delta zwischen den beiden Messwerten, welches die unterschiedlichen Organisationen in den nächsten Jahren zu schliessen versuchen sollten. Angesprochen auf die Veränderung der Wichtigkeit des Themas in ihrem Unternehmen geben 85% an, dass diese deutlich zunimmt. Anscheinend wird die Relevanz für die Branche gut bis sehr gut verstanden, in den einzelnen Spitälern geniesst Digitalisierung aber noch keine hohe Priorität und sie wird nach wie vor eher stiefmütterlich behandelt. 2. Frage Welches ist der digitale Reifegrad von Schweizer Kliniken und Spitälern? Die Digitale Bereitschaft der Kliniken und Spitäler wurde mit Fokus auf neun relevante digitale Handlungsfelder untersucht. Der Reifegrad des Spitalwesens beträgt 3,13 von 5 möglichen Punkten. Am besten schneiden die Unternehmen im Bereich «Informatik & Technologie ICT» ab (3,36), die schlechtesten Werte werden in den Dimensionen «Produktinnovation» (3,05), «Organisation» (3,04), «Prozessdigitalisierung» (3,06), «Zusammenarbeit» (3,03) und «digitale Transformation» (3,08) erzielt. Den höchsten Reifegrad erreichen die Kantonsspitäler mit 3,30 Punkten, während die Alters- und Pflegeheime bei 2,76 zu stehen kommen. Je grösser die Spitäler, desto höher ist der Reifegrad, welcher sich bei Unternehmen mit > 5 000 Mitarbeitenden bei 3,19 einpendelt. Die kleinen Kliniken liegen mit 3,07 aber nur leicht unter diesem Wert, weshalb die Spitalgrösse nur minimal ausschlaggebend für die digitale Reife ist. 3. Frage Welches sind die hemmenden Faktoren für eine erfolgreiche Digitalisierung? Für die eher langsam voranschreitende Digitalisierung im Spitalwesen können verschiedene Faktoren verantwortlich gemacht werden. Anders als in anderen Branchen, werden indes nicht regulatorische Rahmenbedingungen oder ein grundsätzlich innovationsfeindliches Umfeld als Hauptgründe genannt. In den Kliniken und Spitälern sind es vorwiegend die fehlenden finanziellen Mittel, welche die Unternehmen davon abhalten sich stärker mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Bemängelt werden weiter eine fehlende Vision oder Strategie und, fast gleichermassen, kaum vorhandenes Knowhow auf der Führungsebene. Die mehrheitlich unkoordinierte Auseinandersetzung mit dem Thema scheint zudem vielerorts zu einer unklaren Rollenverteilung und Verantwortung zu führen. In ihrer digitalen Entwicklung beeinträchtigt werden etliche Spitäler auch durch Einschränkungen im IT-Bereich. Auffällig häufig wird auch noch eine fehlende Veränderungskultur moniert. 75 6.2. Auflösung der aufgestellten Hypothesen Nachfolgend werden die zentralen Erkenntnisse der empirischen Analyse zur Beantwortung der Hypothesen zusammengefasst: 1. Hypothese Die Digitalisierung wird im Spital als «eher wichtig» eingeschätzt. Diese Hypothese hat sich als korrekt erwiesen. Die Relevanz für die gesamte Spitalbranche wird zwar von einer überragenden Mehrheit (88 %) als «sehr wichtig» eingestuft, in den einzelnen Spitälern wird sie bislang aber nur von 36% als «sehr wichtig» wahrgenommen. Die Majorität von 51 % beurteilt sie für ihr Spital als «eher wichtig». 2. Hypothese Die Mehrzahl (>50%) der Schweizer Spitäler verfügt über keine Digitalstrategie. Auch die zweite Hypothese hat sich als richtig herausgestellt. Es handelt sich um keine deutliche Mehrheit, jedoch geben rund 54 % der Kliniken und Spitälern an, über keine digitale Strategie zu verfügen. Nur knapp ein Viertel der Befragten bestätigt die Existenz einer Digitalstrategie bei ihrem Arbeitgeber während jeder Fünfte darüber keinen Bescheid wusste. 3. Hypothese Das Thema Digitalisierung ist in Spitälern mehrheitlich «Bottom-Up» bei der IT angesiedelt und nicht «Top-Down» in der Geschäftsleitung. Die These hat sich bewahrheitet. Bei 42 % der Antwortenden ist die Abteilung «IT & Projekte» für digitale Themen zuständig. Jedoch muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass bereits bei vorbildlichen 31 % die Geschäftsleitung persönlich für die Digitalisierung verantwortlich ist. 4. Hypothese Die Dimension «Patientenerlebnis» weist den höchsten, die «digitale Unternehmenskultur» den tiefsten Reifegrad auf. Diese These hat sich nicht bestätigt. Die höchste digitale Reife ist im Bereich «Informatik & Technologie ICT» festzustellen (3,36 von 5 möglichen Punkten), der niedrigste Reifegrad ergibt sich mit 3,03 Punkten in der Dimension «Organisation». 76 5. Hypothese In den Kliniken und Spitälern zählen Operations-Roboter zu den am meist verbreiteten Technologien. Mit rund 74 Nennungen werden Operationsroboter deutlich am häufigsten der so genannten disruptiven Technologien, was die Vermutung bestätigt. Zu den weiteren prägenden TechnologieTrends, welche heute schon von Spitälern genutzt werden, zählen die Telemedizin, Wearables sowie Big Data & Analytics. Weitaus seltener eingesetzt werden die Sensorik, 3D-/Bio-Printing oder das Internet of Things. 6. Hypothese Universitätsspitäler weisen den höchsten digitalen Reifegrad im Spitalwesen auf. Diese These wurde durch die empirische Analyse widerlegt. Den höchsten digitalen Reifegrad weisen die Kantonsspitäler mit 3,30 Punkten auf. Die Universitätsspitäler liegen mit einem Durchschnittswert von 3,17, noch hinter den Privat- und Psychiatriekliniken, auf dem vierten Platz. 7. Hypothese Der meistgenannte Hemmfaktor der Digitalisierung sind fehlende finanzielle Mittel. Die empirische Untersuchung hat diese Hypothese bestätigt. Fehlende finanzielle Mittel werden, nebst einer nicht vorhandenen Vision oder Strategie, von den Teilnehmenden am häufigsten (90 Erwähnungen) als Gründe für die langsam stattfindende Digitalisierung genannt. 77 6.3. Handlungsempfehlungen Anhand der vorliegenden Resultate werden für die neun untersuchten Dimensionen Handlungsempfehlungen formuliert. Dazu dienen die gewonnenen Erkenntnisse aus der OnlineUmfrage und die Aussagen und Empfehlungen aus den vier Experteninterviews. Die Spitäler müssen Patienten und ihre konkreten Bedürfnisse noch stärker ins Zentrum ihrer Aktivitäten stellen. Die Weiterentwicklung der Kommunikationskanäle sollte anhand und entlang der «Patient Journey» geschehen. Dabei gilt es, das Zusammenspiel zwischen On- und Offline-Kanälen zu verbessern und gleichzeitig digitale (Self-)Services und Angebote zu entwickeln. Die Patienten sind zur Nutzung Patientenerlebnis solcher bereit, sofern sie ihnen spürbare Mehrwerte bringen. Indem Interaktions- mit Personendaten verknüpft werden, kann eine personalisierte Kommunikation erfolgen. Dazu bedarf es den Einsatz von CRM-Systemen und den gezielten Aufbau von Knowhow im Bereich der Datenanalyse. Der heutige Patient hat eine gesteigerte Erwartungshaltung gegenüber dem Spital: er ist ausgezeichnet informiert und fordert vermehrt sein Mitspracherecht ein. Mit digitalen Werkzeugen, einem unkomplizierten Zugang zu (seinen) med. Informationen und einem transparenten Patientendialog kann diesen Erwartungen zukünftig besser entsprochen werden. Im Innovationsbereich ist digitalen Trends und Technologien nicht nur im med. Bereich, sondern auch in der Administration, eine grössere Beachtung zu schenken. Hier sind enorme Potentiale zur Steigerung von Effizienz und Qualität vorhanden. Die Zielgruppen (Mitarbeitende, Zuweiser oder Produktinnovation Patienten) müssen aktiv in die Entwicklung von digitalen Innovationen eingebunden werden. Weiter empfiehlt es sich, eine innovationsfreundliche Unternehmenskultur zu etablieren und dafür entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Innovationsprozess sollte transparent und für alle Mitarbeitenden verständlich ausgestaltet werden. Das «Geschäftsmodell Spital» ist auf sein Disruptions-, die Wertschöpfungskette auf ihr Digitalisierungspotenzial zu prüfen. Eine systematische Befragung der Zielgruppe zu digitalen Services ist ebenfalls sicherzustellen. 78 Um Digitalisierung besser im Unternehmen zu verankern, muss das Thema zur Chefsache erklärt und «Top-Down» vorangetrieben werden. Schlussendlich werden auf dieser Ebene die Budgets allokiert und die Ressourcen bereitgestellt. Die Spitäler sind dazu angehalten, ihre digitale Vision in Form Strategie einer Strategie festzuhalten. Die Relevanz des Themas und das Bewusstsein über die nötigen Kernkompetenzen zur Bewältigung der digitalen Zukunft müssen, speziell von der Managementebene, nachvollzogen und aufgebaut werden. Digitalisierung ist als ein kontinuierlicher Weiterentwicklungsprozess zu verstehen und sollte vom Management entsprechend vorgelebt werden. Die Umsetzung der Digitalstrategie ist anhand einer Roadmap in kleinen, realistischen und messbaren Schritten zu planen. Bei der Organisation ist der digitalen Komponente besser Rechnung zu tragen. Agilität ist eine Kernkompetenz, welche es durch flache Hierarchien und einer funktions- bzw. abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit, aufzubauen gilt. Organisation Es muss ein systematisches Trend-Monitoring installiert werden, welches es erlaubt, zeitnah auf neue Technologien und Veränderungen im Marktumfeld zu reagieren und diese in bestehende Prozesse zu integrieren. Das Management sollte für Innovation genügend Ressourcen zur Verfügung stellen, so dass das Tagesgeschäft diese überhaupt zulässt. Weiter empfiehlt sich der Aufbau eines digitalen Ökosystems bestehend aus (Healthcare) Start-Ups, (Fach-)Hochschulen oder Universitäten. Damit erfolgreich digitalisiert werden kann, müssen zuerst Kern- und Routineprozesse entschlackt oder neu modelliert werden. Dann gilt es diese auf ihr Verbesserungspotenzial Prozessdigitalisierung durch digitale Technologien zu prüfen und optimieren. Durch die bessere Vernetzung von Systemen können Daten gesammelt werden, welche als Entscheidungsgrundlage bezüglich der (Weiter-)Entwicklung von neuen oder von bestehenden Angeboten und Services genutzt werden können. Der Aufbau einer Expertise bei der Datenanalyse ist angesichts des prognostizierten Potentials von Big Data für ein Spital in naher Zukunft praktisch unumgänglich. 79 Spitäler sind dazu angehalten, sich gegenüber den Trends aus der neuen Arbeitswelt mehr zu öffnen. Die Zusammenarbeit muss auch digital bereichsübergreifend gewährleistet und Wissen besser verfügbar gemacht werden. Hier drängt sich der Einsatz von Kollaborationsplattformen und die Ausweitung der Nutzung von mobilen Geräten und Technologien auf. Mitarbeitende Zusammenarbeit sollen sich nach Bedarf gezielt mit Digitalexperten austauschen, um selber digitales Wissen aufzubauen und an ihre Kollegen weiterzugeben. Ein gangbarer Weg ist die Definition einer allen zugänglichen, internen Anlaufstelle. Weiter sollten neue Arbeitsformen getestet werden, um die Kreativität und den Austausch zwischen Mitarbeitenden zu fördern. Die Zusammenarbeit mit Partnern und Lieferanten ist immer auch auf digitale Potenziale hin zu prüfen. Mit Blick auf die Zukunft sind strategische Partnerschaften, auch mit branchenfremden Unternehmen, einzugehen und vertikale wie horizontale Kollaborationen zu fördern. Spitäler tun gut daran, ihren IT-Bereich weiter zu stärken. Agile Projektmethoden sollen, auch ausserhalb der IT, bekannt gemacht und im Tagesgeschäft getestet werden. Die Infrastruktur muss weiter modernisiert und an die neuen Anforderungen angepasst werden. Cyberkriminalität gewinnt enorm an Bedeutung und will deshalb rechtzeitig antizipiert werden. Dem Datenschutz, der Datenqualität und der Informationstechnologie Datenverfügbarkeit müssen absolute Priorität beigemessen werden, damit das Vertrauen in die Spitäler auch in digitalen Belangen aufrechterhalten wird. Gerade Gesundheitsdaten sind äusserst schützenswert, weshalb Mitarbeitende noch besser auf den Umgang damit zu schulen sind. Schliesslich wollen auch die Patienten transparent und proaktiv über den Umgang mit ihren persönlichen Daten in Kenntnis gesetzt werden. Neue Technologien und Geräte sind laufend von der IT zu prüfen und in den Spitalalltag zu integrieren. Die sichere Vernetzung von Geräten und Systemen ist zu forcieren, so dass die Grundlage für ein «Spital 4.0» entstehen kann. 80 Die Unternehmenskultur spielt bei der digitalen Transformation eine äusserst wichtige Rolle. Digitales Knowhow sollte deshalb auf breiter Ebene aufgebaut werden. Das ist bei der Rekrutierung von neuen, sowie bei der Förderung von bestehenden Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Eigene digitale Angebote müssen im Unternehmen kommuniziert und bekannt gemacht werden. Auch beim Management ist eine digitale Grundhaltung zu Unternehmenskultur fordern und fördern. Es gilt, Betroffene zu Beteiligten zu machen und die Mitarbeitenden von Beginn an durch eine transparente Kommunikation mit auf die digitale Reise zu nehmen. Digitalisierung führt zu einer Veränderung von Berufsbildern, auch bei Ärzten und im Pflegebereich, worauf diese gut vorbereitet und allenfalls begleitet werden müssen. Widerstände sind mittels offenem Dialog abzubauen und die Veränderungsbereitschaft zu fördern, obwohl diese bei med. Personal schon relativ hoch ist. Erfolge mit digitalen Projekten sind, genau wie Misserfolge, intern offen zu kommunizieren. Das Zulassen einer Fehlerkultur, primär im nichtmedizinischen Bereich, erlaubt eine nüchterne Auswertung und zeitnahe Reaktion um (digitale) Prozesse und Lösungen zu verbessern. Die effektive digitale Transformation wird durch die Digitalisierung angestossen. Entscheidungsträger müssen sich die Frage stellen: «Lässt sich auch das Geschäftsmodell eines Spitals digitalisieren? Wenn ja, wie und in welchen Bereichen?». Hier drängt sich die Zuhilfenahme von externen Experten auf. Digitale Transformation sollte strategisch und zielgerichtet erfolgen und im Unternehmen verankert werden. Digitale Transformation Rollen, Zuständigkeiten und Entscheidungsprozesse müssen, wie messbare Ziele, definiert und periodisch überprüft werden. Entscheidend ist, dass sich die Spitäler bei der digitalen Transformation nicht überfordern, sondern dass sie unter Berücksichtigung der eigenen Fähigkeiten und in einem machbaren Tempo geschieht. Dafür sind vom Management genügend Ressourcen bereitzustellen. Von der Führungsebene werden deshalb Risikobereitschaft und der Wille, neue Wege zu gehen, erwartet. Schliesslich will auch die Eigenverantwortung aller Mitarbeitenden gefördert sein, um den digitalen Wandel erfolgreich zu vollziehen. 81 6.4. Zusammenfassung & Ausblick Den Spitälern stehen turbulente Zeiten bevor: der Wettbewerb verschärft sich, die Gesellschaft altert, die Gewinne stagnieren, der Fachkräftemangel nimmt zu und es drängen neue Akteure in den Markt. Parallel dazu schreitet die Digitalisierung rapide voran und sie wird auch für med. Leistungserbringer immer besser spürbar. Obwohl eine effektive Disruption durch digitale Technologien bislang noch eher selten festzustellen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Wertschöpfungskette der Spitäler früher oder später sukzessive aufgebrochen wird. Im digitalen Zeitalter zeichnet sich die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen deshalb zunehmend durch Agilität, Innovationsstärke und Veränderungsbereitschaft aus, was auch auf Spitäler zutrifft. Deren Entscheidungsträger sind nun gefordert, Visionen für ihre Organisation zu entwickeln, ihr Geschäftsmodell kritisch auf digitale Potenziale zu überprüfen und eine digitale Unternehmenskultur entstehen zu lassen. Zuerst muss intern ein gemeinsames Verständnis für die Chancen und Gefahren der Digitalisierung entwickelt werden. Dazu muss das Bewusstsein dafür über alle Ebenen hinweg gefördert werden. Dann ist eine digitale Bestandsaufnahme vorzunehmen, um Stärken und Schwächen sichtbar zu machen. Daraus lassen sich für die unterschiedlichen digitalen Themenfelder konkrete Massnahmen ableiten. In einem nächsten Schritt muss die Grundlage für digitale Prozesse und Technologien geschaffen werden, was heisst, dass Strukturen und Abläufe bereinigt und vereinfacht werden sollen. Wenn Spitäler ihre eigenen Mittel und Fähigkeiten in Bezug auf die Digitalisierung realistisch einschätzen und diese einem strategischen Plan mit klaren Zielen folgt, so sind die Aussichten gut, um auch künftig konkurrenzfähig zu bleiben. Spitäler, denen diese Transformation am besten gelingt, werden unweigerlich Wettbewerbsvorteile erlangen. Dank dem Einsatz von neuen Technologien und einer zunehmenden Kompetenz im Umgang mit bzw. der Analyse und Nutzung von Daten, werden sie schneller, präziser und effizienter. Ihre Vernetzung mit einem digitalen Gesundheits-Ökosystem, die Zusammenarbeit mit Start-Ups oder Universitäten und strategische Partnerschaften horizontaler wie vertikaler Art, erlauben ihnen die Umsetzung von innovativen Geschäftsideen und die Entwicklung von neuen Geschäftsfeldern. Damit werden Spitäler nicht nur die zunehmende Erwartungshaltung von Patienten übertreffen und wo möglich neue Zielgruppen erschliessen, sondern gleichzeitig als attraktiver Arbeitgeber neue Talente und Fachkräfte anziehen. Um all dies möglich zu machen, bedarf es die Unterstützung des Staates. Er muss eine gemeinsame Vision für das Schweizer Gesundheitswesen entwickeln, disruptive Tendenzen zulassen, für ein innovationsfreundliches Branchenumfeld sorgen und gezielt Anreize für mehr Investitionen in digitale Projekte und Technologien setzen. Erst dann wird dank der Digitalisierung auch ein Paradigmenwechsel von einem system- zu einem patientenfokussierten Ansatz forciert und die angestrebte «Humanisierung der Medizin» ermöglicht, welche hoffentlich nicht nur zu einem besseren, sondern auch zu einem günstigeren Gesundheitswesen für alle Beteiligten führt. 82 7. Dank Im Entstehungsprozess dieser Master-Thesis erhielt ich wertvolle Inputs und Unterstützung von verschiedenen Personen. Gerne möchte ich an dieser Stelle einige wichtige Personen namentlich erwähnen. Meinen Betreuer, Herr Sven Ruoss, für seine fortwährende Unterstützung im gesamten Entstehungsprozess, seine hilfreichen Tipps und die stets aufmunternden Worte. Herr Raphael Frangi, Herr Prof. Dr. Alfred Angerer, Herr Yves Laukemann und Herr Stefan Märke für ihre geschätzte Zeit, das Teilen ihrer Fachkenntnisse und die wertvollen Praxisinputs. Im Rahmen der durchzuführenden Experteninterviews durfte ich mit ihnen vier äusserst inspirierende Gespräche führen. Meinen Eltern für Ihre grosse Rücksichtnahme auf meine berufliche Situation und Auslastung und ihre immerwährende mentale Unterstützung. Meine Partnerin, Frau Nina Rajcic, für ihre Inputs bei der Auswertung, ihre Geduld und das grosse Verständnis, welche sie mir während der Erstellung der Masterarbeit entgegengebracht hat. 83 8. Anhang 8.1. Quellen- und Literaturverzeichnis Angerer, A. (2018, März 9). Interview mit dem Leiter Management im Gesundheitswesen (ZHAW School of Management and Law) zum Thema Digitalisierung im Gesundheits- und Spitalwesen. Atteslander, P. (2010). Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. Back, A., & Berghaus, S. (2016). Digital Maturity & Transformation Studie. Über das Digital Maturity Model. (Version 2.0 - November 2016). Abgerufen am 04. April 2018, von https://aback.iwi.unisg.ch/fileadmin/projects/aback/web/pdf/digitalmaturitymodel_download_v2.0 .pdf Back A., Berghaus, S., & Kaltenrieder, B. (2015). Digital Maturity & Transformation Report 2015. St.Gallen. Back A., Berghaus, S., & Kaltenrieder, B. (2017). Digital Maturity & Transformation Report 2017. St.Gallen. BAG - Bundesamt für Gesundheit. (2013). Bericht Gesundheit 2020. Die gesundheitspolitischen Prioritäten des Bundesrates. Bern. BAG - Bundesamt für Gesundheit. (2017). Kennzahlen der Schweizer Spitäler 2015. Abgerufen am 27. Dezember 2017, von http://www.baganw.admin.ch/2016_taglab/2016_spitalstatistik/data/download/kzp15_publikation.pdf Bartsch, S., Engel, U., Schnabel, C., & Vehre, H. (2012). Wissenschaftliche Umfragen. Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH. BDI und Roland Berger. (2015). Die digitale Transformation der Industrie. Abgerufen am 08. April 2018, von http://www.connected-living.org/content/4-information/4-downloads/4-studien/15-die-digitaletransformation-der-industrie-maerz-2015-quelle-bdi-roland-bergerstrategyconsultants/roland_berger_analysen_zur_studie_digitale_transformation_20150317.pdf 84 Becker, W., & Ulrich, P. (2015). BWL im Mittelstand. (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. Berekoven, L., Eckert, W., & Ellenrieder, P. (2009). Marktforschung. Methodische Grundlagen und praktische Anwendungen. (12. Auflage), Wiesbaden: Gabler GWV Fachverlage GmbH. Bfs - Bundesamt für Statistik. (2017a). Krankenhausstatistik: Standardtabellen 2016. Abgerufen am, 27. Dezember 2017, von https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/infrast ruktur-beschaeftigung-finanzen.assetdetail.3722885.html Bfs - Bundesamt für Statistik. (2017b). Spitäler. Abgerufen am, 27. Dezember 2017, von https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler.html Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (2014). Interviews mit Experten: Eine praxisorientierte Einführung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. BSP Business School Berlin. (2016). Mittelstand im Wandel – Wie ein Unternehmen seinen digitalen Reifegrad ermitteln kann. Abgerufen am 08. April 2018, von http://kommunikation-mittelstand.digital/content/uploads/2017/01/Leitfaden_Ermittlung-digitalerReifegrad.pdf CareerBuilder. (2011). Mobile Working: Mein Schreibtisch ist auch deiner - oder kein Schreibtisch? Abgerufen am 20. Juni 2018, von https://arbeitgeber.careerbuilder.de/blog/mobile-working-siemens-office_ Clinicum. (2015). Hinken Schweizer Spitäler der digitalen Transformation hinterher? Abgerufen am 22. Dezember 2017, von http://www.clinicum.ch/images/getFile?t=ausgabe_artikel&f=dokument&id=1102 coworkit. (2016). Coworking – was ist das? Abgerufen am 20. Juni 2018, von https://coworkit.de/2016/06/02/was-ist-coworking-definition 85 De Bruin, T., & Rosemann, M. (2005). Towards a Business Process Management Maturity Model. In Bartmann, D., Rajola, F., Kallinikos, J., Avison., D, Winter, R., Ein-Dor, P., et al. (Eds.). ECIS 2005 Proceedings of the Thirteenth European Conference on Information Systems, 26 - 28 May 2005. Regensburg. Deloitte Digital, & Heads!. (2015). Überlebensstrategie «Digital Leadership». Abgerufen am 26. Dezember 2017, von https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/strategy/ueberlebensstrategiedigital-leadership_final.pdf Diehl, A. (o. J.). Digitale Transformation: Ein Unternehmen kann nicht kein digitales Unternehmen sein. Abgerufen am 08. April 2018, von https://digitaleneuordnung.de/blog/digitale-transformation-unternehmen Digital Wiki. (2016). Chatbots. Abgerufen am 20. Juni 2018, von http://www.digitalwiki.de/chatbots digital.swiss. (2017). Mittels ICT zu neuen, vernetzten Angeboten im Gesundheitswesen. Abgerufen am 28. Dezember 2017, von https://digital.swiss/de/themen/gesundheit Dirks, T. (o.J.). Die besten IT-Sprüche 2015. Abgerufen am 12. Mai 2018, von https://www.computerwoche.de/g/die-besten-it-sprueche-2015,106507,3 Drucker, P. (o.J.). «Culture eats strategy for breakfast!». Abgerufen am 12. Mai 2018, von https://der-leiterblog.de/2018/02/22/culture-eats-strategy-for-breakfast-peter-drucker economiesuisse und Think Tank W.I.R.E. (2017). Zukunft digitale Schweiz. Wirtschaft und Gesellschaft weiterdenken. Abgerufen am 22. Dezember 2017, von https://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/publications/20170822_Zukunft-digitaleSchweiz_Web.pdf 86 eHealth Suisse. (2017). Factsheet «Wer muss ein EPD anbieten»? Abgerufen am 28. Dezember 2017, von https://www.e-healthsuisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/D/170804_Wer_muss_ein_EPD_anbieten_d. pdf eHealth Suisse. (2018). Die Gesundheitsinfos. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Abgerufen am 20. Juni 2018, von https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/D/180301_EPDBroschuere_Gesundheitsfachpersonen_d.pdf Egeli, M. (2016). Erfolgsfaktoren von Mobile Business. (1. Auflage). Wiesbaden: Springer Vieweg. ehealthsuisse. (2018). Strategie eHealth Schweiz 2.0. 2018 - 2022. Abgerufen am 17. April 2018, von https://www.e-healthsuisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/D/180214_Strategie_eHealth_2.0_Version_D ialog_NGP_d.pdf Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik. (2016). Digitalisierung. Abgerufen am, 01. April 2018, von http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/lexikon/technologienmethoden/Informatik--Grundlagen/digitalisierung Fasel, D., & Meier, A. (2016). Big Data: Grundlagen, Systeme und Nutzungspotenziale. (Edition HMD). Wiesbaden: Springer Vieweg. FHNW. (2017). Die 7 Handlungsfelder der digitalen Transformation. Abgerufen am 09. April 2018, von https://kmu-transformation.ch/handlungsfelder Frangi, R. (2018, März 6). Interview mit dem Senior Marketing Manager (Swisscom Health AG) zum Thema Digitalisierung im Gesundheits- und Spitalwesen. Gabler. (2018a). Gabler Wirtschaftslexikon: Disruptive Technologien. Abgerufen am 17. April 2018, von https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/disruptive-technologien-54194/version-277246 87 Gabler. (2018b). Gabler Wirtschaftslexikon: Expertenwissen. Abgerufen am 17. April 2018, von https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/expertenwissen-34831/version-258324 Gartner. (2016). Gartner IT Glossary. Abgerufen am 08. April 2018, von https://www.gartner.com/it-glossary/digitalization Gläser, J., & Laudel, G. (2010). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen. (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag. Gründerszene. (o.J.). Blockchain. Abgerufen am 20. Juni 2018, von https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/blockchain Heydasch, T., Renner, K.-H., Ströhlein, G. (2012). Idealtypischer Ablauf einer empirischen Untersuchung. In: Forschungsmethoden der Psychologie. Basiswissen Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag. Hille M., Janata S., & Michel, J. (2016). Leitfaden Digitalisierung: Strategien, Technologien und Ökosysteme. Abgerufen am 22. Dezember 2017, von https://digitales-wirtschaftswunder.de/wp-content/uploads/2016/10/Leitfaden_Digitalisierung.pdf Hirslanden. (o.J.). Operationstrakt und Infrastruktur. Abgerufen am 20. Juni 2018, von https://www.hirslanden.ch/de/klinik-hirslanden/aerzte-und-pflege/op-undinterventionsraeume/operationstrakt-und-infrastruktur.html Hofer-Frei, S. (2015). Das Spital von morgen. Abgerufen am 02. Januar 2018, von https://www.avenir-suisse.ch/das-spital-von-morgen Hussy, W., Schreier, M., & Echterhoff, G. (2010). Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. (o. J.). MAS Digital Business. Abgerufen am 17. April 2018, von https://fh-hwz.ch/produkt/mas-digital-business 88 Institute for Digital Business. (o.J.). Digital Switzerland 2017. Abgerufen am 17. Februar 2018, von https://www.digital-switzerland.ch/digital-switzerland-2017 Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität St.Gallen. (2016). Umfrage zur Digital Maturity & Transformation Studie 2016-2017. Abgerufen am 02. Januar 2018, von https://aback.iwi.unisg.ch/fileadmin/projects/aback/web/pdf/fragebogen_digital_maturity_check.p df Jordan Consulting. (o.J.). Erklärung Lean. Abgerufen am 20. Juni 2018, von http://lean-stammtisch.ch/erklaerung-lean Konradin Medien. (o.J.). Buzzword. Abgerufen am 20. Juni 2018, von https://www.wissen.de/fremdwort/buzzword Kornmeier, M. (2016). Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht. (7. Auflage). Bern: Haupt Verlag. KMPG (2017). Clarity on Healthcare: Digitalisierung: Wo liegen die Potenziale für das Gesundheitswesen? Abgerufen am 17. März 2018, von https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/clarity-on-healthcare-2017-de.pdf Lammenett, E. (2017). Amazon als Beispiel für die Macht der Platform Economy. Abgerufen am 20. Juni 2018, von https://www.lammenett.de/div/amazon-als-beispiel-fuer-die-macht-der-platform-economy.html Lamnek, S. (2005). Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch (4. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag. Laukemann, Y. (2018, März 15). Interview mit dem Leiter Applikationsmanagement (St. Claraspital, Basel) zum Thema Digitalisierung im Gesundheits- und Spitalwesen. Lindner, D. (2017). Was ist eigentlich Digital Leadership? Abgerufen am 20. Juni 2018, von http://agile-unternehmen.de/was-ist-digital-leadership 89 Litzel, N. (2017). BigData Insider - Definition «Was ist digitale Transformation». Abgerufen am 02. April 2018, von https://www.bigdata-insider.de/was-ist-digital-transformation-a-626446 Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. (12., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag. Märke, S. (2018, März 16). Interview mit dem Consultant Lean Hospital (Walkerproject AG) zum Thema Digitalisierung im Gesundheits- und Spitalwesen. Microsoft. (2017). Digitalisierung im Schweizer Gesundheitswesen. Abgerufen am 15. März 2018, von http://www.scheuss-partner.ch/wp-content/uploads/2018/01/Ebook_Gesundheitswesen.pdf MoneyToday.ch. (2018a). Digitalisierung & Digitale Transformation (Unterschied). Abgerufen am 08. April 2018, von https://www.moneytoday.ch/lexikon/digitalisierung MoneyToday.ch. (2018b). Digitalisierung & Digitale Transformation (Unterschied). Abgerufen am 08. April 2018, von https://www.moneytoday.ch/lexikon/digitalisierung-digitale-transformation Moser, D. (2016). Industrie 4.0 – Eine Einführung. Abgerufen am 17. März 2018, von http://www.wertblog.ch/blog/industrie-4-0 MSM Research AG. (2017). eHealth: Die digitale Transformation erreicht das Gesundheitswesen. Abgerufen am 27. Dezember 2017, von http://documents.swisscom.com/product/1000174Internet/Documents/Downloadcenter/MSM2017_WhitePaper_eHealth_Swisscom.pdf Naisbitt, J., & Aburdene, P. (1992). Megatrends 2000. Zehn Perspektiven für das neue Jahrtausend. Düsseldorf, Wien, New York: Econ Verlag. Neff, A., Hamel, F., Herz, T.P., Uebernickel, F., Brenner, W., & vom Brocke, J. (2014). Developing a Maturity Model for Service Systems in Heavy Equipment Manufacturing Enterprises. Information & Management, 51(7). New York: Elsevier. 90 Peter, M. K. (2017). KMU Transformation. Als KMU die Digitale Transformation erfolgreich umsetzen. (1. Auflage). Olten: FHNW PWC. (2014). Industrie 4.0 – Chancen und Herausforderungen der vierten industriellen Revolution. Abgerufen am 17. März 2018, von https://www.pwc.ch/de/publications/2016/pwc_studie_industrie_d.pdf PWC, Google Switzerland GmbH, & digitalswitzerland. (2016). Digitalisierung – wo stehen Schweizer KMU? Abgerufen am 17. April 2018, von https://www.pwc.ch/de/publications/2016/pwc_digitalisierung_wo_stehen_schweizer_kmu.pdf PWC. (2017). CEO Survey Spitalmarkt Schweiz 2017. Trends und Herausforderungen für Schweizer Spitäler und Kliniken. Abgerufen am 28. Dezember 2017, von https://www.pwc.ch/de/publications/2017/ceo-survey-spitalmarkt-schweiz-2017-de-web.pdf Reker, J., & Böhm, K. (2013). Digitalisierung im Mittelstand. Abgerufen am 08. April 2018, von https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/Mittelstand/Digitalisierung-imMittelstand.pdf Roland Berger. (2017.) Krankenhausstudie 2017. Abgerufen am 29. Dezember 2017, von https://www.rolandberger.com/de/Publications/pub_german_hospitals_2017.html Röbken, H., & Wetzel, K. (2016). Qualitative und quantitative Forschungsmethoden. Abgerufen am 04. Mai 2018, von https://www.unioldenburg.de/fileadmin/user_upload/c3l/Studiengaenge/BABusinessAdmin/Download/Leseprob en/bba_leseprobe_quli_quanti_forschungsmethoden.pdf santésuisse. (2016). Ambulant vor stationär. Das Sparpotenzial ist erkannt. Abgerufen am 02. Januar 2018, von, http://www.santesuisse.ch/de/details/content/ambulant_vor_stationaer_das_sparpotenzial_ist_e rkannt SAMW. (2017). eHealth: Wohin führt uns die Digitalisierung des Gesundheitssystems? (Bulletin 01/2017). Basel. 91 Scheibler, P. (o. J.). Qualitative versus quantitative Forschung. Abgerufen am 04. Mai 2018, von https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/qualitative-quantitative-forschung.html Sigrist, S. (2006). GDI Studie. Zukunftsperspektiven des Gesundheitsmarkts. Abgerufen am 24. April 2018, von https://www.collegium.ethz.ch/fileadmin/user_upload/ch_pdfs/06_edi_sigrist.pdf Stark, J. (2018). Das sind die Top-5-Ziele bei der Digitalisierung Schweizer Firmen. Abgerufen am 17. April 2018, von https://www.computerworld.ch/business/studie/top-5-ziele-digitalisierung-schweizer-firmen1472308.html SurveyMonkey. (2018). Erstellen verschiedener Umfragetypen. Abgerufen am 26.03.2018, von https://www.surveymonkey.de/mp/survey-types SurveyMonkey. (o.J.). Stichprobenkalkulator. Abgerufen am 27.03.2018, von https://www.surveymonkey.de/mp/sample-size-calculator Swisscom. (o. J.). Geschichte der Digitalisierung: schneller, intelligenter, vernetzter: Die vierte industrielle Revolution. Abgerufen am 17. März 2018, von https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/themen/digital-business/geschichte-derdigitalisierung.html Swisscom. (2016). Herausforderungen für Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Schweiz, Bern: Swisscom. Abgerufen am 02 Januar 2018, von https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/downloads/health/herausforderungen-fuerleistungserbringer-health.html swissdrg. (2017). SwissDRG. Abgerufen am 02. Januar 2018, von https://www.swissdrg.org/de/akutsomatik/swissdrg 92 Talin, B. (2018). Die digitale Transformation der Industrie. Digitalisierung vs. Digitale Transformation - Wo liegt der Unterschied? Abgerufen am 21. April 2018, von https://morethandigital.info/digitalisierung-vs-digitale-transformation-wo-liegt-der-unterschied Thönnessen, F. (2018). Was ist Digitalisierung? Der digitale Wandel erklärt. Abgerufen am 08. April 2018, von https://felixthoennessen.de/blog/was-ist-digitalisierung Trawnicek, P. (o.J.). Digitalisierung – nicht nur neue Technik, sondern neue Denkweisen und neue Beratungsansätze sind gefragt. Abgerufen am 12. Mai 2018, von https://change-management-hamburg.com/digitalisierung-nicht-nur-neue-technik-sondern-neuedenkweisen-und-neue-beratungsansaetze-sind-gefragt UniversitätsSpital Zürich. (o.J.). Multimorbidität. Abgerufen am 20. Juni 2018, von http://www.inneremedizin.usz.ch/fachwissen/Seiten/multimorbiditaet.aspx ZHAW. (2016). Das Schweizer Spitalwesen. Eine Managementperspektive. Abgerufen am 23. Dezember 2017, von https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/1192/1/Spitalstudie%20Digital%20Collection.p df ZHAW. (2017). Digital Health. Die Zukunft des Schweizer Gesundheitswesens. Abgerufen am 22. Dezember 2017, von https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/1458/1/Digital%20Health%20Report_DC_2017 _11_08.pdf Zukunftsinstitut. (o.J.). Bioprinting: Der gedruckte Mensch. Abgerufen am 20. Juni 2018, von https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/bioprinting-der-gedruckte-mensch 93 8.2. Abkürzungsverzeichnis BAG Bundesamt für Gesundheit bzw. beziehungsweise ca. circa CAS Certificate of Advanced Studies CRM Customer Relationship Management d.h. das heisst engl. englisch EPD elektronisches Patientendossier et al. et alii («und andere») etc. et cetera («und die übrigen») ff folio («folgende») FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich IT / ICT Informations- und Kommunikationstechnologie KMU Kleine und mittlere Unternehmen MAS Master of Advanced Studies med. medizinisch o.J. ohne Jahr PWC PricewaterhouseCoopers SAMW Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften vgl. vergleiche z.B. zum Beispiel ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 94 8.3. Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Entwicklungsstufen von Industrie 1.0 zu Industrie 4.0 ............................................. 1 Abbildung 2: Die 4 Phasen der digitalen Transformation .............................................................. 9 Abbildung 3: Die 7 Handlungsfelder der Transformation ............................................................ 10 Abbildung 4: Die neun Dimensionen des Digital Maturity Model (eigene Darstellung)............... 11 Abbildung 5: Disruption Map nach Industrien ............................................................................. 18 Abbildung 6: Das WIG-Ordnungsmodell ..................................................................................... 19 Abbildung 7: Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse.................................................................... 39 Abbildung 8: Teilnehmende nach Abteilung und Position (n = 144) ........................................... 42 Abbildung 9: Teilnehmende nach Spitaltyp (n = 144) ................................................................. 43 Abbildung 10: Zugehörigkeit zu Spitalgruppe/Spitalnetz (n = 144) ............................................. 43 Abbildung 11: Teilnehmende nach Spitalgrösse (n = 144) ......................................................... 44 Abbildung 12: Relevanz der Digitalisierung in der Spitalbranche (n = 208) ................................ 45 Abbildung 13: Relevanz der Digitalisierung im Unternehmen (n = 208) ..................................... 46 Abbildung 14: Vorhandensein einer Digitalstrategie (n = 208).................................................... 47 Abbildung 15: Zuständigkeit für die Digitalisierung (n = 208)...................................................... 47 Abbildung 16: Dimension «Patientenerlebnis» (n = 187) ............................................................ 49 Abbildung 17: Dimension «Produktinnovation» (n = 174) ........................................................... 50 Abbildung 18: Dimension «Digitalstrategie» (n = 168) ................................................................ 51 Abbildung 19: Dimension «Organisation» (n = 165) ................................................................... 53 Abbildung 20: Dimension «Prozessdigitalisierung» (n = 154)..................................................... 54 Abbildung 21: Dimension «Zusammenarbeit» (n = 151)............................................................. 55 Abbildung 22: Dimension «Informatik & Technologie (ICT)» (n = 149) ...................................... 57 Abbildung 23: Dimension «Digitale Unternehmenskultur» (n = 147) .......................................... 58 Abbildung 24: Dimension «Digitale Transformation (n = 145) .................................................... 59 Abbildung 25: Einsatz von disruptiven Technologien (n = 145) .................................................. 63 Abbildung 26: Hemmfaktoren der Digitalisierung (n = 145) ........................................................ 64 Abbildung 27: Einladung zur Teilnahme an der Online-Umfrage................................................ 98 Abbildung 28: Online-Umfrage (Infos zur Umfrage) .................................................................... 99 Abbildung 29: Online-Umfrage (Fragen 1 & 2)............................................................................ 99 Abbildung 30: Online-Umfrage (Fragen 3 & 4).......................................................................... 100 Abbildung 31: Online-Umfrage (Frage 5) .................................................................................. 100 Abbildung 32: Online-Umfrage (Frage 6) .................................................................................. 101 Abbildung 33: Online-Umfrage (Frage 7) .................................................................................. 102 Abbildung 34: Online-Umfrage (Frage 8) .................................................................................. 103 Abbildung 35: Online-Umfrage (Frage 9) .................................................................................. 104 Abbildung 36: Online-Umfrage (Frage 10) ................................................................................ 105 Abbildung 37: Online-Umfrage (Frage 11) ................................................................................ 106 Abbildung 38: Online-Umfrage (Frage 12) ................................................................................ 107 Abbildung 39: Online-Umfrage (Frage 13) ................................................................................ 108 95 Abbildung 40: Online-Umfrage (Frage 14) ................................................................................ 109 Abbildung 41: Online-Umfrage (Frage 15) ................................................................................ 110 Abbildung 42: Online-Umfrage (Frage 16) ................................................................................ 111 Abbildung 43: Online-Umfrage (Fragen 17 & 18)...................................................................... 111 Abbildung 44: Online-Umfrage (Fragen 19 & 20)...................................................................... 112 Abbildung 45: Online-Umfrage (Fragen 21 & 22)...................................................................... 112 Abbildung 46: Online-Umfrage (Frage 23 & 24)........................................................................ 113 Abbildung 47: Patientenerlebnis nach Spitaltyp (eigene Darstellung) ...................................... 114 Abbildung 48: Produktinnovation nach Spitaltyp (eigene Darstellung) ..................................... 114 Abbildung 49: Digitalstrategie nach Spitaltyp (eigene Darstellung) .......................................... 114 Abbildung 50: Organisation nach Spitaltyp (eigene Darstellung).............................................. 115 Abbildung 51: Prozessdigitalisierung nach Spitaltyp (eigene Darstellung) ............................... 115 Abbildung 52: Zusammenarbeit nach Spitaltyp (eigene Darstellung) ....................................... 115 Abbildung 53: Informatik & Technologie ICT nach Spitaltyp (eigene Darstellung) ................... 116 Abbildung 54: Digitale Unternehmenskultur nach Spitaltyp (eigene Darstellung) .................... 116 Abbildung 55: Digitale Transformation nach Spitaltyp (eigene Darstellung) ............................. 116 Abbildung 56: Patientenerlebnis nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) ................................ 117 Abbildung 57: Produktinnovation nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) ............................... 117 Abbildung 58: Digitalstrategie nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) .................................... 117 Abbildung 59: Organisation nach Spitalgrösse (eigene Darstellung)........................................ 117 Abbildung 60: Prozessdigitalisierung nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) ......................... 118 Abbildung 61: Zusammenarbeit nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) ................................. 118 Abbildung 62: Informatik & Technologie ICT nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) ............. 118 Abbildung 63: Digitale Unternehmenskultur nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) .............. 118 Abbildung 64: Digitale Transformation nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) ....................... 119 Abbildung 65: Anfrage für Experteninterviews .......................................................................... 120 96 8.4. Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Forschungsfragen der Masterarbeit in der Übersicht (eigene Darstellung) ................. 3 Tabelle 2: Aufbau der Masterarbeit (eigene Darstellung) ............................................................. 5 Tabelle 3: Trends und Entwicklungen im Gesundheitswesen (Eigene Darstellung) .................. 26 Tabelle 4: Schritte im Forschungsprozess (eigene Darstellung) ................................................ 28 Tabelle 5: Zu untersuchende Hypothesen (eigene Darstellung)................................................. 29 Tabelle 6: Die Gliederung der Online-Umfrage im Überblick (eigene Darstellung) .................... 34 Tabelle 7: Reifegrad der Kliniken und Spitäler (eigene Darstellung) .......................................... 60 Tabelle 8: Reifegrad nach Spitaltypen (eigene Darstellung)....................................................... 61 Tabelle 9: Reifegrad nach Spitalgrösse (eigene Darstellung)..................................................... 62 97 8.5. Online-Umfrage 8.5.1. Anfrage zur Teilnahme an der Online-Umfrage Der Autor hat sämtliche 216 Deutschschweizer Spitäler per E-Mail zur Teilnahme an der OnlineUmfrage eingeladen (Abbildung 27). Abbildung 27: Einladung zur Teilnahme an der Online-Umfrage 98 8.5.2. Online Fragebogen Die Teilnehmer der Online-Umfrage mussten diesen Fragebogen mit total 24 Fragen (Abbildungen 28 bis 46) ausfüllen. Abbildung 28: Online-Umfrage (Infos zur Umfrage) Abbildung 29: Online-Umfrage (Fragen 1 & 2) 99 Abbildung 30: Online-Umfrage (Fragen 3 & 4) Abbildung 31: Online-Umfrage (Frage 5) 100 Abbildung 32: Online-Umfrage (Frage 6) 101 Abbildung 33: Online-Umfrage (Frage 7) 102 Abbildung 34: Online-Umfrage (Frage 8) 103 Abbildung 35: Online-Umfrage (Frage 9) 104 Abbildung 36: Online-Umfrage (Frage 10) 105 Abbildung 37: Online-Umfrage (Frage 11) 106 Abbildung 38: Online-Umfrage (Frage 12) 107 Abbildung 39: Online-Umfrage (Frage 13) 108 Abbildung 40: Online-Umfrage (Frage 14) 109 Abbildung 41: Online-Umfrage (Frage 15) 110 Abbildung 42: Online-Umfrage (Frage 16) Abbildung 43: Online-Umfrage (Fragen 17 & 18) 111 Abbildung 44: Online-Umfrage (Fragen 19 & 20) Abbildung 45: Online-Umfrage (Fragen 21 & 22) 112 Abbildung 46: Online-Umfrage (Frage 23 & 24) 113 8.5.3. Auswertungen pro Dimension nach Spitaltyp Zur Dokumentation der Umfrageresultate sind hier die Resultate pro Dimension nach Spitaltypen einzusehen (Abbildungen 47 bis 55). Abbildung 47: Patientenerlebnis nach Spitaltyp (eigene Darstellung) Abbildung 48: Produktinnovation nach Spitaltyp (eigene Darstellung) Abbildung 49: Digitalstrategie nach Spitaltyp (eigene Darstellung) 114 Abbildung 50: Organisation nach Spitaltyp (eigene Darstellung) Abbildung 51: Prozessdigitalisierung nach Spitaltyp (eigene Darstellung) Abbildung 52: Zusammenarbeit nach Spitaltyp (eigene Darstellung) 115 Abbildung 53: Informatik & Technologie ICT nach Spitaltyp (eigene Darstellung) Abbildung 54: Digitale Unternehmenskultur nach Spitaltyp (eigene Darstellung) Abbildung 55: Digitale Transformation nach Spitaltyp (eigene Darstellung) 116 8.5.4. Auswertungen pro Dimension nach Spitalgrösse Zur Dokumentation der Umfrageresultate sind hier die Resultate pro Dimension nach Spitalgrösse einzusehen (Abbildungen 56 bis 64). Abbildung 56: Patientenerlebnis nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) Abbildung 57: Produktinnovation nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) Abbildung 58: Digitalstrategie nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) Abbildung 59: Organisation nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) 117 Abbildung 60: Prozessdigitalisierung nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) Abbildung 61: Zusammenarbeit nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) Abbildung 62: Informatik & Technologie ICT nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) Abbildung 63: Digitale Unternehmenskultur nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) 118 Abbildung 64: Digitale Transformation nach Spitalgrösse (eigene Darstellung) 119 8.6. Experteninterviews 8.6.1. Anfrage zur Teilnahme an den Experteninterviews Die Experten wurden vom Studierenden per E-Mail für die Teilnahme an den Interviews angefragt (Abbildung 28). Abbildung 65: Anfrage für Experteninterviews 120 8.6.2. Leitfaden Experteninterviews Der Leitfaden für die Experteninterviews enthält sämtliche Eckdaten und Fragen, welche der Autor im Rahmen der vier Gespräche verwendet oder gestellt hat. Gliederung Inhalte Zeit Begrüssung und Herzlichen Dank für das Gespräch und dass Sie sich Zeit 5’ Projektbeschreibung nehmen für mich. Vorstellung Stefan Lienhard und Idee, welche hinter der MAS-Arbeit steckt. Präsentation der Forschungsfrage und Grund für Interview (wie werden die Aussagen verwendet --> Ablage und Veröffentlichung). Einstieg Erklärung Aufbau des Interviews Interview in DE wird aufgezeichnet und transkribiert Hinweis, dass NICHT anonym Dauer = ca. 40 Minuten Start der Aufnahme o Tag, Datum, Uhrzeit o WER interviewt WEN Interviewpartner erklärt seinen Werdegang, seine Funktion 3’ und seinen Aufgabenbereich. Leitfrage: «Das Gesundheitswesen ist in heftiger 10’ Bewegung: politisch, technologisch und kulturell. Themenblock «Digitalisierung im Gesundheits- und Spitalwesen» Welches sind die relevantesten Trends und Entwicklungen? Wie steht es um die Digitalisierung der Schweizer Gesundheitsbranche?» Frage: Ist die Schweizer Gesundheitsbranche schon von der Digitalisierung erfasst worden? Backup: Wenn JA: Wie zeigt sich dies? / Wenn NEIN: Wieso nicht? 121 Frage: Welche interessanten Projekte & Initiativen sind Ihnen bekannt? Backup: Gibt es in der Branche Leuchtturm-Projekte? Frage: Welche Trends gibt es in der Gesundheits- und Spitalbranche? Backup: Gibt es neue Technologien welche sich etablieren, z.B. Roboter oder das Internet of Things? Frage: Wie schätzen Sie das generelle Disruptionspotenzial im Gesundheitswesen ein? Backup: Eine von Deloitte und Heads! (Agentur) 2015 veröffentlichte Studie, prophezeit dem Gesundheitswesen, dass es gegenüber anderen Branchen (z.B. Banken) erst spät, dafür umso heftiger von der «Disruption» erfasst wird. Frage: Was bedeutet diese Entwicklung (Disruption) konkret für die CH-Leistungserbringer? Backup: Müssen z.B. Spitäler wegen Google, Amazon & Co. oder neuen Marktteilnehmern (Health Start-Ups) um ihre Existenz bangen? Leitfrage: «Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung 10’ auf die Unternehmenskultur im Spital? Wie verändern sich Berufsbilder, die Aus- und Weiterbildung oder die tägliche Arbeit?» Themenblock «Kultur» Frage: Welche kulturellen Herausforderungen bringt die Digitalisierung im Spital? Frage: Wo und wie sollte das Thema «digitale Transformation» organisatorisch im Spital verankert werden? 122 Backup: «Top-Down» vs. «Bottom-Up»? In einer speziellen Abteilung? C-Level, IT, Innovationsmanagement? Frage: Digitaler Fortschritt erfordert von Arbeitnehmern ein Umdenken und den Aufbau von neuen Fähigkeiten. Welche sind das im Spital? Backup: Ärzte? Pflege? Direktion? --> die Bedienung von Robotern, die Analyse von «Big Data» etc. Frage: Die Digitalisierung vernichtet Jobs heisst es vielerorts. Andere behaupten, dass damit neue Jobs geschaffen werden. Wie steht es um die Spitalberufe? Backup: Werden Jobs verschwinden? Welche neuen könnten entstehen? Frage: Was bedeutet die Digitalisierung für die Aus- und Weiterbildung im med. Bereich? Backup: Welches Knowhow wird für die digitale Entwicklung im Spital benötigt? Frage: Sind die med. Fachpersonen (Ärzte & Pflege) bereit für die Digitalisierung im Spital? Backup: Welches Mindset wird für die digitale Entwicklung im Spital benötigt? Leitfrage: «Wie verändert die Digitalisierung auch das 10’ Geschäftsmodell eines Spitals? In welchen Bereichen Themenblock «Business & Technologie» drängen sich Kooperationen auf? Was wird künftig ausgelagert? Welche Dienstleistungen bietet das Spital der Zukunft an?» Frage: «Daten sind das Gold der Neuzeit». Im Spital werden viele höchst sensitive Daten generiert. Was bedeutet das für das künftige Geschäftsmodell? 123 Backup: Wird im Zeitalter von Amazon, Facebook & Co. (Stichwort «Platform Economy») das Spital zu einem Marktplatz für Gesundheitsdaten? Frage: Welche Ressourcen sind erforderlich, damit ein Spital die Digitalisierung erfolgreich angehen kann? Backup: Technologisch, Finanziell, Mitarbeitende… Frage: Sind die Patienten bereit für digitale Angebote und Services im Spital? Backup: Lassen sie sich z.B. von Robotern operieren und, künftig, auch pflegen? Frage: Welche medizinischen Technologie-Trends schätzen Sie für Spitäler als besonders relevant ein? Backup: IoT, Robotics, VR… Frage: Vielfach wird das elektronische Patientendossier, welches Spitäler ab April 2020 ihren Patienten anbieten müssen, als Treiber der Digitalisierung in Schweizer Spitälern genannt. Wie beurteilen Sie dies? Backup: Gibt es aus Ihrer Sicht weitere Treiber der Digitalisierung im Spitalwesen? Oder anders gefragt: was passiert NACH der Einführung des EPD? Frage: Ist das Spital der Zukunft noch ein Spital wie wir es heute kennen? Backup: Verkommen die Häuser zu modernen med. Patientenhotels oder sprechen wir in ein paar Jahren von «Smart Hospitals»? Wie sieht das digitale Ökosystem eines Spitals aus? 124 Wie reif sind aus Ihrer Sicht die CH-Spitäler in Sachen Digitalisierung, auf einer Skala von 1-5? Backup: Welches sind die Treiber bzw. Hemmfaktoren? Verabschiedung Bedanken für die Teilnahmen und Unterstützung Hinweis auf weiteres Vorgehen Infos zu Verwendung der Resultate (ab Juli 2018) Ende der Aufnahme 2’ 125 8.6.3. Interview mit Herr Raphael Frangi Interviewer Stefan Lienhard Interviewter Herr Raphael Frangi, Senior Marketing Manager, Swisscom Health AG Datum Dienstag, 06. März 2018 Ort Swisscom Health AG, Neugasse 18, 8005 Zürich Frage 1: Raphael, vielen Dank für Deine wertvolle Zeit. Könntest Du bitte kurz etwas zu Deinem Werdegang, Deiner Funktion und Deinem Aufgabenbereich sagen? Antwort: «Bitte, gerne Stefan. Meine Funktion als Senior Marketing Manager bei der Swisscom Health AG ist gleichzusetzen mit dem «Head of Marketing», das heisst, ich bin für die Marktbearbeitung des Geschäftsfeldes stationäre und ambulante Leistungserbringung verantwortlich. Das ist so generell unser Ökosystem, das wir bilden. Ich bin jetzt seit 3 Jahren in dieser Funktion, habe das mit aufgebaut. Die Swisscom Health AG ist seit 5 Jahren konzeptionell und seit 3 Jahren operativ unterwegs, also mit einem konkreten Angebot für das digitalisierte Gesundheitswesen. Die Aufgaben, die ich dort mit einem kleinen Team von 2.5 FTE erfülle ist, dass wir den klassischen Markt aktiv bearbeiten, von Kampagnen bis hin zum Branding etc. was sicher alles noch ausbaufähig ist. […] Wir sind eine Unit innerhalb der Swisscom, um das noch ein bisschen einzugrenzen. Das heisst, unsere Abteilung gehört zum Geschäftskundenbereich, SwisscomEnterprise, wo rund 300 Personen den Markt vom Hausarzt bis zur Krankenkasse bearbeiten». Frage 2: Ok, starten wir. Ist die Schweizer Gesundheitsbranche schon von der Digitalisierung erfasst worden? Antwort: «Das ist eine der Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme und sie ist mit einem klaren «Jein» zu beantworten. Das heisst sie ist, aus Sicht der Maturitätsstufe, am Anfang bis maximal in der Mitte. Wir sind nicht soweit, wie wir alle gehofft und geglaubt haben. […] Unsere Businesspläne mit Swisscom-Health haben vorgesehen, dass wir heute an einem digitalisierteren Punkt wären, als wir wirklich sind. Ich bin der Überzeugung, das hat damit zu tun, dass das Gesundheitswesen generell noch nicht so digital ist, wie es sich vielleicht die Industrie vorstellt, weil einfach das Bedürfnis noch nicht da ist. Das heisst, man merkt den Druck viel zu wenig. Wenn wir unsere Kunden (Spitäler, Hausärzte) anschauen, haben die noch andere, wichtigere Fokusthemen». 126 Frage 3: Gibt es denn trotzdem schon interessante Initiativen oder Leuchtturmprojekte, wo man sieht, dass das Gesundheitswesen digital wird? Antwort: «Ja, wir haben da ein spannendes Projekt und zwar ist es das das grösste E-Health Projekt der Schweiz. Das ist der Zusammenschluss von Bern und Zürich in einer Stammgemeinschaft. Das heisst in diesem Projekt vereinen wir das Leistungserbringergebiet Zürich und Bern, das sind vor allem das USZ (Universitätsspital Zürich) und das Berner Inselspital. Dazu gehören aber ebenfalls kleinere Spitäler, welche sich zusammenschliessen. Diese bieten dann das Patientendossier, was meines Erachtens ja nur ein Teil der Digitalisierung ist, aktiv am Markt an. […] Ein Leuchtturmprojekt ist es für uns nicht nur aufgrund der Grösse. Es gibt beim EPD ja eigentlich zwei grosse Player bzw. Anbieter, die Post und die Swisscom. Der Zusammenschluss von Bern und Zürich als Anbieter ist somit rein schon von der Anzahl Einwohner in diesen beiden Kantonen für uns als Swisscom das grösste bisherige eHealth Projekt - mit all seinen Herausforderungen. Wir haben dabei aber eine Rolle, welche Du als Bürger nur passiv wahrnimmst. Aber dennoch: Wir bauen das System. Es ist zudem noch ein Leuchtturmprojekt, weil der Direktor der Gesundheitsdirektion, Herr Thomas Heiniger, dieses Projekt selber mittreibt und vertritt». Frage 4: Gibt es aktuelle Trends, welche das Gesundheitswesen prägen? Antwort: «Der Trend, den wir feststellen ist, dass vor allem in der Digitalisierung der Medizin sehr viel passiert. Das wirst du wahrscheinlich ebenfalls in Gesprächen mit Spitälern merken. Dort wird sehr viel Geld investiert. Ich meine der Klassiker, er ist eigentlich fast schon «oldschool», sind selbst operierende Roboter wie der Da Vinci, der ja zwar nicht wirklich selbst operiert. Und all die Klone davon, da wird sehr viel Geld und Innovation hineingesteckt. Was ich weiter feststelle ist, dass für den Patienten noch wenig Spürbares gemacht wird. Ein Beispiel: Wir sind mit verschiedenen Spitälern schon seit Jahren im Gespräch wegen einer schlauen Patienten-App. Man sieht dort ebenfalls ein starkes Gefälle zwischen öffentlichen Spitälern und den Privatkliniken, die in diesem Bereich der Digitalisierung schon sehr weit sind. In diesem «Erlebnisfeld» des Patienten passiert im Privatbereich viel, im öffentlichen Bereich gar nichts. Um zur Frage zurückzukommen: Viel Digitalisierung und Innovation im medizinischen Bereich, noch eher wenig bei den Geschäfts- und Administrationsprozessen». Frage 5: Also das Patientenerlebnis ist eher noch auf bescheidenem Niveau? Antwort: «Definitiv. Das siehst Du als Patient teilweise sehr gut in der Auswirkung, dass es noch Schalter gibt. Ich meine in gewissen Regionalspitälern sitzen Damen noch hinter Panzerglas und geben Dir, 127 wie früher in der Bank, untendurch einen Zettel, wo Du Deine Allergien angeben kannst. Das ist sowas von «oldschool» und dort merkt der Patient, dass die Branche noch hinterherhinkt». Frage 6: Wie siehst du das Disruptionspotenzial im Gesundheitswesen? Die Banker sind ja zusammengezuckt, als sie plötzlich die ersten Start-Ups in ihrer Branche entdeckt haben. Wie sieht das im Gesundheitswesen aus? Antwort: «Ich denke, wenn wir das Gesundheitswesen mit der Digitalisierung im Bankenbereich vergleichen, sind wir 7 bis 10 Jahre im Rückstand. […] Ich denke, die Disruption findet aber langsam statt und ganz offensichtlich sehen wir das eigentlich bei den ambulanten Leistungserbringern. Telemedizin ist so ein disruptiver Bereich, würde ich sagen, wo wir jetzt gerade ebenfalls Start-Ups prüfen. Im Bereich der Dermatologie zum Beispiel, wo Hautkrankheiten via App an einen Doktor geschickt werden können. Das sind disruptive Ansätze und die geschehen sehr langsam. Und ich würde wirklich sagen, es ist wie im Banking vor 7 oder 10 Jahren. Disruptive Versuche im stationären Bereich, also in Spitälern, stellen wir eher wenig fest. Dort spüren wir eine gewisse Zurückhaltung, denn die Investitionen sind hoch. Am Schluss ist es leider immer wieder eine Geldfrage. Und ein öffentliches Spital muss sich heute einfach überlegen, ob es in ein Bettenhaus oder eine potenzielle disruptive Technologie investiert. Das ist eine «Trade-Off», wo sich die Spitäler heute erfahrungsgemäss noch oft für klassische Infrastrukturinvestitionen entscheiden und weniger für Technologien. Da gibt es im Privatklinikbereich zwar schon einige wenige Ausnahmen, aber generell kann man sagen eher weniger. Der ambulante Bereich ist hier, mit dem Beispiel der Telemedizin, der klare Vorreiter, dort passiert das mehr». Frage 7: Müssen die Spitäler Angst haben, wenn Google, Amazon und andere Marktteilnehmer plötzlich ebenfalls in den Schweizer Gesundheitsmarkt drängen? Antwort: «Das werde ich als Swisscom Health AG auch regelmässig gefragt. Ich denke, da machen viele Digitalisierungsexperten immer wieder den Fehler, dass sie das Gesundheitswesen mit anderen Märkten vergleichen. Es gibt einen wesentlichen Unterschied und zwar ist das das Vertrauen. Wir stellen in Umfragen bei Patienten zu unserem Gesundheitsdossier «Evita» fest: Die Leute wollen ihren Gesundheitsdatenbericht, sie sind bereit die «lustigen» Lifestyle-Themen international zu teilen, also die Schritte oder vielleicht noch ihren Blutdruck. Aber wenn wir dann wirklich von behandlungsrelevanten medizinischen Daten sprechen, wie dieser Fachterminus heisst, dann stellen wir fest, dass diese Daten wie Blutwerte, HIV-Testresultate etc. kaum mit Google oder Apple geteilt werden wollen. […] Und da haben wir diese Hochburg des Vertrauens in der Schweiz, wo die Angst zumindest in diesem Bereich, der behandlungsrelevanten Daten sehr klein ist. Wenn wir jetzt die Digitalisierung des Gesundheitswesens im Hinblick auf Deine Arbeit ein bisschen öffnen und 128 ebenfalls den Patienten und seine ganze Erlebniskette berücksichtigen, dann würde ich sagen, sind diese Unternehmen schon eine Gefahr. Wenn Du in diesem Zusammenhang siehst, wie Google, Amazon oder Apple die Verhaltensweise des Patienten ändert, dann ist das schon eine Herausforderung. Die Patienten verlangen und erwarten von Hausärzten teilweise ähnliche Lösungen, denn die kommen schon mit gegoogelten Diagnosen. Hausärzte könnten so dank «Big Data & Analytics» ihr Wissen erweitern, indem sie sich an öffentlich zugängliche Datenbanken anschliessen. Dieser Trend wird nicht so oft diskutiert, ist aber ganz klar da». Frage 8: Welche kulturellen Herausforderungen bringt die Digitalisierung im Spital? Antwort: «Ich denke, die grösste kulturelle Herausforderung im Spital ist, dass sich Berufsbilder verändern. Das gibt es schon in Spitälern, Man sieht in der IT heute oft Menschen arbeiten, das darf man so öffentlich ja gar nicht sagen, das sind weiterentwickelte Telefonisten. Das heisst, die kommen in Spitälern aus der Haustechnik, vielleicht aus der Telefonie und machen dann einen IT-Weg. […] Und da merkst Du schon, das ist schon ein «Kultur-Clash» in sich. Das heisst, Leute die sich gewohnt sind oder waren, sich um die Telefonverkabelung von Patientenzimmern zu kümmern, müssen sich heute plötzlich mit interaktiven Terminals herumschlagen und sollen die Vernetzung vorantreiben. Das ist ein Kulturwechsel und auf Stufe der Mitarbeitenden eine der grössten Herausforderungen». Frage 9: Wo ist das Thema Digitalisierung organisatorisch aufzuhängen? Ist das einer bestimmten Abteilung zuzuschreiben? Eher «Top-Down» oder «Bottom-Up»? Antwort: «Ich bin sonst sehr Fan für «Bottom-Up» und ebenfalls für wenig Hierarchien, musste aber in den letzten 3 Jahren lernen, dass das Gesundheitswesen einfach gewisse Hierarchien braucht. Die Leute, die mich kennen wissen, ich bin wirklich kein konservativer Denker, aber ich bin heute überzeugt, dass es diese gewissen Strukturen und Hierarchien in der Organisation Spital nun einmal braucht. Versuche, wo man alles versucht hat zu digitalisieren, sind gescheitert. Versuche, wo der behandelnde Arzt vom Computer übersteuert werden kann, die sind auch gescheitert. […] Zurück zu deiner Frage: Das Thema muss auf jeden Fall so hoch wie möglich angesiedelt sein. In jeder Branche ist der Fehler, dass Digitalisierung oft noch diese Spielplatzecke ist und nicht die «Management Attention» hat, die es braucht. Und das ist im Gesundheitswesen genau gleich. Wir haben gesehen, dass öffentliche Spitäler einen Leiter eHealth irgendwo in der siebten Kaderstufe auf Stufe des Applikationsleiters positionieren und das funktioniert so einfach nicht. Der Kulturwandel kann passieren, wenn der «Head of eHealth» oder «Head of Digitalisierung» wirklich eine sehr hohe Position hat, um nicht zu sagen in der Klinikleitung sitzt». 129 Frage 10: Wir haben schon über veränderte Berufsbilder im Spital gesprochen. Gibt es weitere Jobs wo im Zuge der Digitalisierung neue Fähigkeiten aufgebaut werden müssen? Antwort: «Ich denke, das ist insbesondere im Gesundheitswesen die grosse Herausforderung, dass Du natürlich von der Erfahrung der Alten profitierst. Es gibt in der Branche eine gewisse Überalterung. Wir haben teilweise Pflegepersonal in Spitälern aber ebenfalls Ärzte, die selber altersmässig einen gewissen Reifegrad erreicht haben und für die es schwierig, noch neue Technologien zu lernen. Und ich bin dort immer wieder in diesem Zwiespalt: wie relevant ist die menschliche Erfahrung? Der älteste Psychiater in der Schweiz ist 92 Jahre alt, der älteste ambulante Chirurg 82 Jahre alt, und der schneidet noch an Menschen herum. Und diesem jetzt einen Roboter zu erklären als Beispiel, ist sehr schwierig. Ich glaube, da wird es eine natürliche Selektion durch die demografische Entwicklung geben. Die Jungen, die mit Technologie aufwachsen und gewisse Tools von Anfang an nützen, für die wird das kein Problem sein. Aber die heutigen Koryphäen, die einen wichtigen Job im Spital haben, die Chirurgen als Aushängeschilder, diese umzuschulen und zu entwickeln, das wird sehr schwierig sein. Und ich glaube, was passieren wird ist, dass sich das Machtgefüge von Koryphäen zu Assistenzärzten etwas verschiebt und diese mehr Macht aber auch mehr Verantwortung haben. Die Koryphäen werden Aushängeschilder bleiben, aber die nachrückenden Jungen bringen eine neue Fachkompetenz mit». Frage 11: Die Digitalisierung vernichtet Jobs, heisst es. Müssen Pflegende effektiv Angst um ihre Jobs haben? Oder haben sie plötzlich wieder mehr Zeit für ihre Kernaufgabe, die Pflege und Betreuung von Patienten? Antwort: «Ich bin überzeugt Zweiteres wird passieren. Das hört man auch immer wieder bei Podiumsdiskussionen. Ich bin der festen Überzeugung, dass du gerade im Pflegeberuf den Menschen brauchst. Und das ist gut so, weil Du Empathie brauchst, das Menschliche, was ein Computer niemals ersetzen können wird. Du wirst aber andere, neue Hilfsmittel haben und die werden die älteren Pflegepersonen vor gewisse Herausforderungen stellen. Aber dass du als Pflegeperson Angst haben musst um deinen Beruf, das glaube ich nicht. Und das wird die nächsten 5 bis 10 Jahre sicher noch so bleiben, da bin ich überzeugt». Frage 12: Was bedeutet das denn für die Aus- und Weiterbildung im medizinischen Bereich? Muss ein Arzt plötzlich programmieren können? Antwort: «Ich kann mir vorstellen, dass ICT-Skills gefördert werden müssen. Wir merken zum Beispiel in unserem eHealth Bereich, dass die eHealth Verantwortlichen vor 2 bis 3 Jahren effektiv noch die 130 «Telefonjungs» waren. Die haben in Telefonanlagen investiert und wurden dann eHealth Leiter. Die sind heute aber unisono alle ausgetauscht. Und heute haben wir an diesen Positionen in ganz vielen Kantonen eHealth Verantwortliche, die tatsächlich einen ICT-Background haben. Das ist neu. Das war vor 3 Jahren definitiv nicht so. Heute werden in diesen Bereichen schon Leute rekrutiert, welche einen ICT-Background haben. […] Aber ich denke, ICT-Skills werden bis ans Patientenbett hin notwendig sein. Die benutzen heute schon teilweise nur noch Tablets und nicht mehr die Krankengeschichte auf Papier. Also ja, Basiswissen ist notwendig, aber dass der Arzt zum Programmierer wird, das glaube ich nicht. Auch in der Administration werden immer mehr ICT-Skills benötigt, davon bin ich überzeugt. […] ». Frage 13: Sind die Ärzte und die Pflegenden denn überhaupt bereit für die Digitalisierung? Akzeptieren sie diese in ihrem Daily Business? Antwort: «Wenn wir die Administrationsprozesse ins Daily Business aufnehmen, dann muss ich sagen, sie müssen es sein. Es gibt das, vom Gesetz her vorgeschriebene, elektronischen Patientendossier (EPD) und im administrativen Bereich da müssen sie sich bereit machen für die Digitalisierung. […] Es gibt auch die Bestrebung, dass alle Spitäler von der Spitalliste gestrichen werden und nur noch darauf kommen, wenn sie sich effektiv an die Vorgaben halten und das EPD pünktlich anbieten. Im medizinischen Bereich, glaube ich, wirst Du aber immer noch diejenigen haben, die sie hinter diesem «Koryphäentum» verstecken können und wenig für die Weiterbildung im ICT-Bereich machen müssen». Frage 14: Daten sind das Gold der Neuzeit. Gerade im Spital werden sehr viele und sehr grosse, höchst sensitive, Daten generiert. Gibt es für Spitale hier Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle? Was gibt es hier für Herausforderungen, wenn wir z.B. an Hacker und an das Thema Cybercrime denken? Antwort: «Das diskutieren wir immer wieder gerade bei Projektausschreibungen. Ich denke, das ist kein Problem des Gesundheitswesens, sondern mit der zunehmenden Digitalisierung ist Cybercrime ein allgemeines Thema. […] Und ja das Gold, wie es die Branche nennt, wird gestohlen, das wird passieren. Wir tun aber unser maximal Möglichstes dagegen. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet die Post und die Swisscom im Bereich eHealth Marktleader sind. Sie investieren einfach sehr viel Geld in die Sicherheit. Eine Garantie gibt es in dem Fall wirklich nie. Ich finde es aber spannend, den Gedanken weiterzuspielen: Was ist das Positive von Big Data? Und das gibt es ja durchaus. Es gibt Fälle, wo man sich als behandelnder Arzt in fremden Datenbanken bedienen kann. Da gibt es im Berner Inselspital eine schöne Initiative eines Tumorboards, wo angeschlossene Regionalspitäler effektiv über Video-Conferencing die Tumore der Patienten zusammen besprechen, sich 131 austauschen, und sich so eine Wissensbasis über verschiedene Spitäler hinweg bildet. Eine für mich sehr positive Auswirkung von Big Data. Das bringt am Ende des Tages dem im Bett liegenden Patienten dann wirklich etwas. […] Immer mit immer der Prämisse, dass parallel dazu die Sicherheit im Spital ausgebaut werden muss. Und da müssen die Spitäler Geld investieren». Frage 15: Das Thema «Big Data» geht ja auch in Richtung «predictive Medicine», ein Arzt kann Die schon sagen, wann und woran Du erkranken wirst? Ist da etwas dran? Antwort: «Ja, das ist ein spannendes Thema. Es gibt zum Beispiel in Amerika diese DNA-Tests: Du schickst deine DNA ein und bekommst dann Dein Krebsrisiko in Prozent angezeigt. Es ist etwas, wo die Schweiz noch sehr zurückhalten ist. Da merkst Du einfach, wie Amerika total offen mit dem Thema umgeht. Da kannst Du diese DNA-Tests wirklich bestellen für 90$. Du bekommst den nach Hause geliefert, spuckst ins Tütchen, schickst es wieder ein und bekommst wirklich für alle möglichen Krankheiten deine Risikoprozente angezeigt. […] Da ist die Frage halt auch, inwiefern sich der Patient auf das einlassen will. Wenn ich sehe, wie konservativ Schweizer mit Daten umgehen, bin ich zurückhaltend mit Aussagen, wie lange das geht, bis die Schweiz damit wirklich sehr offensiv umgeht». Frage 16: Digitalisierung erfordert Ressourcen: technologisch, finanziell und von der Manpower her. Was kannst Du da einem Spital mit auf den Weg geben? Antwort: «Wir stellen hier aus Anbietersicht, den Kostendruck, der bei Spitälern sehr hoch ist, sicher fest. Vielleicht wurde jahrelang nicht oder zu wenig investiert und jetzt kommt halt alles miteinander. […] Konkret heisst das: Investitionen in die Digitalisierung stehen oft in Konkurrenz zu anderen Investitionskosten und das ist für mich eine Gefahr. Wenn Du Dich heute als Spital vielleicht eher für die Infrastruktur, die Küche oder das Bettenhaus, entscheidest und weniger für die Digitalisierung, dann wirst du in ein paar Jahren vor einem Problem stehen. Das ist vielleicht jetzt eine mutige Aussage, aber das ist vielen Spitalleitungen noch zu wenig bewusst, dass diese Investitionsblöcke miteinander in Konkurrenz stehen und dass man dann vielleicht eher dazu neigt, auf Bekanntes und Bewährtes zu setzen und noch nicht so diese totale Augenöffnung für Digitalisierung hat. […] ». 132 Frage 17: Wie sieht es mit den Patienten aus, sind die bereit für digitale Angebote und Services im Spital? Sind sie vielleicht sogar mehr bereit als die Mitarbeitenden? Antwort: «Eine spannende Frage. Wenn ich das im Freundeskreis diskutiere, dann denkt die Mehrheit meistens «nein». […] Ich glaube, die Patienten über alle Altersstufen hinweg sind bereit. Du hast immer 10 bis 20 %, die wegen den Daten Sicherheitsängste haben, aber von der Usability her sind die Patienten bereit. Ob es sie jetzt «bereiter» sind als das Spitalpersonal, hängt sicher auch vom Spital ab, vor allem von dessen Grösse und wo es liegt». Frage 18: Es gibt verschiedenste Technologietrends im Gesundheitswesen. Welche sind für Spitäler besonders relevant? Antwort: « […] Wir bei der Swisscom Health AG digitalisieren vor allem die administrativen Prozesse. Da bist du wenig disruptiv. In den Gesprächen mit den eHealth Verantwortlichen, da geht es eigentlich primär um Tablet-Lösungen. […] Wie gesagt im Medizinischen Bereich hört unser Wirkungsfeld auf, dort weiss ich, ist Virtual Reality (VR) ein Thema. […] Das Spital in Sion hat im Rettungsdienst ein VR-Pilotprojekt eingesetzt, wo effektiv der Rettungssanitäter an der Unfallstelle zum Patient geht mit einer VR Brille, um gewissen Daten, zum Beispiel die Körpertemperatur zu messen und er erkennt sie gleich in seinem VR-Display. Das Projekt begleiten wir aber nur am Rand. Da kann ich ehrlich gesagt keine fundierte Antwort geben. Weil, wie gesagt, die Daten kommen schlussendlich in unser Patientendossier, in unsere elektronische Krankengeschichte, die Front der medizinischen Disruption, die sehen wir nicht». Frage 19: Da sind wir gleich beim Thema elektronisches Patientendossier (EPD). Ab April 2020 müssen Spitäler dieses ihren Patienten anbieten. Ist das EPD momentan der Treiber der Digitalisierung im Spital? Und was kommt dann als Nächstes? Antwort: «Ich bin überzeugt, es ist nicht der einzige und nicht der wichtigste Treiber in der Digitalisierung. Aber, und das ist das Gute, es ist ein gesetzlich verordneter «Turbo Boost». Das heisst, Du darfst jetzt nicht mehr schlafen als Spital und das ist gut so. Da hilft das Patientendossier. Man muss schon bedenken, das Patientendossier ist nur ein kleiner Teilbereich der Digitalisierung. Ich weiss, dass es viele Leute gibt, die behaupten, das ist jetzt Digitalisierung. Ich sage «nein», das ist ein Teil der Digitalisierung, da geht es um die administrativen Daten. Der Vorteil ist, wenn Du jetzt plötzlich ein Patientendossier zur Verfügung stellen musst, dann beginnst Du plötzlich, Deine Infrastruktur zu hinterfragen. Du beginnst, Dein System in der Klinik zu hinterfragen, bis hin zum W-LAN. Ich würde mal sagen, es ist ein richtiger Türöffner. […] ». 133 Frage 20: Das Patientendossier löst also Diskussionen positiver Art aus um andere Themen. Solche, die man vielleicht ebenfalls schon längst hätte diskutieren dürfen? Antwort: «Ja, positive, das ist gut. Oder es kann helfen, wenn du selbst in einem Spital arbeitest, sei das im Bereich Innovation oder Digitalisierung. Bis jetzt warst du dort ohne dieses Patientendossier ein richtiger Freak. Du musst immer mit diesen klassischen Innovationstreibern spielen. Heute kannst du sagen «Hey lieber Chef, wir haben eine gesetzliche Pflicht!» - das hilft den Innovations- und Digitalisierungsmenschen in den Spitälern sicher weiter». Frage 21: Das Spital der Zukunft, ist das noch ein Spital wie wir es kennen oder funktioniert das schon ganz anders? Antwort: «Ich glaube, es funktioniert schon ziemlich anders. Ein Bereich, wo wir diese Tendenzen feststellen ist nur schon der «Check-In», wenn du ins Spital kommst. Dieser findet heute zum Teil schon zuhause statt, wo Du gewisse Fragen beantwortest. Da gibt es auch Pilotprojekte, zum Beispiel im Berner Inselspital. […] Du machst einen Online-«Check-in» und das ist für mich der erste Schritt zur Veränderung. Dass Du wenn Du ins Spital kommst, vielleicht in einer Couchumgebung sitzt und nicht mehr hinter diesen Tresen wie am Postbankschalter. Das ist schon eine riesige Veränderung. […] Das geht dann hin bis zu den Hospitality Services. Wir haben ein spannendes Pilotprojekt mit Pepper dem Roboter in einem Altersheim in Montreux begleitet, wo Roboter nachtschichtmässig Gänge überwachen. Wenn Du Dir das vorstellst, der Patient im Altersheim steht nachts auf und da ist ein Roboter, ich meine, das wird eine totale Veränderung sein und zwar des kompletten Heims. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es den Menschen immer brauchen wird. Ich bin aber überzeugt, dass die Hilfsmittel definitiv anders sein werden und dass das Spital anders aussehen wird». Frage 22: Es ist also auch durchaus möglich, dass wir in Zukunft in «smarten» Spitälern unterwegs sind? Antwort: «Wenn du Innovationsprozesse anschaust, dann sprechen wir auch schon vom «Lean Hospital», und für mich ist «lean» die Vorstufe zu «smart». Also «ja», es wird «Smart Hospitals» geben. […] Heute versuchen wir noch die Prozesse zu verschlanken, was für mich die Vorstufe ist für Innovation und danach auch für das «smarte» Spital. […] ». 134 Frage 23: Wenn Du unsere Spitäler bezüglich Digitalisierung auf einer Skala von eins (schlecht) bis fünf (sehr gut) einschätzen musst, welche Note gibst Du der Branche? Antwort: «Das sind meine Kunden! Wenn wir alle Spitäler, Regionalspitäler, öffentliche und private zusammennehmen: ich würde 3 bis 3.5 geben, aber eher eine 3. Es ist knapp genügend – wir tun etwas aber wir haben immer noch eine gewisse Anzahl Verhinderer. […] ». Schlusswort: Herzlichen Dank für die vielen Infos und Einblicke. Das war sehr spannend für mich, merci! Antwort: «Gerne Stefan, und sehr gerne auf weitere Gespräche zu dem Thema». 135 8.6.4. Interview mit Herr Prof. Dr. Alfred Angerer Interviewer Interviewter Stefan Lienhard Herr Prof. Dr. Alfred Angerer, Leitung Management im Gesundheitswesen, ZHAW School of Management and Law Ort ZHAW School of Management and Law, Gertrudstrasse 15, 8401 Winterthur Datum Freitag, 09. März 2018 Frage 1: Guten Tag Herr Prof. Dr. Angerer. Erstmal «Herzlichen Dank» für Ihre Zeit. Können Sie als Einstieg kurz etwas zu Ihrem Werdegang, Funktion und Ihren wichtigsten Aufgaben sagen? Antwort: «Zum Werdegang in Kürze: Ich bin Wirtschaftsingenieur, habe auch zunächst in der Industrie gearbeitet, klassisch zuerst in der Produktion und Logistik. Ich habe dann drei Jahre an der HSG in St.Gallen promoviert zum Thema Prozessoptimierung, war vier Jahre Unternehmensberater bei der Firma McKinsey und inzwischen seit neun Jahren hier in der ZHAW im Departement Wirtschaft. Ich leite die Fachstelle Management im Gesundheitswesen. Das heisst, wir beschäftigen uns mit der BWL-Seite des Gesundheitssystems, vor allem mit den einzelnen Akteuren, sprich Spitäler, Versicherer und Pharma. Das ist unsere Welt. Und wir haben drei Themenschwerpunkte. Das eine ist «Prozessoptimierung Lean». Das zweite ist das Thema «Marketing und Qualität im Gesundheitswesen», also, wie macht man gute Qualität und spricht darüber. Und das dritte ist eben jetzt neu «Digital Health», die Auswirkungen der digitalen technologischen Möglichkeiten auf unser System und auf die Akteure im Gesundheitssystem». Frage 2: Besten Dank. Kommen wir zur Einstiegsfrage. Ist die Digitalisierung schon in der Schweizer Gesundheitsbranche angekommen? Antwort: «Da verweise ich gern auf die Studie von meinen Kollegen, von Digital Swiss. […] Die Hauptaussage glaube ich sofort, nämlich, dass wir das Schlusslicht bilden, was die Digitalisierung betrifft. Also, das Gesundheitswesen hat einen ganz starken und grossen Nachholbedarf. Das heisst nicht, dass es nichts gibt, aber es heisst, dass wir wirklich ganz am Anfang der Reise stehen». 136 Frage 3: Können Sie sagen, was die Gründe sind, dass wir da so hinterherhinken? Antwort: «Ja also, ich glaube, der Hauptgrund ist wie immer: wo kein Druck, da keine Optimierung. Wenn man bedenkt, dass heute das Kommunikationsmittel beim niedergelassenen Sektor immer noch das Faxgerät ist, das sagt schon, glaube ich, wie weit wir mit der Technologie voranschreiten. Und ja, man traut sich einfach teilweise nicht, das zu ändern. Man erfindet ein Faxgerät, das doch elektronisch geht und rettet so diese veraltete Technologie. Auch wenn alle jammern, dass das Gesundheitssystem so unter Druck steht, das ist noch lange nicht so unter Druck, dass wirklich grosser Handlungsbedarf besteht. Ein zweiter Effekt ist wahrscheinlich das Expertentum. Also Experten wie Ärzte, Pflegende und andere „Medical Professionals“, die lassen sich nicht gerne führen. Es ist schwierig, so eine Expertenorganisation wie ein Spital zu führen. […] Das heisst, selbst wenn Sie der CEO eines grossen Hauses sind und eine grosse digitale Vision haben, werden Sie es sehr schwer haben, ihre Leute zu überzeugen. Ohne Ärzte geht nichts». Frage 4: Gibt es trotz diesen Umständen schon interessante Projekte und Initiativen, die vielleicht nicht nur in einem Haus stattfinden, sondern Leuchtturmprojekte in der Branche? Antwort: «Ja, ich meine, es gibt ja immer wieder richtig schöne Fälle. Also spontan, ein paar Kilometer von hier im Kantonsspital Winterthur sind es Kleinigkeiten, die durchaus eine Patientenfokussierung zeigen - was ein grosser Megatrend ist. Der Patient kommt nicht mehr als Bittsteller zu mir, sondern als echter Kunde mit echten Bedürfnissen und das Kantonspital Winterthur hat jetzt seine eigene elektronische Patientenagenda. Das heisst, ich als Patient sehe, wann habe ich welchen Therapeuten und welche Termine. Das Ganze ist nicht mehr Zettelwirtschaft, sondern eine elektronische Lösung. Und das Ganze natürlich verknüpft mit den Agenden der Therapeuten, der Ärzte und Ärztinnen. Also das ist so eine Kleinigkeit, aber ein wichtiges Leuchtturmbeispiel, wie man jetzt schon etwas digitalisieren und die Vorteile davon nutzen kann.» Frage 5: Wenn wir noch etwas genauer auf die Branche schauen, gibt es irgendwelche Trends technologischer Art oder bezüglich neuen Geschäftsmodellen? Antwort: «In unserer Studie «Digital Health: Die Zukunft des Schweizer Gesundheitswesens» haben wir als erstes den Begriff «Digital Health» definiert. Da verstehen auch viele Leute etwas Anderes darunter. Und dann zweitens haben wir uns einfach mal die Artikel von einem Jahr geschnappt, die in den Zeitungen rausgekommen sind (NZZ und Co.) und haben einfach mal gezählt, was sind die grossen Begriffe, die da vorkommen. Und das ist unsere Form, Trends ein bisschen zu objektivieren, um festzustellen, was sind so die vier Begriffe, die da draussen wirklich interessant sind und worüber 137 zumindest die Öffentlichkeit spricht. Das war eben einerseits das Thema «elektronisches Patientendossier», das ist natürlich ein ganz heisses und aktuelles Thema. Das zweite war das Thema «Wearables». Das heisst, wir schaffen es jetzt, digital und unterwegs Daten zu messen, die uns vorher nicht zur Verfügung standen. Eigentlich ein Dauerbrenner. «Telemedizin» ist das Dritte. Da gab es in Australien schon in den 80er Jahren Versuche, über ein Telefon ärztliche Leistungen durchzuführen. Und ja, wenn man «Digital Health», so wie wir, auch breiter versteht, dann auch das Thema «Lifestyle & Fitness» als viertes, wo wir einige Artikel dazu gefunden haben. Man merkt, da entstehen auch durchaus neue Geschäftsmodelle in den Bereichen, denn Gesundheit ist mehr als «nicht krank sein». Also ist auch eine Lifestyle-Thematik mit drin. Und das sind so die vier grossen Trends, die wir aktuell beobachten». Frage 6: In einer 2015 durchgeführten Studie von Deloitte und Heads! wurde dem Gesundheitswesen prophezeit, dass es gegenüber anderen Branchen zwar erst spät, dafür umso heftiger von der Disruption erfasst wird. Wie schätzen Sie das Disruptionspotenzial im Gesundheitswesen ein? Antwort: «Also, das ist in der Tat nur mit ganz grosser Schwierigkeit vorherzusagen, wann und in welcher Form eine Disruption eintritt. Ich gebe mal ein Beispiel: In den News gab es vor ein paar Wochen den Artikel, Kollegen in Chicago hätten es geschafft, zum ersten Mal mit einem 3-D-Drucker funktionierende Organe zu drucken, ich glaube, Eierstöcke von Mäusen oder so. Und das würde dann definitiv sehr vieles auf den Kopf stellen, wenn wir in der Lage sind, tatsächlich richtige Organe zu drucken. […] Und jetzt gibt es so eine Durchbruchstechnologie und man befragt die Experten dazu. Das haben wir gemacht. Wir haben quer von Pharma über Apotheken und Spitäler Exponenten gefragt, für wie wahrscheinlich sie es halten, dass das bei uns in der Schweiz in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren tatsächlich kommt. Und da kriegen Sie Antworten von 0 bis 90 Prozent, schön gleichmässig gestreut. Also das heisst: ja, solche Technologien könnten wirklich vieles auf den Kopf stellen, aber keiner kann genau sagen, wann, wie und wo das passieren wird». Frage 7: Die Big-Player im digitalen Bereich sind Unternehmen wie Google und Amazon. Man spricht auch von der «Platform-Economy» als Megatrend. Was bedeutet diese Entwicklung für Spitäler? Müssen sie vor diesen Unternehmen Angst haben? Antwort: «Genau diese Frage haben wir unseren Kolleginnen und Kollegen gestellt: wie wahrscheinlich ist es, dass branchenfremde Unternehmen wie Google, die Post oder die Migros in den nächsten zwanzig Jahren in den Markt drängen. […] Im Schnitt sagen sie, dass uns diese Unternehmen mit 60 % Wahrscheinlichkeit in den nächsten 20 Jahren tatsächlich dominieren. Wenn die gesammelten Gesundheitsdaten wirklich so grosse Möglichkeiten eröffnen für neue Geschäftsfelder, dann glaube 138 ich schon, dass die Leute und Unternehmen, die verstanden haben, wie man mit Daten umgeht, da sehr grosse Vorteil haben werden». Frage 8: Also geht der Trend auch in Richtung «predictive Medicine»? Antwort: «Genau, das ist zum Beispiel eine Anwendung. Also ich glaube, das sind so grundsätzliche Methoden oder Lektionen, die man lernt, wie man mit grossen Datenmengen umgeht. Wenn ein Akteur kommt und das schlau anwendet auf das Gesundheitswesen, kann das sehr vieles durcheinanderbringen». Frage 9: Wir kommen jetzt zu kulturellen Aspekten. Digitalisierung, ist ein Megatrend. Was bringt dieser für kulturelle Herausforderungen mit sich, speziell für Mitarbeitende im Spital? Antwort: «Das Thema Veränderungen ist ja ein Klassiker der Change-Management Literatur. Es ist immer schwierig, neue Arbeitsläufe einzubringen. […] Was wir so festgestellt haben in unseren Recherchen und natürlich aus unserer Projektarbeit ist, das Problem multipliziert sich, wenn Sie nicht nur etwas verändern, sondern auch noch Digitales hineinbringen. Dann ist die Gefahr einer Doppelblockade noch grösser. Weil die Leute nicht nur, weil sich etwas verändert, dagegen sind, sondern weil das Ganze auch noch digital passiert. Es gibt auch schöne Studien dazu und die genaue Zahl weiss ich jetzt nicht, aber 80 – 90 % der Projekte die dann scheitern, sind Digitalisierungsprojekte. Und der allergrösste Blocker ist nicht die technische Machbarkeit, sondern die fehlende Akzeptanz». Frage 10: Wo sollte man im Spital die Themen Digitalisierung und digitale Transformation organisatorisch aufhängen? Eher «Top-Down» oder «Bottom-Up»? Antwort: «Da mache ich jetzt eine Analogie aus dem Bereich wo ich herkomme, der Prozessoptimierung. Wo hängt man das auf? Hat man jetzt eine zentrale Stelle von Experten, die sich da super auskennen oder versucht man, Mitarbeitende auf so ein Niveau zu heben - oder holt man sich Externe ins Haus? Eine kurze Antwort ist: Sie lesen zehn Papers und haben zehn verschiedene Meinungen dazu. Meine persönliche Meinung: Ich glaube, dass es durchaus Experten im Haus braucht. Ob man sie bei der IT, Unternehmensentwicklung oder «Digital Koordinator» nennt, das ist, glaube ich, nicht wichtig, Hauptsache man hat einen harten Kern von Leuten, die das Thema richtig gut verstanden und durchdrungen haben. Und das muss natürlich von «Top-Down» kommen. Das TopManagement muss bestimmen, denn es gibt die Gelder dafür. Aber es muss dann praktisch versuchen, «Bottom-Up» Lust für das Thema zu erzeugen, indem einzelne Projekte durchgeführt 139 und die Erfolge/der Nutzen den Leuten aufgezeigt werden. Und so sollte man nach und nach die digitale Transformation gestalten. Die grosse Streitfrage lautet auch: «Big Bang» oder sequenziell – macht man alles auf einen Schlag, also ein Multimillionenprojekt, nimmt drei Jahre lang jeden Stein auseinander und baut ihn dann wieder auf. Ich würde eher „Nein“ dazu sagen. Lieber sequenziell, lieber mit einem Leuchtturmprojekt anfangen und den Leuten damit aufzeigen was man machen kann und das dann nach und nach ausrollen. Das wäre meine persönliche Meinung». Frage 11: Dieser digitale Fortschritt erfordert von Arbeitnehmern ein Umdenken und den Aufbau von neuen Fähigkeiten. Wie müssen die aufgebaut werden und entstehen dadurch vielleicht neue Berufsbilder im Spital? Antwort: «Zur zweiten Frage bezüglich Berufsbilder: Ich glaube, dass es auf jeden Fall etwas wie einen «Digital-Translator» oder «Trendscout» benötigt, der spürt, was es draussen im Markt gibt und es schafft, das Ganze in die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und Patienten zu übersetzen. Das ist auf jeden Fall ein neues Berufsbild. Zur ersten Frage: Ich glaube, das ist weniger schlimm als es früher war. Wenn ich daran denke, was es vor zwanzig Jahren bedeutet hat, einen VHS-Rekorder zu programmieren: Da musste man ja wirklich stundenlang Anleitungen lesen. Und wenn ich mir heute anschaue, was es zum Beispiel bedeutet einen Pflegeroboter zu bedienen. Also ich habe grade vor zwei Wochen eine Fabrik besucht, wo sind in der Pflegerobotik forschen. Das sieht dann so aus: Ich drücke auf den Knopf, dann bewege ich den Roboter so wie er sich zukünftig bewegen muss und drücke wieder auf den Knopf. Als Pflegefachkraft muss ich hier nicht Programmieren lernen. Ich sehe das also nicht als die grosse Hürde, weil letztendlich die Technik und die Usability also die «Mensch-Maschine-Schnittstelle» immer einfacher wird. Deswegen braucht man gar nicht grosse Programmier- oder sonstige Fähigkeiten. Was die Menschen brauchen werden, ist mehr die Flexibilität und das Verständnis, dass das was ich in den letzten 15 Jahren gemacht habe, heute so nicht mehr immer funktioniert, weil sich die Welt weitergedreht hat, weil die Patientenbedürfnisse anders sind und vor allem, weil die Technologie ganze neue Möglichkeiten erschaffen hat. Flexibilität ist die neue Kompetenz, die man braucht». Frage 12: Also müssen Pflegende nicht zwingend Angst haben um ihren Job auch wenn man immer wieder liest und hört, dass die Digitalisierung Jobs vernichtet? Antwort: «Jobs werden sich verändern und bei jeder Veränderung gibt es auch Verlierer. Als die Webstühle eingeführt wurden und nicht mehr per Hand genäht wurde, da gab es auch schon Verlierer. Dafür konnten die Leute welche die Webstühle bedient haben oder die im Design tätig waren etwas ganz Anderes machen. Die Digitalisierung verändert die Berufsbilder, aber ich hoffe, dass sie viele Berufsbilder zum Besseren verändert. Sprich, dass ich letztendlich wertvollere und kreativere 140 Aufgaben übernehmen kann und der Roboter mir zum Beispiel die schwere Hebe- oder Traglast abnimmt. Ich glaube also schon, dass sich da vieles verändern und dass es dabei Verlierer geben wird, aber insgesamt stehe ich dem eher positiv gegenüber». Frage 13: Es ist also durchaus denkbar, dass gerade Pflegende mehr Zeit am Patienten verbringen können und Routineprozesse von Technologien übernommen werden? Antwort: «Das wäre natürlich das Ziel. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Letztendlich verbringen Pflegende, das wissen wir aus Studien, nur ungefähr 20 % der Zeit mit Patientenpflege und 80 % mit durch die Gegend laufen, Reports erstellen, Meetings und damit eigene Fehler oder die von anderen zu korrigieren. Wenn man diese 20 % erhöhen kann, dann entsteht auf jeden Fall etwas Besseres als heute. Und natürlich darf man nicht vergessen, wir reden immer aus der Arbeitnehmersicht und das Ziel eines Arbeitnehmers im Spital ist es ja, den Patienten zu pflegen, zu behandeln und zu beraten. Wenn ich das mit digitalen Möglichkeiten verbessern kann, ist das auf jeden Fall wünschenswert». Frage 14: Ist das medizinische Fachpersonal in Spitälern, Ärzte und Pflegende, denn überhaupt bereit für die Digitalisierung? Antwort: «Pauschal würde ich «ja» sagen. 2012 haben wir in der Spitalpoolstudie 500 Leute befragt bzw. mit psychologischen Tests gemessen, wie veränderungsbereit sie sind. […] Das hat per se nichts mit der Digitalisierung zu tun, sondern nur mit der reinen Veränderungsbereitschaft. Die ganz grosse Überraschung der Studie war, dass, wenn man die gleichen Fragen den Menschen auf der Strasse stellt, dann ist der Spitalmitarbeiter veränderungsbereiter, also flexibler. Das heisst, sie sind schon eher aufgeschlossen gegenüber Veränderungen. Und seitdem wir diese Studie durchgeführt haben, denken wir also «ja». Es ist eine Frage der Form wie man das Thema Digitalisierung nun anpackt, aber es ist auf jeden Fall machbar». Frage 15: Zum Thema «Big-Data»: Daten sind das Gold der Neuzeit. Gerade im Spital werden sehr viele und sehr grosse, höchst sensitive, Daten generiert. Gibt es für Spitale hier Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle? Antwort: «Also wenn man aus den Daten wirklich noch mehr Geld gewinnt, vielleicht. Aber das ist ja gleichzeitig kritisch, weil die Daten gehören ja eigentlich dem Patienten. Also, ich würde erstmal sagen, die Daten sollten primär nicht für neue Geschäftsmodelle gebraucht werden, sondern um die 141 bestehenden zu verbessern. Also a) für die Prozessoptimierung. Wenn ich in meinem System herausfinde, wie zum Beispiel die Wartezeiten meiner Patienten sind, das in Echtzeit in ein Cockpit übertragen kann und dann daraus Erkenntnisse für die Führung meiner Mitarbeitenden gewinne, dann habe ich schon sehr, sehr viel gewonnen. […] Und b) für die Qualität ist es natürlich kritisch und da gibt es sehr viel Möglichkeiten. Ich weiss das aus einer Studie der Helsana, in welcher untersucht wurde, welche Medikamente im Bereich der Altenpflege im Schnitt ausgegeben werden. Und welche Nebenwirkungen es dadurch gibt. Ein Pflegeheimbewohner hat im Schnitt acht Medikamente, die er einnehmen muss. Diese Daten gab es schon immer, man muss sie nur auswerten. Wenn ich acht Medikamente nehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich irgendwas nicht miteinander verträgt. Das ist doch eine Katastrophe. Auch hier bedeutet das eher die Qualität zu verbessern als neue Geschäftsmodelle zu erarbeiten. Wichtig ist zu verstehen, dass sich da noch viel verändern muss. Ich glaube, das sind die ersten zwei Ziele des Datenmanagements». Frage 16: Wie bereits sind denn die Patienten, wenn es um digitale Angebote und Services im Spital geht. Sind sie «bereiter» als es die Mitarbeitenden sind? Antwort: «Ob «bereiter», weiss ich nicht. Ich glaube, dass jeder, der versteht, was mit seinen Daten passiert und was er davon hat, dass man den für Projekte gewinnen kann. Wenn man sich so die Studien und Befragungen der Schweizer Bevölkerung anschaut, wie sie gegenüber dem Patientendossier stehen, dann ist das schon erstaunlich: sie sind eher positiv. Es ist nicht so, dass die Leute immer nur den Datenschutz sehen, der ist für Sie zwar schon wichtig und kritisch. Aber die Leute sind bereiter mitzumachen, wenn sie den Sinn erkennen, das ist mein Bauchgefühl. Also grundsätzlich glaube ich, ist der Schweizer Patient schon empfänglich für neue digitale Lösungen». Frage 17: Welche Ressourcen muss ich als Entscheidungsträger im Spital bereitstellen, wenn ich die Digitalisierung angehen will? Antwort: «Meine Hauptbotschaft ist immer, bevor man digital wird, muss man erst effizient werden. […] Also, es gibt ja das EVA-Prinzip, das sagt: Bevor ihr darüber nachdenkt, auch nur einen Rappen in die IT zu stecken, schaut, dass ihr aus eurer Prozessen das Unnötige eliminiert, das ist das E von EVA. Dann heisst es vereinfachen, so weit wie möglich, das ist das V. Und dann erst kommt die Automatisierung, die IT und die Digitalisierung. Zuerst die Prozesse optimieren und dann kann man über Digitalisierung sprechen. Wenn man schon so weit ist, dass man Digitalisierung wirklich machen will und wie man da vorgeht, ist es wie wir es vorhin bei der Organisation schon besprochen haben, dann glaube ich, dass man über zentrale Experten herangeht. Man schaut sich ein paar 142 grosse Schwachstellen in der Organisation an und macht daraus Leuchtturmprojekte. Aber ohne echte Investition wird genau nichts passieren. Also es wird richtig Geld kosten». Frage 18: Eine Frage zu medizinischen Technologietrends: Gibt es Schlüsseltechnologien, mit welchen sich ein Spital unbedingt auseinandersetzen sollte? Antwort: «Das ist insofern schwierig zu beantworten, weil ich glaube, dass diese ganzen bahnbrechenden Technologien in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Spitäler noch nicht erreichen werden. Die Spitäler sind noch gut damit beschäftigt mit dem Jetzigen zu arbeiten. Deswegen würde ich jetzt keine Prognose wagen und sagen, dies und das sind die Technologien der Zukunft. Meiner Meinung nach ist es wichtig, die Fähigkeit zu erwerben, flexibel auf was auch immer kommen mag, reagieren zu können. Als Spital brauche ich einen Digital-Officer, der als Technologie-Scout dient, der weiss, was da draussen auf der Welt und im Markt passiert und der mir rechtzeitig Bescheid sagt, dass das mit dem 3-D-Druck nun doch aktuell wird und wir handeln müssen». Frage 19: Spitäler müssen ab April 2020 ihren Patienten ein elektronisches Patienten-Dossier (EPD) anbieten. Ist das EPD der aktuelle Treiber der Digitalisierung in Spitälern? Und was kommt nach dessen Einführung? Antwort: «Was nach der Einführung kommt, ist zuerst einmal das grosse Jammern. Weil die aktuelle Lösung, ist einfach so eine Minimallösung, die man da entwickelt hat. […] Sehr regional, sehr pluralistisch, jeder macht was er glaubt, was am besten ist mit möglichst wenig Zwang. Mein Beispiel hier sind unsere österreichischen Nachbarn, die die elektronische Gesundheitsakte (ELGA), eingeführt haben. Die haben dort ein «Opt-Out-System», das heisst, jeder Österreicher hat eine ELGA, ausser er oder sie widerspricht. Und die haben, glaube ich, im Moment so Raten von 4 % Prozent oder so, die rausgegangen sind. Das heisst, die haben 96 % Prozent der Bürger, die da drin sind. Bis die Schweiz 96 % hat, wird es noch Jahrzehnte dauern. Deswegen glaube ich, ist das EPD der erste Schritt, aber es ist nur ein kleiner Schritt». Frage 20: Wenn Sie das Spital der Zukunft skizzieren können, wie sieht dieses aus? Gibt es das noch in der Art und Weise, wie wir das heute kennen? Werden es einfach moderne Patientenhotels oder eher «smart and lean Hospitals» sein? Antwort: «Also hoffentlich wird es ein «smart and lean Hospital» geben. Da muss man nicht träumen, da kann man in anderen Ländern schon gute Beispiele sehen. Also, ein Spital das funktioniert so, dass dort 143 die Patienten schnell, gut und effizient betreut werden. Ja, das wird es auf jeden Fall geben. Ich glaube, Technologie wird uns noch lange eher als «enabler» unterstützen, das zu machen, was wir heute eh schon machen. […] Das heisst, die Kernaufgabe ist: ein Patient kommt mit einem Bedürfnis zu mir, ich mache die Anamnese, ich berate ihn, was die beste Therapie wäre, ich führe die Therapie durch und dann auch die Pflege. Ich glaube, diese drei, vier Kernaufgaben, die wird es auch in Zukunft geben. In den nächsten Jahren oder Jahrzenten wird die Technologie uns einfach ermöglichen, diese Kernaufgaben einfacher, effizienter und qualitativ besser zu erledigen. Das heisst, wir werden es wiedererkennen, das Spital, auch wenn wir uns zwanzig Jahre in die Zukunft teleportieren. Wir werden immer noch die gleichen Grundmuster sehen, aber wir werden sehen, wie dann vieles dank Technologien schneller, einfach und besser gemacht werden kann, als heutzutage». Frage 21: Wenn Sie die Schweizer Spitäler bezüglich Digitalisierung auf einer Skala von eins (schlecht) bis fünf (sehr gut) einschätzen müssen, welche Note geben Sie der Branche? Antwort: «Also, wenn man einen Gesamtindex macht, aus: welche Technologien haben sie, wie gut sind sie in der Organisation aufgestellt, wie viel strategische Gedanken machen sie sich zum Thema Innovations- und Technologiemanagement und wie ist die Bereitschaft der Mitarbeitenden, würde ich ihnen vielleicht eine 2 geben». Schlusswort: Herzlichen Dank, wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank für das offene Gespräch und die ausführlichen Antworten. Antwort: «Bitte, sehr gerne. Das waren gute und interessante Fragen!». 144 8.6.5. Interview mit Herr Yves Laukemann Interviewer Stefan Lienhard Interviewter Herr Yves Laukemann, Leitung Applikationsmanagement, St. Claraspital Datum Donnerstag, 15. März 2018 Ort St. Claraspital, Kleinriehenstrasse 30, 4016 Basel Frage 1: Guten Tag, Herr Laukemann. Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Zeit. Können Sie mir kurz Ihre Funktion und Ihr Aufgabengebiet erläutern? Antwort: «Gerne, guten Tag Herr Lienhard. Mein Aufgabenbereich ist bis vor einem Jahr der klassische Leiter Informatik gewesen. Da habe ich mich mit allen Themen beschäftigt, die mit der Informatik in Verbindung gebracht werden können. Vor einem Jahr haben wir eine neue Organisation gestartet, mit einem Leiter Innovations- und Technologiemanagement. Vorausgegangen ist eine strategische Betrachtung auf Stufe Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, wo man einerseits sich überlegt hat, welches sind die neuen Themen, die uns beschäftigen könnten. Man hat dann eine Rundumsicht gemacht […] und die Quintessenz war, dass man eigentlich beschlossen hat, man muss eine neue Organisation schaffen. Der Hauptgrund war, dass man bewusst gesagt hat, dass das Spital Kraft in Innovation und Digitalisierung setzen und diese Nutzen will, um das Spital weiterzubringen. Man wollte im Geschäftsfeld die Informatik ganz tief verankern und mit Informatik meine ich jetzt nicht einfach die Infrastruktur, sondern wirklich die genutzte Informatik in Prozessen und in all den Bereichen, die man mit der Digitalisierung verbindet. Seither arbeite ich als Leiter Applikationsmanagement. […] Ich finde den Namen etwas unglücklich gewählt, denn er entspricht nicht dem IT-Begriff». Frage 2: Ok, zur Einstiegsfrage. Ist die Gesundheitsbranche schon von der Digitalisierung erfasst worden? Wenn ja, wie zeigt sich das in Ihren Augen? Wenn nein, wieso nicht? Antwort: «Für mich gibt es zwei Aspekte in dieser ganzen Fragestellung. Der eine Aspekt ist der Aspekt, wie funktioniert ein Behandlungsablauf. Und zwar meine ich, in der gesamten Versorgungskette, von Hausarzt über Spital bis zur Spitex. Da denke ich da sind wir nicht nur zurück, sondern da sind wir sehr weit zurück. Da spielt heute vieles noch immer auf der Ebene Papier und Fax. Das ist eine Tatsache, die bekommt man fast nicht aus den Köpfen, weil sie irgendwie so gewachsen und genetisch verankert ist. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sehe ich immer wieder spannende 145 Vorträge, wenn es um den Bereich der Behandlung selber geht. Oder um Forschungsthemen. Und dann staune ich, wenn ich sehe, dass man da einen Gaming-Computer aufstellt und der Chirurg, bevor er in den Operationssaal geht, nutzt die 3D-Funktionalität der MRIs und der Ultraschalle und schaut sich das zuerst mal 3D-mässig an, was er jetzt gerade behandeln muss. Da sehe ich Beispiele, wie man mit Künstlicher Intelligenz, mit all diesen Untersuchungsmethoden, die es heute gibt, die auf Informatik-Mitteln beruhen, wie man da punktgenau einen Tumor treffen kann und das Ganze macht man an einem Bildschirm. Wir sehen das in unserem Haus selber. Wir haben einen Operationsroboter. Den haben wir etwas vor über einem Jahr gekauft. Und heute werden dort selbstverständlich hochkomplexe Operationen unterstützt. Das ist ein Unterstützungswerkzeug. Das ist ein Roboter. Es ist kein autonomes System. Vor einem Jahr hätte mir ein Chirurg gesagt «das kann ich nicht, das ist viel zu gefährlich. Dann sehe und weiss ich nicht, wo ich arbeite.». Wir haben bei uns den Schwerpunkt Bauchmedizin und gerade bei Pankreas-Operation ist das enorm, was man mit Robotern und minimalinvasiven Eingriffen, erreichen kann. […] Man ist, und das ist jetzt meine persönliche Aussage, noch nicht so weit, dass man wissenschaftlich belegen kann, ob roboterassistierte Eingriffe für den Patienten «besser» sind. Sicher ist: die Wunde wird kleiner und die Heilungschancen sind grösser. Aber ob das einen grossen med. Nutzen bringt oder nicht, ist wissenschaftlich noch nicht bewiesen. Wenn ich sehe, was im medizinischen Bereich abgeht, dann sage ich, ist das Gesundheitswesen extrem rasant unterwegs, was die Möglichkeiten der Digitalisierung anbetrifft. Im Behandlungsprozess selber, wenn es um die Geschäftsabwicklung im Spital geht, dann haben wir noch ganz viele Hausaufgaben zu lösen. […] ». Frage 3: Gibt es in der Branche Initiativen, die Sie als Leuchtturmprojekte in Sachen Digitalisierung anschauen? Antwort: «Es sind aus meiner Sicht eher die kleineren Dinge. Gerade das elektronische Patientendossier (EPD) ist für mich alles andere als ein Leuchtturmprojekt, weil das EPD hat Rahmenbedingungen geschaffen, die von der ganzen Community, die sich mit dem beschäftigt, abgelehnt werden. Es ist für niemanden nachvollziehbar, warum ein Arzt oder ein Patient das freiwillig in Anspruch nehmen soll. Das ist der Tod dieses Systems. Man entwickelt eine komplexe Architektur die so schwerfällig wird, dass sie überholt ist, bevor man sie überhaupt einsetzt. Wenn an einem Kongress jemand fragt, ob hier nicht auch an die Blockchain-Technologie gedacht wird, dann heisst es «Was ist denn das?». Insofern denke ich, ist das nicht gerade ein Leuchtturmbeispiel. Es wäre sicher ein gutes Beispiel, wenn wir es wie in anderen Ländern mit einem sozialistischen Gedanken angehen würden und in der grossen Menge den Erfolg suchen würden. So wie das heute angedacht und aufgebaut wird, jeder Kanton soll doch mal selber schauen, ist das kein Leuchtturmprojekt. Aus dem Projekt hinaus gibt es aber schon Initiativen, die versprechen erfolgreich zu sein. Und da geht der Pragmatismus eben vor. […] Ich denke, da es gibt etliche kleinere Beispiele, die jetzt irgendwie kurz vor dem Durchbruch stehen, aber das sind halt nur kleine Puzzlesteine. Und ich bin ehrlich gesagt 146 noch nicht sicher, ob nicht am Schluss doch alle Schweizer bei Apple ihre Gesundheitskarte eröffnen und halt irgendwo mitten in der Cloud ihre Krankenakten parkieren. […] Hier steht uns einfach diese gelebte Schweizer Behäbigkeit, die dem Ganzen eher entgegenwirkt, im Wege. Also, einen echten Leuchtturm in der Schweiz zu suchen ist etwas schwierig. Ich stelle das dann noch viel mehr fest, wenn ich in den Bereich der Systeme schaue. […] Wenn wir die Klinikinformationssysteme (KIS) anschauen, dann stehen wir vor Systemen, die müssen alle abgelöst werden, die haben ihren technologischen Lebenszyklus überwunden. Die gehören eigentlich ins Altersheim, wenn man so will. Komponenten wie Workflows sind diesen Systemen gänzlich fremd. Und egal, mit wem ich rede und was ich höre, das ist ein Strukturproblem. Das Problem sind nicht die Leute, die keine Software herstellen könnten, sondern der Schweizer Markt ist einfach zu klein. Wenn wir etwas Grösseres wollen, dann schauen wir nach Amerika. Dann sprechen wir aber von nationalen Lösungen und brauchen nur noch ein KIS für die ganze Schweiz, weil das entspricht dann in etwa so der Grösse, wo die Amerikaner normalerweise unterwegs sind. Aber da gibt es doch vielleicht ein Leuchtturmprojekt im Kantonsspital Luzern, welches mit «Epic» ein Riesending auf den Boden zu bringen versucht. Da schaut nun die ganze Branche hin und wir wissen noch nicht, ob dieser Leuchtturm in der Brandung steht oder ob der Sturm am Ende kräftiger ist als der Leuchtturm. Und da schauen nun alle zu und wenn es schiefgeht, dann können wir alle ohne böse zu lächeln sagen «das war ja zu erwarten». Und wenn es gutgeht, können wir sagen «herzlichen Dank liebes Kantonsspital Luzern - wir schliessen uns da nun gerne an. […] Aber in der Gesamtvernetzung stehen wir wirklich am Anfang. Das Beste am EPD ist, dass man plötzlich mit Leuten aus der Spitex am gleichen Tisch sitzt. Das Interesse ist jetzt geweckt und andere Leistungserbringer machen sich Gedanken darüber, wie man anders zusammenarbeiten könnte, obwohl niemand Geld dafür hat». Frage 4: Gibt es im Spitalwesen Technologien und Trends, die sich etablieren? Operationsroboter haben Sie schon genannt. Gibt es weitere die plötzlich auf dem Radar sind? Antwort: «Rein technologisch wird sich das Spitalwesen vom heutigen System, dass man zwischen jeder Fachapplikation eine Beschreibungssprache (HL7) hat, verabschieden und eher mit Service-BusKomponenten arbeiten. Da haben alle Beteiligten einen besseren Zugriff auf die Daten. […] Da spricht jetzt der IT-ler aus mir, leider hat heute noch jeder Lieferant, z.B. eines Ultraschallgerätes eine eigene Software. […] ». 147 Frage 5: Laut einer 2015 veröffentlichen Studie wird dem Gesundheitswesen prophezeit, dass es erst später als andere Branchen, dafür umso heftiger von der Disruption erfasst wird. Wie schätzen Sie diese Aussage ein? Antwort: «Ich habe es schon angetönt: Ich denke, Player wie Apple sind sich extrem am Vorbereiten im Gesundheitsmarkt eine Rolle zu spielen und die denken halt nicht nur national. Die denken nicht an Gesetze, Grenzen oder Services. Die bieten einfach etwas an, was die Leute begeistern wird. Gerade im Gesundheitswesen kämpfen wir permanent mit Personalproblemen. Also, im Gegensatz zu anderen Branchen muss man sich im Gesundheitswesen nicht mal Gedanken machen, dass so viele Arbeitsplätze verloren gehen durch die Disruption. Wir haben heute schon zu wenig Leute, die in ein paar Jahren Leute wie mich pflegen. […] Disruption wird zwar kommen, aber ich glaube weniger, dass sie in der traditionellen Medizin kommt, sondern eher im ganzen dispersen Unterstützungsbereich. Und ich vergleiche es wirklich mit dem selbstfahrenden Auto, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ein Auto selber fährt. Das nimmt mir doch den letzten Lebensspass weg und heute stelle ich fest, dass ich so was von der Schnauze voll habe von den Strassen und Staus, wo ist denn da noch der Spass? […] Ich glaube, das Annehmen, das wird die grosse Disruption sein. […] ». Frage 6: Eine Anschlussanfrage. Sie als St. Claraspital, zittern Sie wegen Google, Amazon und Apple? Machen Ihnen diese Unternehmen Bauchweh oder wie stehen Sie denen gegenüber? Antwort: «Ich glaube nicht, dass jemand in diesem Haus auch nur das geringste schlechte Bauchgefühl hat, weil sich womöglich noch gar niemand überlegt hat, was das für eine Konsequenz für uns haben könnte. Auf der anderen Seite sind wir als Privatspital permanent daran uns neu zu finden und uns zu überlegen wer wir sind und wer unsere Partner sind. […] Das ist etwas, was uns natürlich beschäftigt, permanent beschäftigt. Vielleicht sind wir dann einmal ein Spital von Apple. Ich weiss es nicht. Ich denke, für uns ist die Frage «Wer sind wir?» und «Was machen wir?» wichtiger. Wir haben eine klare Strategie und haben uns klar fokussiert auf die Kernbereiche in denen wir stark sind und stark bleiben möchten. Darüber versuchen wir uns zu definieren. Aber die Frage ist absolut berechtigt. Ich glaube, im Moment ist es nicht einmal die Frage ob uns Apple oder Amazon ärgern und bedrängen, sondern wie sich ein Spital-Aufenthalt verändern wird. Da gibt es eine Verschiebung vom stationären zum ambulanten Bereich. Das sind unsere aktuellen Herausforderungen. Die verlangen schon genügend Digitalisierungsbemühungen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass diese grossen Bestrebungen von Apple & Co. jetzt zuerst einmal in Amerika, China oder noch viel mehr in Indien stattfinden. In so grossen Gebieten, die von der Versorgung her prädestinierter sind, als die überversorgte Schweiz». 148 Frage 7: Das Thema Digitalisierung betrifft die Unternehmenskultur im Spital. Welche kulturellen Herausforderungen sehen Sie hier? Antwort: « […] Wir arbeiten jetzt mit unserer Digitalisierungsstrategie an Themen wie Spital 4.0. In unserer heutigen Betrachtung haben wir erst ein Spital 2.0. Das ist jetzt ganz gemein gesagt, trifft aber die Realität schon. Wir stellen fest, im kulturellen Bereich, haben wir in vielen Spitälern Leute, die keine Maus bedienen können. Sie finden in den Spitälern Leute die plötzlich mit der Maus über den Bildschirm fahren und versuchen etwas zu positionieren. Leute, die durften bis heute diesem digitalen Thema aus dem Weg gehen. Und wir merken das immer wieder, dass sobald irgendwas mit elektronischem Gerät zu tun hat, dass man dann einfach die IT anruft. […] Da haben wir schon eine ziemlich grosse Hürde. Ich denke den Grossteil der Mitarbeitenden haben wir damals erreicht, als wir die ganze Pflege- und Arztdokumentation mobil, also mit Notebooks, auf die Station gebracht haben. Da konnte sich niemand mehr vor der Informatik retten. Und jetzt haben wir heute noch im OP-Bereich die letzten User, die am Arbeitsplatz keinen PC haben. Wir haben sehr viele Leute, die von der Informatik nicht viel verstehen wollen, weil sie sie noch nicht benutzt haben. […] Aber die private Durchdringung der Digitalisierung kommt uns natürlich entgegen. Aber auch dort gibt es etliche Mütter, die das ihren Kindern oder ihren Männern überlassen und wir haben bei uns im Spital viele Frauen und da spüren wir schon, dass der Zugang zu Technologie kleiner ist. Auf der anderen Seite stellen wir natürlich fest, dass die jüngere Generation, die mit Social Media aufwächst, neue Ansprüche stellt, Und das erlaubt es uns, neue Systeme einzubringen und von einer echten Digitalisierung zu sprechen. […] Ich kann mir vorstellen, dass wir in ein paar Jahren mehr mit Smartphones unterwegs sind, als mit PCs und da haben wir auch deutliche Bestrebungen mit unserer Kommunikationsstrategie. Ich habe z.B. einen Chef, der hat zwar ein Telefon auf dem Tisch aber das braucht er kaum noch, der ist immer mit seinem iPhone unterwegs, weil das intelligenter ist. Damit kann er machen, was er braucht. Und ich denke, der Nutzen geht viel mehr in diese Richtung. […] Im praktischen Nutzen und im praktischen Umgang, denke ich, wird sich sehr viel verändern und das ist gut, denn das lässt uns schneller interagieren». Frage 8: Digitalisierung ist teuer. Wo hänge ich sie organisatorisch auf? Eher «Top-Down» oder «Bottom-Up»? Antwort: «Da kann ich sagen, dass wir in diesem Bereich ein Musterknabe sind. […] Ich habe meine Rolle als Leiter IT «verloren» - mein neuer Chef bringt eine industrielle Erfahrung mit, die kann ich gar nicht einbringen. Ich finde, schon da zeigt sich, dass wir ein Musterbeispiel sind. Der Verwaltungsrat hat gesagt, Digitalisierung muss ganz oben beginnen, weil sonst versandet das in irgendwelchen Eigeninitiativen. […] Wenn man das im Unternehmen nicht zuoberst ansiedelt, dann verpasst man den Zug, weil Sie die Geschäftsleitung schon gar nicht mehr erreichen. Dann denkt nämlich jeder 149 weiter in seinem Bereich wo er sowieso schon 14 Stunden und mehr unterwegs ist und hat gar keine Zeit, um sich mit digitalen Themen auseinanderzusetzen. Von dem her finde ich das toll, dass wir nicht einfach einen «Digital Officer» bekommen haben, wie das der Hype ist. […] Digitalisierung und Innovation bringt uns vorwärts im Denken, weil Innovation ist nicht einfach etwas Lustiges, es beginnt mit Erfinden, mit Neuem schaffen. Und dazu braucht es gewisse Strukturen und ein Interesse von ganz oben. […] Ich sehe schon, dass die verbale Durchdringung bei meinen Chefs massiv besser ist als vorher, weil ich einfach nicht auf dieser Ebene mit den Leuten kommunizieren konnte. […] Ich spüre, die Ausstrahlungskraft, die ist viel stärker wenn sie von ganz oben kommt. […] Mein Chef nimmt die Bereiche in die Verantwortung, der sagt «Entschuldigung, alle diese 100 «IT»-Projekte, die wir seit Jahren immer mit uns herumschleppen, das sind eigentlich nur zwei ITProjekte. Das eine ist Server-Ersatz und das andere ist ein neues Klinikinformationssystem. Alles andere sind doch eure Projekte. […] Da geht es um Einführung von Wund-Dokumentation oder um ganze Abläufe in der Onkologie. Das sind doch eure Projekte». Und damit sind wir genau beim kulturellen Merkmal. Die Führungsverantwortlichen müssen das begreifen und nach innen tragen, dass nicht immer alles «IT» ist, sondern dass wir uns als Ganzes mit den Möglichkeiten der IT nach vorne bewegen wollen. […] ». Frage 9: Der digitale Fortschritt erfordert von Arbeitnehmern ein Umdenken und den Aufbau von neuen Fähigkeiten. Welche sind das im Spital? Antwort: «Ich denke, das ist manchmal wie die «Huhn-Ei-Frage». Wenn ich einfach so traditionell in unser Spital reinschaue hätte ich vor ein paar Jahren zu allen gesagt, dass sie ihre PCs bedienen können müssen. Heute glaube ich, dass uns diese Fähigkeiten langsam aber sicher überholen und die Leute mit Anforderungen an Tools und Systeme kommen, welche wir nicht mehr einfach so erfüllen können. […] Ich erlebe immer wieder User, die sagen «das muss doch so sein wie bei Google!» und denen sage ich dann, dass sie sich bewusst sein müssen, dass bei Google im Moment vielleicht gerade tausend Programmierer damit beschäftigt sind, diese eine Funktion für die ganze Welt herzustellen. Und unsere Systemlieferanten, die haben eine Durchlaufzeit von 2 Jahren für die kleinste Anpassung der Funktionalität und dann ist das ein kundenspezifisches und -relevantes Projekt. Das sind die einfach ganz anderen Realitäten. Und es will alles bezahlt sein. Ich denke, die Vorbereitung der Leute darauf ist enorm wichtig. […] Ich glaube nicht mehr, dass man einfach jetzt echte IT-Skills aufbauen muss, so wie früher, wo jeder seinen Excel- oder Word-Kurs machen musste. […] ». 150 Frage 10: «Digitalisierung vernichtet Jobs» höre ich immer wieder. Andere behaupten, dass damit neue geschaffen werden. Wie sieht das im Spital aus? Antwort: «Wir erlebten das ja schon mit der «EDV-isierung». Ich habe mit Digitalisierung jetzt seit über 20 Jahren zu tun. Es ist immer das Gleiche. Wenn ich zurückschaue, als ich hier vor 13 Jahren angefangen habe dann war mein erstes Projekt die Einführung der Spracherkennung bei den Radiologen. Als ich ein halbes Jahr später dort hineingekommen bin, habe ich gefragt «wo ist denn das Büro von euren Sekretärinnen hingekommen?». Und dann haben die mir alle gesagt, dass sie jetzt genau noch eine haben, die ihnen noch ein bisschen hilft. Also, da gibt es schon Veränderungen. Und diese sorgen dafür, dass wir die heutigen Durchlaufzeiten in einem Spital überhaupt hinbekommen. Es ist nicht nur so, dass der Patient schneller gesundwerden soll, sondern dass man einfach viel mehr Fälle hat und dass es viel mehr abgeht in einem Spital. […] Ich sehe es an der Informatik selber, denn das Wachstum ist, gegenüber anderen Abteilungen, überdurchschnittlich. Das Wachstum von technisch orientierten Berufen ist massiv. […] Aber die ganze Medizininformatik ist völlig unterdotiert und entsprechend kommt sie fast nicht vom Fleck. […] Auf der anderen Seite hoffe ich tatsächlich, dass es im pflegerischen Bereich keine Veränderung gibt. Ich glaube, dort wo man am Schluss direkte Mensch-Mensch-Kommunikation oder MenschMensch-Behandlung hat, sollte man nicht reduzieren. Das ist eine Kernkompetenz eines Spitals und sonst kann man sich wirklich überlegen, ob das Unternehmensmodell Spital nicht veraltet ist». Frage 11: Was bedeutet das für die Aus- und Weiterbildung im medizinischen Bereich? Muss ein Arzt seinen Operationsroboter nicht nur bedienen sondern auch programmieren können? Antwort: «Weniger. Nein, das habe ich zuletzt gerade diskutiert. Wann hat man die Stufe überwunden, wo man die Basis nicht mehr erkennt auf der man aufbaut. Ist manchmal eine wissenschaftliche Diskussion. Kann man ein System aufbauen, das schon auf einem System aufgebaut ist, das man nicht mehr kennt? Gibt es da dann Kausalprobleme? Ich kenne das von der Informatik, ich weiss nicht mehr wie der Assembler funktioniert. Ich weiss nur, da war mal was mit 0 und 1 aber das interessiert keinen Menschen mehr. Vielleicht noch einen Chip-Hersteller. Aber die Befähigung ist, diese Technologien einfach selbstverständlich anzunehmen und anzuwenden. Ich denke, das gehört zur Grundausbildung». 151 Frage 12: Wie erleben Sie die Aufgeschlossenheit, gerade vom medizinischen Fachpersonal, gegenüber Digitalisierung und den technologischen Themen? Kopfschütteln oder Interesse? Antwort: «Die Reaktionen sind sehr verschieden und, exemplarisch, am breitesten bei den Ärzten zu finden. Die Pflege ist tatsächlich noch sehr oft traditionell. Die sehen einen praktischen Nutzen in WhatsApp - das könnte für die Pflege erfunden worden sein, weil es einfach praktisch ist. […] Bei den Ärzten ist die Spannbreite brutal breit. […] Ich erlebe bei uns Ärzte, das wären die besten Programmierer. Die haben das extrem gut im Griff. […] Wenn ich bei den Radiologen bin, dann denke ich die waren vor 10 Jahren schon weit voraus gegenüber den Anderen. Die sind heute etwa 30 Jahre voraus. Die denken extrem weit. Die interessieren sich für Artificial Intelligence. Die interessieren sich dafür, dass in diesen komischen grauen Flecken vielleicht doch noch was interpretiert werden könnte, dass man schon fünf Mal in Amerika festgestellt hat. Die sind extrem. […] Dort ist ebenfalls die Hinterfragung ihres Jobs absolut real. An einem Rückenkongress wird heute öffentlich darüber diskutiert, ob es ihren Job in 3 Jahren noch gibt oder ob der sich völlig verändert hat. Vor 2 oder 3 Jahren wäre jemand erschossen worden, der sowas auf einem Rückenkongress erzählt hätte. Und heute ist das gelebte Realität. Und in 10 Jahren wird vermutlich ein Radiologe etwas Anderes sein. Schon nur wegen den Robotern und deren künstlicher Intelligenz. […] ». Frage 13: Daten sind das Gold der Neuzeit. Und gerade im Spital werden viele sensitive Daten generiert. Was hat diese Datensammlung für Implikationen auf Ihren Betrieb, auf Ihr Geschäftsmodell? Antwort: «Wir haben jetzt neu eine Forschungsabteilung, von dem her sind wir erst am Beginn von Überlegungen, was wir mit Daten anfangen. Wir sind aber ebenfalls kein Universitätsspital, sondern wir haben unsere Kernpunkte. Und unsere Forschungstätigkeit, die orientiert sich an unserer Kernaufgabe. […] Wir sind an ersten Überlegungen dran, mit der Universität Basel und mit dem Universitätsspital zusammenzuarbeiten. Und dort wird diese Frage dann sicher relevant. Aber ich glaube nicht, dass in diesem Haus jemand beabsichtigt, die Daten zu kommerziellen Zwecken zu nutzen, sondern sie stehen im Zusammenhang mit noch besserer Versorgung, noch besserer Diagnose für unsere Patienten in unserem Kernbereich. Und dort werden wir eher sagen, unsere Daten kombiniert mit anderen Daten, das gibt neue und bessere Informationen. Wir haben hier nur 200 Fälle, auf der Welt gibt es aber 2 Mio. Fälle, wieso sollen wir nicht unsere 200 mit denen vergleichen? Der Watson Roboter von IBM, der macht genau das gleiche, wie der Arzt, nur ist er einfach viel schneller und hat viel mehr Material zur Verfügung. Ein Chefarzt hat mal 5 000 KGs gesehen, aber der Watson schaut sich 500 000 in einer Sekunde an – und lernt unglaublich schnell. Da muss man sich als Arzt nicht messen wollen oder eifersüchtig sein. Ein Gerät ist so. Von dem her, denke ich, sind die Daten für den eigenen Gebrauch und die Identifikation von 152 Gesundheitssituationen unser Gold. Aber wir spüren das natürlich auch: Amazon lebt von den Daten, die wissen wie damit umzugehen ist und das muss man schon im Hinterkopf haben. […] Das Datenbewusstsein verändert sich natürlich ebenfalls in der Gesellschaft. Also, wenn ich meinen Kindern erzählen würde, was ich alles in Sachen Datenschutz unternehme, würden die mich mit offenen Augen anschauen und sagen «seid ihr total verrückt, das ist schade um das Geld. Hört doch auf. Wir brauchen das nicht!». […] Aber gemäss Datenschutz müssen wir die stark und gut schützen. Es würde sich schlechtmachen, wenn sich da ein Leck öffnet. Also von dem her, sind Daten nicht unsere Goldgrube. […] ». Frage 14: Welche Ressourcen sind erforderlich, damit Sie das Thema Digitalisierung überhaupt angehen können? Antwort: «Also, Sie brauchen sicher einfach mal Geld. Oder Sie müssen sich sagen, es sind jetzt nicht mehr 2 %, sondern 5 % von unserem Umsatz, die wir investieren. […] Darum ist das «Top-Down» so wichtig. Und ich denke es braucht sicher einmal so etwas wie «Digitalisierungsarchitekten» - das ist ein spontanes Wort. Also eine Mischung aus grosser Prozessbeobachtung, Prozesskenntnisse und Technologiewissen. Und da denke ich vor allem an Medizin-Technik. […]. Aber Geld ist immer das erste was man braucht, weil man muss digitalisieren wollen. Man muss da schon mal was investieren und dann muss man vielleicht auch einfach mal etwas versuchen. Da muss man einfach mal irgendwo zuvorderst sein wollen. Dann steht in der Zeitung «cool» oder es steht in der Zeitung «sie haben das und das versucht, so ein Schwachsinn!». Es kann eben beides sein». Frage 15: Risikobereitschaft muss also schon auch da sein? Antwort: «Ja, eine gewisse Risikobereitschaft muss da sein und man muss sich als Spital unserer Grössenordnung ganz klar überlegen, was kann man wirklich machen und was nicht. Man muss da für sich selber ein paar Leuchttürme definieren und damit Effekte erzielen wollen. Und dann muss man abschätzen, wo bringt uns Digitalisierung wirklich einen entsprechenden Nutzen. Und ich denke, die Wiesen sind da noch ziemlich ungemäht. […] Da gibt es verschiedene Möglichkeiten wirklich aktiv zu werden. Ich spüre es, dass man vermehrt umdenkt und hie und da mal ein paar Start-Ups unterstützt und sich so gewisses Knowhow ins Haus holt, um zu zeigen, was überhaupt schon alles möglich ist». 153 Frage 16: Wie erleben Sie die Patienten? Sind die denn bereit für digitale Angebote und Services im Spital? Sind sie sogar «bereiter» als die Mitarbeitenden? Antwort: «Nein, «bereiter» sind sie nicht. Aber das hängt vielleicht an unserem Spital. Wir haben sehr oft eher ältere Patienten, aufgrund der Gesundheitssituation (Krebs), die wir behandeln. Das sind wirklich oft ältere Patienten. Ich habe das einfach jetzt mal beobachtet, wie hat sich das Patienteninternet entwickelt. […] Heute bekommen wir böse Briefe, wenn das W-LAN nicht in einer wunderbaren Stärke, und natürlich gratis, funktioniert. Das ist so ein Beispiel, wo man sagen muss, da spürt man den Anspruch der Patienten. Anhand der Patientenfeedbacks spüren wir sonst aber eher wenig Ansprüche. Die kommen einfach zu uns oder kommen nicht. […] In ein Spital kommt man, weil es einem nicht gut geht und da braucht man einfach die beste Pflege oder Unterstützung. […] Aber so Spital- und Qualitätsvergleichsplattformen, die kommen schon. Und wir spüren natürlich schon auch, dass sich die Ansprüche der Patienten generell gesteigert haben. Wir müssen uns zum Teil wirklich mit Hotels messen. Und in Hotels kann man mit dem iPhone das Licht bedienen – das ist dann schon extrem. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Patienten kommen und sagen «ich komme nur noch in ein Spital, das einen voll integrierten Prozess mit meinem Hausarzt hat und ich rufe den an und der zeigt mir gleich auf seinem iPad alles was ich im Spital gesehen habe». Das ist zwar alles schön und nett, wird aber (noch) nicht vorausgesetzt. Es gibt ebenfalls sehr wenige Patienten, die uns sagen, ich hätte jetzt gerne noch alle meine Daten bei mir auf meiner Dropbox. Von dem her sind die Ansprüche der Patienten nicht der Digitalisierungstreiber». Frage 17: Bleiben wir gerade beim Stichwort «Treiber». Ist es denn das elektronische Patientendossier (EPD), welches der Treiber der Digitalisierung im Spital ist? Und was kommt denn nachher, wenn es da ist? Antwort: «Eigentlich ist das EPD das Letzte was wir wollen – wir wollen alles rundherum. Für uns steht die Zusammenarbeit im Vordergrund. Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit unsere Zuweisenden. Oder die Informationsbefähigung unserer Patienten. Und es geht darum, dass man die Prozesse verschlanken kann, dass man die Gesundheitsinformationen dem Patienten überall zur Verfügung stellt. […] Aber das Patientendossier als solches ist jetzt einfach eine Datensenke, wo alles drin versorgt wird. Und dann noch mit einer Freiwilligkeit, so dass ich als Patient nicht einmal sicher sein kann, ob das überhaupt aktuell ist und nicht das wichtigste fehlt. Also das ist eher weniger der Treiber. […] Es ist aber der Auslöser, dass man überhaupt einmal in der ganzen Schweiz über solche Systeme nachdenkt. Und der grosse Vorteil für die Schweiz ist dabei, dass man jetzt irgendwelche Schuldigen gefunden hat, die das berappen, nämlich die Spitäler, weil das wurde lang immer wieder diskutiert. […] Und jetzt sagt man den Spitälern, dass wir das EPD einfach bis 2020 anbieten müssen. Und irgendwann werden dann auch noch die anderen Leistungserbringer wie die 154 Spitex oder die Altersheime in die Pflicht genommen. […] Die haben aber keine Ahnung von IT und Digitalisierung und müssen die Anforderungen dann plötzlich erfüllen. Ich weiss wirklich noch nicht, ob das einen Riesenschuss nach hinten wird. Aber das Thema bewegt natürlich und von dem her ist es gut, dass man Themen wie Datenaustausch oder Datenverfügbarkeit von Gesundheitsdaten endlich mal auf breiter Basis diskutiert. […] Und das in einem öffentlichen Auftrag und damit in einem demokratischen Rahmen, der zur Schweiz natürlich irgendwie passt. Das ist der Leuchtturmeffekt davon. Aber EPD als solches selber, da gibt es so viele Beispiele, wie man dem wieder aus dem Weg gehen könnte, dass ich sagen muss, das alleine ist es nicht». Frage 18: Das Spital der Zukunft ist das noch ein Spital wie wir das heute kennen? Wie würden Sie das skizzieren? Antwort: «Da gibt es verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten. Ich meine, die Swisscom wäre ja auch nie auf die Idee gekommen SMS zu entwickeln, weil damit konnte man ja gar keinen Erfolg haben. Und trotzdem funktioniert es oder hat es funktioniert. Und von dem her ist es schwierig zu sagen wie das Spital in Zukunft aussehen kann. Ich sehe einfach verschiedene Wege und alle deuten darauf hin, dass sich die Spitäler verändern werden. […] Es gibt eine Entwicklung zu Arbeitsteilung. Also, die einen, die operieren nur und dann sind sie da besonders stark. Dann haben sie einfach ein Haus mit Operationssälen und entsprechendem Personal. Das ist so eine Tendenz. Wir haben uns jetzt auf die Fahne geschrieben, wir beherrschen einzelne Disziplinen, dafür die durchgängig so wie ein Universitätsspital. […] Ich denke, es gibt sicher einen geografischen Ort mit Betten, wo Menschen von Menschen gepflegt werden. Das ist sicher eine Kernaufgabe, die wird bestehen bleiben. Und dann denke ich gibt es sicher Bereiche wo Therapie stattfindet. So lange wie es noch ChemoTherapien gibt, wird man einen Ort brauchen, wo man diese Chemo-Therapien verabreicht, weil der Mensch muss dabei schon beobachtet werden, da gibt es ja teilweise heftige körperliche Reaktionen. Das bleibt sicher. Es gibt sicher Orte, wo man gebären will. Dort zeigt es sich am deutlichsten. Das sind keine kranken Menschen. Die wollen möglichst eine coole Umgebung, sich wohl fühlen und wohlfühlen hat nichts mehr mit Spital zu tun. […] Dann braucht es aber trotzdem Notfallstationen in der Nähe, für den Fall, dass einmal etwas schiefläuft. Aber ich möchte mich trotzdem in einer Wohlfühloase befinden. […] Von dem her wird das Spital sicher immer mehr Hotelcharakter haben. Das ist bei uns so. […] Unsere Sitzungszimmer sind jetzt richtig gut ausgestattet, das hätte ich mir vor einem Jahr nicht ausmalen können, wie viel Geld wir verwenden, um Sitzungszimmer einzurichten. Das ist das Feinste vom Feinen. In 2 Jahren findet das dann jeder selbstverständlich. Auf der anderen Seite kann es gut sein, dass ein Spital der Zukunft vielleicht sein Wissen virtuell mit anderen vernetzt und teilt und da sind wir dann wieder bei den Daten. Also das ärztliche Wissen wird vielleicht in grossen Wissensdatenbanken geteilt und jeder der angeschlossen ist kann beliebig davon profitieren. Es kann gut sein, dass man sich in der Branche so vernetzt. Und wer miteinander das Wissen teilt ist dann ein Spitalverbund. […] Und vielleicht entstehen auch 155 Franchising-Modelle wie bei McDonalds. Dort haben wir ein paar Operationssäle und dort in einem Haus die Betten. Wir als Spital liefern nur noch die Infrastruktur und begleiten das Ganze. Du kannst also einfach ein Operationshaus betreiben und ich stelle alles rein. Die Wände sind rot und die Türen gelb, oder im Spital eher weiss und blau, und dann ist alles klar. Aber das ist kein Modell, das in den nächsten 10 Jahren voll durchschlägt, dass die Spitäler sich völlig verändern. Dann hätten wir das schon irgendwo auf der Welt. Die Schweiz wird traditionell bleiben, weil wir uns das leisten wollen und (noch) können. […] Ich kenne von Deutschland her aber viel mehr die Tendenz, dass man z.B. eben solche Operationshäuser baut. Und mit der Ambulantisierung wird das bei uns sicher verstärkt kommen. Und dann braucht es Organisationen, die die Patienten länger zu Hause begleiten, was deutlich günstiger ist. Und wir kombinieren das einfach und nennen das dann noch Spital». Frage 19: Wenn Sie der Schweizer Spitalbranche eine Note geben könnten wie weit sie in der Digitalisierung sind, von eins (schlecht) bis fünf (sehr gut) - was wäre da Ihre Note? Antwort: «Höchstens eine 3, wegen all meinen Argumenten. Eigentlich gibt es so viele tolle Beispiele, die in den Spitälern möglich wären. Aus der Welt, wenn man das alles zusammennimmt, was da so möglich ist, dann sind wir völlig am Anfang. […] ». 156 8.6.6. Interview mit Herr Stefan Märke Interviewer Stefan Lienhard Interviewter Herr Stefan Märke, Consultant «Lean Hospital», Walkerpoject ag Datum Freitag, 16. März 2018 Ort Walkerproject ag, Prime Center 1, 8060 Zürich-Flughafen Frage 1: Guten Tag Herr Märke. Danke, dass Sie sich für mich Zeit nehmen. Können Sie zu Beginn bitte etwas zu Ihrem Werdegang, Funktion und Ihren wichtigsten Aufgaben sagen? Antwort: «Vielen Dank für die Anfrage. Ich bin Consultant bei Walkerproject. In dieser Funktion begleite ich verschiedene Transformationsprojekte im Gesundheitswesen, hauptsächlich in Spitälern. Vielfach sind es «Lean»-Transformationen auf prozessualer Ebene, also beispielsweise auf einer Station oder im Notfall wo generell die Arbeitsweise umgestellt wird. Es sind jedoch ebenfalls Projekte drunter, die sich eher auf strategischer Ebene abspielen. Da spielen auch die Angebotsplanung oder gewisse Fusionsüberlegungen mit rein. Auch bei der Frage «wie können wir das Spital der Zukunft baulich umsetzen?» werden wir herbeigezogen.[…] ». Frage 2: Vielen Dank. Eine allgemeine Einstiegsfrage: Ist das Schweizer Gesundheitswesen von der Digitalisierung erfasst worden? Wenn ja, wie zeigt sich das? Wenn nein, wieso nicht? Antwort: «Ich würde sicher sagen, es ist davon erfasst worden. Man hat zumindest ein hohes Bewusstsein dafür und weiss, dass es diese Digitalisierung gibt. Digitalisierung ist jedoch kein klar abgegrenzter Begriff. Wo beginnt sie und wo hört sie auf? Ist es schon digital, wenn ein Computer in der Ecke steht oder gehört doch noch mehr dazu? Ich denke, in den Köpfen ist die Bedeutung auch des Trends, auf alle Fälle angekommen». Frage 3: Gibt es bekannte Projekte und Initiativen, die eine Art Leuchtturmcharakter in der Branche haben? Antwort: «Ich weiss, dass im Luzerner Kantonsspital (LUKS) eine grosse Umstellung im Bereich des Enterprise-Ressource-Planning (ERP) stattfindet. Da wird «Epic» eingeführt. Ich denke, das LUKS ist das erste Spital, welches in der Schweiz etwas in dieser Grössenordnung anpackt. Und das wird 157 spannend sein, zu sehen, was dabei rauskommt. Meines Wissens sind die restlichen Initiativen eher kleinerer Art. Ich bin der Meinung, dass einzelne Spitäler teilweise auch in Richtung IoT gehen, aber ich weiss grad nicht mehr welches und wie da der Stand ist». Frage 4: Gibt es Trends und Technologien welche das Gesundheitswesen und die Spitäler verändern? Antwort: «Wenn man sich umschaut, sind die meisten technologischen Sachen eben technologisch getrieben. Man sieht sehr viel in Richtung Robotik laufen und da ist vor allem minimalinvasive Chirurgie ein Thema. Klar, das wird sicher Einfluss haben, insbesondere auf die Erbringung der Kernleistung. Allerdings glaube ich nicht unbedingt, dass dies eine riesige Veränderung bewirken wird, sondern es ist vielmehr eine Digitalisierung von Leistungserbringung, wie es schon heute gemacht wird. Digitalisierung als Unterstützung. […] Disruptive Potenziale sehe ich eher in Bereichen, wo es darum geht, dass tatsächlich der gesamte Patientenweg betroffen ist. Ich denke, dort ist momentan die Integration von Daten ein grosses Problem. Dass das in Richtung einer integrierten Krankenakte geht, wo ganz verschiedene Player drauf zugreifen können, sei dies Pharma oder Spitäler für die Forschung, der Patient zur reinen Information oder die Experten aus den Fachbereichen. Ich denke, das ist ein grosses Thema, was wiederum eine grundlegende Veränderung ermöglicht. Zum Beispiel, dass das Patientenbett vielleicht nicht mehr im Spital stehen muss, sondern an einem anderen Ort, weil eben dieser Informationsfluss gewährleistet ist. [...] Ich könnte mir vorstellen, dass es letzten Endes im Sinne einer vertikalen Integration immer interessanter wird, Versicherungsleistungen mit tatsächlicher Leistungserbringung zu verknüpfen. […] Es gibt auch den Spruch, dass aus dem Krankheits- ein Gesundheitswesen wird und dass der Fokus dadurch wechselt». Frage 5: In einer 2015 von Deloitte publizierten Studie wurde dem Gesundheitswesen prophezeit, dass es erst spät, dafür umso heftiger von der Disruption erfasst wird. Wie schätzen Sie das Disruptionspotenzial im Gesundheitswesen ein? Antwort: «Grundsätzlich hoch. Ich glaube, ich kann das Ergebnis der Studie intuitiv recht gut nachvollziehen. Das Gesundheitswesen ist aber ein hochkomplexes Gebilde, eine Expertenorganisation. Sehr vieles ist organisch gewachsen. […] In den letzten 100 Jahren hat sich relativ wenig verändert, in der Art und Weise, wie die Branche grundsätzlich funktioniert. Ich denke, wie zuvor angetönt, gibt es das Potenzial für ganz grundlegende Neuerungen». 158 Frage 6: Was bedeuten so Entwicklungen für die Leistungserbringer, also für Spitäler? Müssen sie zum Beispiel Angst haben vor Google, Amazon und Co.? Antwort: «Das ist schwer zu sagen. Zittern, vielleicht nicht gerade. Wenn es losgeht, denke ich, wird es nicht unglaublich schnell gehen. Es geht sicher nicht von heute auf morgen. Ich denke durchaus, dass diese Player in der Zukunft als Konkurrenten ernst zu nehmen sind. Sei dies vielleicht nur, weil sie wiederum die besten Fachpersonen, medizinisch gesehen, abwerben und schlussendlich dann dem Spital ein Leistungsbündel zurückverkaufen. Da könnte aber durchaus eine Machtverschiebung stattfinden, kann ich mir vorstellen. […] Wiederum sind diese Firmen Experten, wenn es darum geht, Daten zu nutzen und zu verknüpfen. Die haben keine Ahnung von Medizin. Die Frage ist: «Wer lernt schneller? Lernen die Spitäler schneller, wie man mit dem Potenzial von Daten umgeht oder lernen die Tech-Firmen schneller, wie man zuverlässig Medizin macht?». Frage 7: Die Digitalisierung verändert ebenfalls die Unternehmenskultur. Wie sehen Sie das, welche kulturellen Herausforderungen bringt sie im Spital mit sich? Antwort: «Digitalisierung ist ein Veränderungsprozess. Ich habe das Gefühl, ein Veränderungsprozess bringt immer dieselben Herausforderungen mit sich. Es geht darum, Leute auf die Reise mitzunehmen. Es geht darum, schnelle Erfolge zu erzielen und ein gewisses Momentum zu erzeugen. Es wird in diesem Veränderungsprozess ebenfalls Personen geben, die darauf nicht sonderlich Lust haben oder die eine längere Anlaufzeit brauchen, um sich mit den neuen Gegebenheiten abzufinden. [...] Die Herausforderung wird sein, dass man da einen integrativen Ansatz findet. Das ist oftmals erfolgsversprechend in so einer Change-Situation». Frage 8: Das erfordert ebenfalls von Ärzten und von der Pflege ein Umdenken oder einen Aufbau von neuen Fähigkeiten. Wie verändert Digitalisierung die Skills von medizinischen Fachpersonen? Antwort: «Ich glaube nicht, dass ein Arzt plötzlich programmieren können muss. Auch eine Pflegerin oder ein Pfleger nicht. Natürlich hilft es, ein gewisses Grundverständnis mitzubringen, falls mal etwas nicht funktioniert, kann man das dann vielleicht besser einordnen. Letztlich sind diese Lösungen, je länger, je mehr so benutzerfreundlich gestaltet, dass man nicht verstehen muss, was technisch dahinter passiert. Es gilt jedoch festzuhalten, dass man lernen muss, einen Operationsroboter zu bedienen. Genauso muss man lernen, wie man ein System in seiner Abteilung möglichst gewinnbringend einsetzt. Es nützt ja in der Regel nichts, wenn man einen Computer hinstellt und dann gleich arbeitet, wie zuvor. Man muss sich fragen «was eröffnen sich dadurch für Möglichkeiten, 159 anders zu arbeiten?». […] Ich denke, gerade in diesem Bereich, und da machen auch wir immer wieder die Erfahrung, ist es sehr schwierig, wenn man während vielen Jahren in einem System/in einer bestimmten Arbeitsweise drinsteckt, sich plötzlich schon nur vorzustellen, dass das grundlegend anders werden könnte. Es ist eine Herausforderung. Das wird vor den technischen Skills kommen, könnte ich mir vorstellen». Frage 9: Digitalisierung vernichtet Jobs, heisst es vielerorts. Andere meinen, dass neue geschaffen werden. Wie steht es um die Spitalberufe? Antwort: «Das ist ein Blick in die Glaskugel. Ich glaube, das ist sehr stark davon getrieben, was die Patienten wollen. Was ich weiss, ist beispielsweise, in Japan ist die demographische Entwicklung bereits fortgeschritten oder ausgeprägter, als hier bei uns in Europa. Da wird in der Pflege verstärkt beispielsweise gerade im Demenzbereich, auf Roboter gesetzt, die gewisse Pflegeaufgaben und Erhaltungsaufgaben übernehmen. Es gilt jedoch ebenfalls festzustellen, dass Robotik in Japan in der Gesellschaft bereits stärker verankert und akzeptiert ist, als bei uns. Letzten Endes wird es für ein Spital gerade da nicht möglich sein, etwas zu substituieren solange ein Mensch lieber von einem Menschen betreut werden will und nicht von einer Maschine. […] Ich glaube da ist es wichtig, den Patienten und seine Wünsche ins Zentrum zu stellen und da sehe ich ebenfalls einen Trend. Der Patient versteht sich immer stärker als Kunde und bringt seine Bedürfnisse aktiv ein, artikuliert diese. […] Neue Jobs entstehen auf alle Fälle. Diese neuen Systeme müssen verstanden und gepflegt werden, wie auch immer die dann genau aussehen. Ob dann unter dem Strich ein Plus oder Minus ist, denke ich, kann zu diesem Zeitpunkt niemand seriös vorhersagen». Frage 10: Ich hake hier gleich nach: in Japan gibt es schon Pflegeroboter. Wenn das in der Schweiz zum Thema wird, dann geht auch die ganze ethische Diskussion los. Oder wird die schon geführt? Antwort: «Das ist jetzt ein sehr subjektiver Eindruck von mir. Ich habe das Gefühl, dass es für viele Personen nicht vorstellbar ist, dass dies bei uns jemals oder in der näheren Zukunft der Fall sein wird. […] Insofern findet die Diskussion statt, bzw. hat stattgefunden. Da sind alle derselben Meinung. Da gibt es nicht mehr viel zu diskutieren. […] ». 160 Frage 11: Sagen wir mal, die Robotik setzt sich durch, dort wo Prozesse automatisiert werden können, wo es um Routinearbeiten geht. Könnte das für die Pflegenden nicht positiv sein, damit sie wieder mehr Zeit am Patienten verbringen können? Antwort: «Ja, ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei sicherheitsrelevanten Tätigkeiten wie Medikamente sortieren für verschiedene Patienten und Tageszeiten, ein Roboter ziemlich sicher besser ist, als ein Mensch. Wenn der Roboter einen Fehler macht, wird das erkannt oder es gibt einen Error. Beim Menschen fliegt draussen am Fenster ein Vogel vorbei und schon ist das Medikament im falschen Behälter. Ich denke, in diesem Bereich macht es absolut Sinn, diese Technologien zu nutzen». Frage 12: Also wenn die Spitäler vom Gesetzgeber her zu höheren Qualitätsforderungen und -standards verdonnert werden, dann müssen die Spitäler ja noch mehr drauf schauen, dass die Fehlerquote gleich Null ist. Da könnten ja Roboter oder künstliche Intelligenz schon an Relevanz gewinnen, oder? Antwort: «Ja. Ich glaube, es ist die Frage, ob man nur die Fehlerquote anschaut oder letzten Endes das Ergebnis einer Behandlung. Wie schnell wird ein Patient gesund? Da spielen wiederum sehr viele subjektive Faktoren rein. Man weiss, dass auch das psychische Wohlbefinden einen grossen Einfluss auf die Heilungsgeschwindigkeit hat. […] ». Frage 13: Wo und wie hänge ich das Thema Digitalisierung oder digitale Transformation, als Spitaldirektor organisatorisch auf? Ist das eher «Top-Down» oder «Bottom-Up»? Antwort: « […] Ich würde das «Top-Down» aufhängen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits sind die Personen an der Basis sehr stark im Tagesgeschäft eingebunden. Das ist das, warum es geht, die wollen nicht Digitalisierung betreiben, die wollen Patienten pflegen. Darum arbeiten sie in dieser Branche. […] Wiederum ist Digitalisierung, wenn man auf disruptive Lösungen setzt, erst einmal teuer und kostet viel. Der Effekt davon ist aktuell auch noch sehr schlecht spür- oder messbar. Wenn man da wirklich eine Wirkung erzielen will in seinem Unternehmen, glaube ich, braucht es eine übergeordnete Strategie. Und dazu braucht es einen gewissen «Top-Down» Aspekt. Und es braucht eine Vision: «In 10 Jahren sind wir in diesem und diesem Aspekt führend. Wir müssen das und das und das machen, um da hinzukommen und wir gehen da bewusst voran». Ich glaube anders wird das in einem so komplexen System unglaublich schwierig». 161 Frage 14: Sie haben gesagt, das medizinische Fachpersonal ist an der Basis, im Tagesgeschäft und das wichtigste ist der Patient. Sind sie denn überhaupt bereit für Digitalisierung? Antwort: «Ich glaube, grundsätzlich sind sie sehr bereit. Unter der Voraussetzung, dass sie eine echte Verbesserung spüren. Wenn man dem Arzt z.B. zeigen kann «schau, wenn der Patient mit diesem Armband überwacht wird, bis er das nächste Mal wieder in der Praxis ist, erzielst Du statistisch um 20 % bessere Resultate», dann wird der Arzt keine Minute zögern und das einführen. Und auch bei der grossen Mehrheit, also in der Pflege. Wenn da die Lösung kommt, die ihnen pro Tag 10 - 15 Min. schenkt, da wird man nicht auf Widerstand stossen». Frage 15: Sehen Sie da Unterschiede vom Alter her? Sind z.B. ältere Ärzte verschlossener gegenüber der Digitalisierung als ihre jüngeren Kollegen? Oder haben Alter und Erfahrung hier keinen Einfluss? Antwort: «Ich tendiere zum Zweiten, dass das bunt gemischt ist über die Altersklassen. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass jüngere Personen stärker bereits mit der Technologie aufgewachsen sind und es da eventuell natürlicher ist oder man ist es stärker gewohnt. Aber nichts destotrotz, gerade Ärzte beschäftigen sich sehr stark mit medizinischen Innovationen. Man ist es sich in der Medizin gewohnt, dass sich Dinge schnell verändern und dass immer wieder etwas Neues, etwas Besseres und etwas technisch Ausgereifteres kommt. Ich glaube, da sind die Voraussetzungen vom «Mindset» her recht gut». Frage 16: Daten sind das Gold der Neuzeit. Und gerade im Spital werden sehr viele höchst sensitive Daten generiert. Was hat das für Implikationen auf ein mögliches Geschäftsmodell von einem Spital? Was eröffnen sich hier für Möglichkeiten? Antwort: « […] Ich glaube, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Viele liegen vielleicht aktuell noch gar nicht auf der Hand. Ich glaube, es wird sehr stark regulatorisch geprägt sein, was man mit diesen Daten tatsächlich machen darf und was nicht. Es wird eine politische Entscheidung sein. […] Ein dynamisches Pricing in allen Bereichen ist denkbar. […] Man könnte die Daten ja auch auf dem Arbeitsmarkt nutzen und bei der Personalbeschaffung Gesundheitskriterien hinzuziehen. […] Da gibt es viele Dinge, die wir sehr wahrscheinlich als Gesellschaft gar nicht wollen, wenn man da an den sozialen Gedanken denkt. Je genauer man weiss, wer derjenige ist, der in einer bestimmten Beziehung über die Stränge schlägt, man sieht das ebenfalls in Zeitungen, Zeitungskommentaren, desto geringer ist die Bereitschaft, als Gesellschaft dafür geradezustehen. […] ». 162 Frage 17: Welche Ressourcen sind erforderlich, damit ich das Thema Digitalisierung im Spital angehen kann - technologisch, finanziell und personell? Antwort: « […] So, wie ich die Sache sehe, ist das limitierende die finanzielle Seite. Wenn man genügend Geld hat, findet man die Spezialisten, die einem mit Knowhow helfen und man kann sich die entsprechenden Technologien einkaufen. […] Die Spitäler haben nicht so viel freie Mittel. Da gilt es wiederum Mittel und Wege zu finden, wie die aktuellen Prozesse so weit verschlankt werden können, damit diese Mittel frei werden – auch zeitlich. Zeit ist ein bekanntes Problem. Es gibt einen Mangel an Fachpersonen, die sind alle hoch ausgelastet. Dass diese Personen dann auch Zeit haben und die Organisation das nötige Geld, um solche Entwicklungen intern treiben zu können, das ist die Krux an der Sache. Das ist die heikle Kombination, dass das Tagesgeschäft einem die Möglichkeit zur Innovation wie aufsaugt». Frage 18: Wie schätzen Sie die Patienten ein? Sind sie offen für digitale Angebote und Services im Spital? Antwort: «Ich glaube, dort ist ebenfalls die Ausgangslage, wenn man dem Patienten glaubhaft vermitteln kann, dass Digitalisierung für ihn einen Nutzen hat, gesundheitlich sowieso, dann wird auch jemand, der nicht so Lust darauf hat, plötzlich willig. Ich glaube, gerade, wenn es um Dinge geht, die eher für das Spital einen Nutzen bringen und nicht für den Patienten, ist es sinnvoll, dem Patienten eine gewisse Wahlfreiheit zu lassen. Gerade dadurch, dass sehr viele Patienten etwas älter sind und noch wenig Erfahrung im digitalen Bereich haben, ist das wichtig. […] ». Frage 19: Wenn Sie so maximal 5 Technologien herauspicken, die für Spitäler besonders relevant sind oder sein können, welche wären das? Antwort: «Ich glaube, die Big Data und Artificial Intelligence-Kombination ist sicher weit oben mit dabei. Das ist aber auch etwas vom Schwierigsten, um es wirklich in die bestehenden Systeme sinnvoll zu integrieren. Aber das hat ein enormes Potenzial. Dann sehe ich auch das Internet of Things bis hin zu Wearables, zu smarten Pflastern, zu Medikamenten, die sich selber dosieren, wenn man sie mal geschluckt hat, also diese ganze Mini-Chip-Sache, die miteinander kommunizieren. Da sehe ich grosses Potenzial. […] Dann gibt es einige technologische Entwicklungen, wo man sagt, wir können gewisse Elemente so klein bauen, dass wir den Körper nicht mehr aufschneiden müssen. Wir können eigentlich ein Mini-Operationsinstrument injizieren und dieses dann von aussen steuern. Es gibt gewisse Entwicklungen im Bereich der Augenchirurgie, die ich kenne. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort ebenfalls medizinisch noch ganz andere Möglichkeiten gibt. Weil man wirklich auf 163 dieser Mikroebene eigentlich im Organismus tätig werden kann, was man bisher nicht konnte. […] Ja, und nicht zuletzt Blockchain im Zusammenhang mit der ganzen Datenverarbeitung, das ist sicher ebenfalls ein Punkt». Frage 20: Ab April 2020 muss ich von Gesetzes wegen als Spital meinen Patienten ein elektronisches Patientendossier (EPD) anbieten. Ist das der aktuelle Treiber der Digitalisierung im Spitalwesen? Und was geschieht bzw. kommt danach? Antwort: «Ich weiss nicht, ob «Treiber» das richtige Wort ist. es ist viel mehr, aus meiner Sicht, eine Voraussetzung für sehr viele andere Dinge. […] Das ist eigentlich so der Hygienefaktor der Digitalisierung. Dass man ein Datensystem hat, an das sich an- und aufbauen lässt und das integriert ist. Und nicht ein, wie man es heute von vielen Orten kennt, ein organisch gewachsenes, sehr individuelles System, das letzten Endes ein Flickenteppich ist, der über die Jahre gewachsen ist. Wenn man da an einem Eck etwas ändern will, gibt es enorme Änderungskosten für das Gesamtsystem. Was es wiederum beispielsweise unmöglich macht, dass jemand einfach einmal etwas ausprobiert. […] Von daher denke ich, wenn das EPD eine mehr oder weniger einheitliche Lösung ist, dann ist das ein unglaublicher «Enabler» für sehr viele weitere Dinge. Wohin es noch geht, glaube ich, ist sehr stark vom Selbstverständnis der Organisation abhängig. Davon wo sie aktuell Probleme hat, wo sie Chancen sieht. Ich glaube, das ist so global fast nicht zu beantworten». Frage 21: Wenn das Spital der Zukunft irgendwie skizzieren könnten, wie sieht das aus? Ist das noch ein Spital, wie wir es heute kennen? Antwort: «Da fliegt der Ball jetzt ganz schön weit nach vorne, wenn ich sage, Spital der Zukunft. Ich glaube, der nächste Schritt ist erst einmal, die Prozesse grundlegend zu überdenken und da mal einen «Match» zwischen Infrastruktur, Prozessen und Rollen herzustellen. […] Ich glaube nicht, dass es Richtung Patientenhotel geht. Einerseits, weil es medizinisch nicht besonders hilfreich ist, wenn Patienten im Bett liegen. Das versteht man immer besser. Und ja, genau dieser «Hotel-Teil» ist eigentlich der, welcher sich outsourcen liesse. […] Und wiederum: Ich glaube, die Expertise, das Zusammenbringen von unterschiedlichsten Experten wird im Spital eine immer wichtigere Rolle werden. Auch dieses ganze Wissensmanagement rund um einen Krankheitsfall, das wird entscheidend werden für das Spital». 164 Frage 22: Also Sie meinen solche Gebilde wie die «Tumor-Boards» in der Onkologie? Antwort: «Genau. So, dass man sagt, es ist mehr eine Systemleistung. Und dieses System ist dann eigentlich der Orchestrator, das könnte ich mir vorstellen, dass die Spitäler sich in diese Richtung mittelfristig bis langfristig aufstellen werden. Aber wiederum ist das noch so weit weg, dass hier in der Schweiz aktuell noch niemand sein Spital, wenn ein Neubau geplant wird, auf so ein Geschäftsmodell fussen wird». Frage 23: Auf einer Skala von eins (schlecht) bis fünf (sehr gut), welche Note kriegen die Schweizer Spitäler in Sachen Digitalisierung? Antwort: « […] Schwierig zu sagen. Ich würde sagen eine 2, weil das Faxgerät noch überall präsent ist. Und wenn Sie wissen, was heutzutage möglich wäre und dann sehen, wie viel davon umgesetzt ist, dann sind wir nicht sehr weit, oder? Da stecken wir doch wirklich noch in den Kinderschuhen. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht sehr weit, wenn wir das mit Europa oder Nordamerika vergleichen. International denke ich, ist sicher Skandinavien in gewissen Sachen sehr stark entwickelt, sicher auch politisch bedingt. Weil man da, ja, andere Strukturen hat. In den USA gibt es gewisse Leuchttürme, die schon sehr stark digitalisiert sind. Wo es dann ebenfalls in Richtung Veränderung des Geschäftsmodells geht. […] Wiederum weiss ich, dass in Deutschland die Probleme noch ganz wo anders liegen. Also da wagt man an manchen Orten schon gar nicht an Digitalisierung zu denken. […] ». Schlusswort: Herzlichen Dank, wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank für das offene Gespräch und die ausführlichen Antworten. Antwort: «Gerne geschehen, Danke auch!». 165 8.6.7. Qualitative Inhaltsanalyse Oberkategorie (OK) Ankerbeispiele Unterkategorie (UK) Definition UK 1.1. Stand der Digitalisierung Informationen über den Fortschritt der Digitalisierung im «Wir sind nicht soweit, wie wir Schweizer Gesundheitswesen. Beschreibung von alle gehofft und geglaubt politischen, kulturellen und technologischen Faktoren. haben. […] Ich bin der Gründe für den aktuellen Stand. Überzeugung, das hat damit (Frage 1 = F1) zu tun, dass das Gesundheitswesen generell noch nicht so digital ist, wie es sich vielleicht OK 1. die Industrie vorstellt, weil Digitalisierung im einfach das Bedürfnis noch Gesundheits- und nicht da ist» (Frangi, 2018, S. Spitalwesen 126, F2). UK 1.2. Projekte & Initiativen Informationen zu relevanten (Leuchtturm)-Projekten aus «Ich weiss, dass im Luzerner der Gesundheitsbranche mit Fokus auf Spitäler. Kantonsspital (LUKS) eine grosse Umstellung im Bereich des Enterprise-RessourcePlanning (ERP) stattfindet. Da wird «Epic» eingeführt. Ich 166 denke, das LUKS ist das erste Spital, welches in der Schweiz etwas in dieser Grössenordnung anpackt» (Märke, 2018, S. 157, F3). UK 1.3. Trends Informationen zu aktuellen und aufkommenden Trends «Das war eben einerseits das in der Gesundheits- und Spitalbranche. Thema «elektronisches Patientendossier», das ist natürlich ein ganz heisses und aktuelles Thema» (Angerer, 2018, S. 138, F5). UK 2.1. Disruptionspotenzial OK 2. Disruption im Gesundheitswesen Informationen zur Wahrscheinlichkeit, dass die «Disruption wird zwar Gesundheitsbranche und mit ihr die Spitäler von der kommen, aber ich glaube Disruption erfasst werden. Einschätzungen zu den weniger, dass sie in der möglichen Auswirkungen. traditionellen Medizin kommt, sondern eher im ganzen dispersen Unterstützungsbereich» (Laukemann, 2018, S. 148, F5). 167 UK 2.2. Leistungserbringer Bedeutung der Disruption bzw. des Disruptionspotenzial «Ich denke, die Disruption für Leistungserbringer und speziell für Spitäler. findet aber langsam statt und ganz offensichtlich sehen wir das eigentlich bei den ambulanten Leistungserbringern. […] Telemedizin ist so ein disruptiver Bereich» (Frangi, 2018, S. 128, F6). UK 3.1. Unternehmenskultur Beschreibung der möglichen Auswirkungen der «Digitalisierung ist ein Digitalisierung auf die Unternehmenskultur im Spital. Veränderungsprozess. Ich habe das Gefühl, ein Veränderungsprozess bringt immer dieselben Heraus- OK 3. forderungen mit sich. […]. Es Auswirkungen der geht darum, schnelle Erfolge Digitalisierung zu erzielen und ein gewisses Momentum zu erzeugen» (Märke, 2018, S. 159, F7). UK 3.2. Organisation «Wenn man das im Unternehmen nicht zuoberst 168 Auswirkungen auf die Organisation. Informationen zur ansiedelt, dann verpasst man optimalen Verankerung und zur idealen Zuständigkeit den Zug, weil Sie die für das Thema Digitalisierung. Geschäftsleitung schon gar nicht mehr erreichen» (Laukemann, 2018, S. 149, F8). UK 3.3. Mitarbeitende Hinweise auf die möglichen Auswirkungen auf die «Ich glaube nicht, dass ein Mitarbeitenden und deren Fähigkeiten. Einschätzungen Arzt plötzlich programmieren zu den Auswirkungen auf die Berufsbilder im Spital. können muss. Auch eine Pflegerin oder ein Pfleger nicht […]» (Märke, 2018, S. 159, F8). UK 3.4. Ausbildung Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildung im «Aber die Befähigung ist, medizinischen Bereich. diese Technologien einfach selbstverständlich anzunehmen und anzuwenden. Ich denke, das gehört zur Grundausbildung» (Laukemann, 2018, S. 151, F11). 169 UK 3.5. Bereitschaft Bereitschaft für Digitalisierung bei med. Fachpersonen «Das heisst, sie sind schon im Spital. Nötige Einstellung gegenüber dem Thema. eher aufgeschlossen gegenüber Veränderungen» (Angerer, 2018, S. 141, F14). UK 4.1. «Big Data» Auswirkungen von «Big Data» und der «Platform- «Also, ich würde erstmal Economy» auf das Geschäftsmodell eines Spitals. sagen, die Daten sollten Konsequenzen der enormen Datengenerierung und - primär nicht für neue sammlung im medizinischen Bereich. Geschäftsmodelle gebraucht werden, sondern um die bestehenden zu verbessern» (Angerer, 2018, S. 141, F15). OK 4. Geschäftsmodell Spital UK 4.2. Erforderliche Ressourcen Hinweise auf technologische, finanzielle und «Investitionen in die menschliche Ressourcen um das Thema Digitalisierung Digitalisierung stehen oft in erfolgsversprechend angehen zu können. Konkurrenz zu anderen Investitionskosten und das ist für mich eine Gefahr» (Frangi, 2018, S. 132, F16). UK 4.3. Patienten «Ich glaube, grundsätzlich sind sie sehr bereit. Unter der 170 UK 4.4. Technologie-Trends Hinweise auf die Erwartungshaltung von Patienten und Voraussetzung, dass sie eine deren Bereitschaft digitale Services und Angebote zu echte Verbesserung spüren» Nutzen. (Märke, 2018, S. 162, F14). Informationen zu relevanten (Technologie-)Trends für «Das ist insofern schwierig zu Spitäler (Roboter, VR, ioT, Sensorik, Wearables etc.). beantworten, weil ich glaube, dass diese ganzen bahnbrechenden Technologien in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Spitäler noch nicht erreichen werden» (Angerer, 2018, S. 143, F18). UK 4.5. Treiber Einschätzungen bzgl. den Treibern der Digitalisierung «Von daher denke ich, wenn (Technologie, Innovation, Patienten, Mitarbeitende etc.). das EPD eine mehr oder Hinweise auf die Relevanz des elektronischen weniger einheitliche Lösung Patientendossiers. ist, dann ist das ein unglaublicher «Enabler» für sehr viele weitere Dinge» (Märke, 2018, S. 164, F20). 171 UK 4.6. Spital der Zukunft Einschätzungen zum Spital der Zukunft, über dessen «Es gibt eine Entwicklung zu Aussehen, Infrastruktur, Geschäftsmodell etc. Arbeitsteilung. Also, die einen, die operieren nur und dann sind sie da besonders stark. Dann haben sie einfach ein Haus mit Operationssälen und entsprechendem Personal» (Laukemann, 2018, S. 155, F18). UK 5.1. Reifegrad der Spitäler Persönliche Einschätzung des Reifegrads der «Ich würde sagen eine 2, weil Schweizer Spitäler. Hinweise zu Potenzialen, das Faxgerät noch überall Hemmfaktoren und akuten Handlungsfeldern. präsent ist. Und wenn Sie OK 5. wissen, was heutzutage Digitale Reife möglich wäre und dann sehen, wie viel davon umgesetzt ist, dann sind wir nicht sehr weit, oder?» (Märke, 2018, S. 165, F23). 172 8.6.8. Qualitative Inhaltsanalyse mit Codierungen OK 1. Digitalisierung im Gesundheits- und Spitalwesen UK 1.1. Stand der Digitalisierung Informationen über den Fortschritt der Digitalisierung im Schweizer Gesundheitswesen. Beschreibung von politischen, kulturellen und technologischen Faktoren. Gründe für den aktuellen Stand. «[…] sie ist, aus Sicht der Maturitätsstufe, am Anfang bis maximal in der Mitte. Wir sind nicht soweit, wie wir alle gehofft und geglaubt haben. […]» (Frangi, F2). «Ich bin der Überzeugung, das hat damit zu tun, dass das Gesundheitswesen generell noch nicht so digital ist, wie es sich vielleicht die Industrie vorstellt, weil einfach das Bedürfnis noch nicht da ist. Das heisst, man merkt den Druck viel zu wenig. […]» (Frangi, F2). «Da verweise ich gern auf die Studie von meinen Kollegen, von Digital Swiss. […]. Die Hauptaussage glaube ich sofort, nämlich, dass wir das Schlusslicht bilden, was die Digitalisierung betrifft. Also, das Gesundheitswesen hat einen ganz starken und grossen Nachholbedarf. Das heisst nicht, dass es nichts gibt, aber es heisst, dass wir wirklich ganz am Anfang der Reise stehen» (Angerer, F2). «Ja also, ich glaube, der Hauptgrund ist wie immer: wo kein Druck, da keine Optimierung. […]. Auch wenn alle jammern, dass das Gesundheitssystem so unter Druck steht, das ist noch lange nicht so unter Druck, dass wirklich grosser Handlungsbedarf besteht» (Angerer, F3). «Wenn man bedenkt, dass heute das Kommunikationsmittel beim niedergelassenen Sektor immer noch das Faxgerät ist, das sagt schon, glaube ich, wie weit wir mit der Technologie voranschreiten» (Angerer, F3). «Ein zweiter Effekt ist wahrscheinlich das Expertentum. Also Experten wie Ärzte, Pflegende und andere „Medical Professionals“, die lassen sich nicht gerne führen. Es ist schwierig, so eine Expertenorganisation wie ein Spital zu führen. 173 […]. Das heisst, selbst wenn Sie der CEO eines grossen Hauses sind und eine grosse digitale Vision haben, werden Sie es sehr schwer haben, ihre Leute zu überzeugen. Ohne Ärzte geht nichts» (Angerer, F3). «Der eine Aspekt ist der Aspekt, wie funktioniert ein Behandlungsablauf. Und zwar meine ich, in der gesamten Versorgungskette, von Hausarzt über Spital bis zur Spitex. Da denke ich da sind wir nicht nur zurück, sondern da sind wir sehr weit zurück. Da spielt heute vieles noch immer auf der Ebene Papier und Fax» (Laukemann, F2). «Auf der anderen Seite sehe ich immer wieder spannende Vorträge, wenn es um den Bereich der Behandlung selber geht. Oder um Forschungsthemen. […]. Wenn ich sehe, was im medizinischen Bereich abgeht, dann sage ich, ist das Gesundheitswesen extrem rasant unterwegs, was die Möglichkeiten der Digitalisierung anbetrifft. Im Behandlungsprozess selber, wenn es um die Geschäftsabwicklung im Spital geht, dann haben wir noch ganz viele Hausaufgaben zu lösen» (Laukemann, F2). «[…] Hier steht uns einfach diese gelebte Schweizer Behäbigkeit, die dem Ganzen eher entgegenwirkt, im Wege. […]. Wenn wir die Klinikinformationssysteme (KIS) anschauen, dann stehen wir vor Systemen, die müssen alle abgelöst werden, die haben ihren technologischen Lebenszyklus überwunden. […]. Und egal, mit wem ich rede und was ich höre, das ist ein Strukturproblem» (Laukemann, F3). «Wir arbeiten jetzt mit unserer Digitalisierungsstrategie an Themen wie Spital 4.0. In unserer heutigen Betrachtung haben wir erst ein Spital 2.0. Das ist jetzt ganz gemein gesagt, trifft aber die Realität schon» (Laukemann, F7). «Ich würde sicher sagen, es ist davon erfasst worden. Man hat zumindest ein hohes Bewusstsein dafür und weiss, dass es diese Digitalisierung gibt. […]. Ich denke, in den Köpfen ist die Bedeutung auch des Trends, auf alle Fälle angekommen» (Märke, F2). UK 1.2. Projekte & Initiativen Informationen zu relevanten (Leuchtturm)-Projekten aus der Gesundheitsbranche mit Fokus auf Spitäler. «Ja, wir haben da ein spannendes Projekt und zwar ist es das das grösste eHealth Projekt der Schweiz. Das ist der Zusammenschluss von Bern und Zürich in einer Stammgemeinschaft. […]. Diese bieten dann das Patientendossier, was meines Erachtens ja nur ein Teil der Digitalisierung ist, aktiv am Markt an» (Frangi, F3). 174 «[…] das Kantonspital Winterthur hat jetzt seine eigene elektronische Patientenagenda. Das heisst, ich als Patient sehe, wann habe ich welchen Therapeuten und welche Termine. Das Ganze ist nicht mehr Zettelwirtschaft, sondern eine elektronische Lösung» (Angerer, F4). «Es sind aus meiner Sicht eher die kleineren Dinge. Gerade das elektronische Patientendossier (EPD) ist für mich alles andere als ein Leuchtturmprojekt, weil das EPD hat Rahmenbedingungen geschaffen, die von der ganzen Community, die sich mit dem beschäftigt, abgelehnt werden. […]. Aus dem Projekt hinaus gibt es aber schon Initiativen, die versprechen erfolgreich zu sein» (Laukemann, F3). «Aber da gibt es doch vielleicht ein Leuchtturmprojekt im Kantonsspital Luzern, welches mit «Epic» ein Riesending auf den Boden zu bringen versucht» (Laukemann, F3). «Ich weiss, dass im Luzerner Kantonsspital (LUKS) eine grosse Umstellung im Bereich des Enterprise-Ressource-Planning (ERP) stattfindet. Da wird «Epic» eingeführt. Ich denke, das LUKS ist das erste Spital, welches in der Schweiz etwas in dieser Grössenordnung anpackt» (Märke, F3). «Ich bin der Meinung, dass einzelne Spitäler teilweise auch in Richtung IoT gehen, aber ich weiss grad nicht mehr welches und wie da der Stand ist» (Märke, F3). UK 1.3 Trends Informationen zu aktuellen und aufkommenden Trends in der Gesundheits- und Spitalbranche. «Der Trend, den wir feststellen ist, dass vor allem in der Digitalisierung der Medizin sehr viel passiert. […]. Dort wird sehr viel Geld investiert» (Frangi, F4). «Was ich weiter feststelle ist, dass für den Patienten noch wenig Spürbares gemacht wird. […]. In diesem «Erlebnisfeld» des Patienten passiert im Privatbereich viel, im öffentlichen Bereich gar nichts» (Frangi, F4). «Viel Digitalisierung und Innovation im medizinischen Bereich, noch eher wenig bei den Geschäfts- und Administrationsprozessen» (Frangi, F4). «[…] Hausärzte könnten so dank «Big Data & Analytics» ihr Wissen erweitern, indem sie sich an öffentlich zugängliche Datenbanken anschliessen. Dieser Trend wird nicht so oft diskutiert, ist aber ganz klar da» (Frangi, F7). 175 «In unserer Studie «Digital Health: Die Zukunft des Schweizer Gesundheitswesens» haben wir als erstes den Begriff «Digital Health» definiert. […]. Das war eben einerseits das Thema «elektronisches Patientendossier», das ist natürlich ein ganz heisses und aktuelles Thema. Das zweite war das Thema «Wearables». […]. «Telemedizin» ist das Dritte. […]. Und ja, wenn man «Digital Health», so wie wir, auch breiter versteht, dann auch das Thema «Lifestyle & Fitness» als viertes […]» (Angerer, F5). «Man merkt, da entstehen auch durchaus neue Geschäftsmodelle in den Bereichen, denn Gesundheit ist mehr als «nicht krank sein» (Angerer, F5). «Rein technologisch wird sich das Spitalwesen vom heutigen System, dass man zwischen jeder Fachapplikation eine Beschreibungssprache (HL7) hat, verabschieden und eher mit Service-Bus-Komponenten arbeiten» (Laukemann, F4). «Ich spüre es, dass man vermehrt umdenkt und hie und da mal ein paar Start-Ups unterstützt und sich so gewisses Knowhow ins Haus holt, um zu zeigen, was überhaupt schon alles möglich ist» (Laukemann, F15). «Wenn man sich umschaut, sind die meisten technologischen Sachen eben technologisch getrieben. Man sieht sehr viel in Richtung Robotik laufen […]» (Märke, F4). «Ich könnte mir vorstellen, dass es letzten Endes im Sinne einer vertikalen Integration immer interessanter wird, Versicherungsleistungen mit tatsächlicher Leistungserbringung zu verknüpfen. […]» (Märke, F4). «Es gibt auch den Spruch, dass aus dem Krankheits- ein Gesundheitswesen wird und dass der Fokus dadurch wechselt» (Märke, F4). 176 OK 2. Disruption im Gesundheitswesen UK 2.1. Disruptionspotenzial Informationen zur Wahrscheinlichkeit, dass die Gesundheitsbranche und mit ihr die Spitäler von der Disruption erfasst werden. Einschätzungen zu den möglichen Auswirkungen. «Ich denke, wenn wir das Gesundheitswesen mit der Digitalisierung im Bankenbereich vergleichen, sind wir 7 bis 10 Jahre im Rückstand. […]. Ich denke, die Disruption findet aber langsam statt und ganz offensichtlich sehen wir das eigentlich bei den ambulanten Leistungserbringern. Telemedizin ist so ein disruptiver Bereich […]» (Frangi, F6). «Disruptive Versuche im stationären Bereich, also in Spitälern, stellen wir eher wenig fest. Dort spüren wir eine gewisse Zurückhaltung, denn die Investitionen sind hoch. Am Schluss ist es leider immer wieder eine Geldfrage» (Frangi, F6). Und ein öffentliches Spital muss sich heute einfach überlegen, ob es in ein Bettenhaus oder eine potenzielle disruptive Technologie investiert. Das ist eine «Trade-Off», wo sich die Spitäler heute erfahrungsgemäss noch oft für klassische Infrastrukturinvestitionen entscheiden und weniger für Technologien» (Frangi, F6). «Also, das ist in der Tat nur mit ganz grosser Schwierigkeit vorherzusagen, wann und in welcher Form eine Disruption eintritt. […]. Also das heisst: ja, solche Technologien könnten wirklich vieles auf den Kopf stellen, aber keiner kann genau sagen, wann, wie und wo das passieren wird» (Angerer, F6). «Ich denke, Player wie Apple sind sich extrem am Vorbereiten im Gesundheitsmarkt eine Rolle zu spielen und die denken halt nicht nur national. Die denken nicht an Gesetze, Grenzen oder Services» (Laukemann, F5). «[…] Disruption wird zwar kommen, aber ich glaube weniger, dass sie in der traditionellen Medizin kommt, sondern eher im ganzen dispersen Unterstützungsbereich» (Laukemann, F5). «Disruptive Potenziale sehe ich eher in Bereichen, wo es darum geht, dass tatsächlich der gesamte Patientenweg betroffen ist» (Märke, F4). 177 «Grundsätzlich hoch. […] Das Gesundheitswesen ist aber ein hochkomplexes Gebilde, eine Expertenorganisation. […] In den letzten 100 Jahren hat sich relativ wenig verändert, in der Art und Weise, wie die Branche grundsätzlich funktioniert. Ich denke, wie zuvor angetönt, gibt es das Potenzial für ganz grundlegende Neuerungen» (Märke, F5). UK 2.2. Leistungserbringer Bedeutung der Disruption bzw. des Disruptionspotenzial für Leistungserbringer und speziell für Spitäler. «Der ambulante Bereich ist hier, mit dem Beispiel der Telemedizin, der klare Vorreiter, dort passiert das mehr» (Frangi, F6). «Ich denke, da machen viele Digitalisierungsexperten immer wieder den Fehler, dass sie das Gesundheitswesen mit anderen Märkten vergleichen. Es gibt einen wesentlichen Unterschied und zwar ist das das Vertrauen» (Frangi, F7). «[…] wenn wir dann wirklich von behandlungsrelevanten medizinischen Daten sprechen, wie dieser Fachterminus heisst, dann stellen wir fest, dass diese Daten wie Blutwerte, HIV-Testresultate etc. kaum mit Google oder Apple geteilt werden wollen» (Frangi, F7). Wenn wir jetzt die Digitalisierung des Gesundheitswesens im Hinblick auf Deine Arbeit ein bisschen öffnen und ebenfalls den Patienten und seine ganze Erlebniskette berücksichtigen, dann würde ich sagen, sind diese Unternehmen schon eine Gefahr. Wenn Du in diesem Zusammenhang siehst, wie Google, Amazon oder Apple die Verhaltensweise des Patienten ändert, dann ist das schon eine Herausforderung. Die Patienten verlangen und erwarten von Hausärzten teilweise ähnliche Lösungen. […]» (Frangi, F7). «Wir bei der Swisscom Health AG digitalisieren vor allem die administrativen Prozesse. Da bist du wenig disruptiv» (Frangi, F18). «Ich glaube nicht, dass jemand in diesem Haus auch nur das geringste schlechte Bauchgefühl hat, weil sich womöglich noch gar niemand überlegt hat, was das für eine Konsequenz für uns haben könnte» (Laukemann, F6). «Ich glaube, im Moment ist es nicht einmal die Frage ob uns Apple oder Amazon ärgern und bedrängen, sondern wie sich ein Spital-Aufenthalt verändern wird. Da gibt es eine Verschiebung vom stationären zum ambulanten Bereich. Das sind unsere aktuellen Herausforderungen» (Laukemann, F6). 178 «Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass diese grossen Bestrebungen von Apple & Co. jetzt zuerst einmal in Amerika, China oder noch viel mehr in Indien stattfinden. In so grossen Gebieten, die von der Versorgung her prädestinierter sind, als die überversorgte Schweiz» (Laukemann, F6). «Es geht sicher nicht von heute auf morgen. […]. Da könnte aber durchaus eine Machtverschiebung stattfinden, kann ich mir vorstellen. […]» (Märke, F6). «Die Frage ist: «Wer lernt schneller? Lernen die Spitäler schneller, wie man mit dem Potenzial von Daten umgeht oder lernen die Tech-Firmen schneller, wie man zuverlässig Medizin macht?» (Märke, F6). OK 3. Auswirkungen der Digitalisierung UK 3.1. Unternehmenskultur Beschreibung der möglichen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Unternehmenskultur im Spital. «...aber das ist vielen Spitalleitungen noch zu wenig bewusst, dass diese Investitionsblöcke miteinander in Konkurrenz stehen und dass man dann vielleicht eher dazu neigt, auf Bekanntes und Bewährtes zu setzen und noch nicht so diese totale Augenöffnung für Digitalisierung hat» (Frangi, F16). «Das Thema Veränderungen ist ja ein Klassiker der Change-Management Literatur. Es ist immer schwierig, neue Arbeitsläufe einzubringen. […]. Was wir so festgestellt haben in unseren Recherchen und natürlich aus unserer Projektarbeit ist, das Problem multipliziert sich, wenn Sie nicht nur etwas verändern, sondern auch noch Digitales hineinbringen. Dann ist die Gefahr einer Doppelblockade noch grösser. Weil die Leute nicht nur, weil sich etwas verändert, dagegen sind, sondern weil das Ganze auch noch digital passiert» (Angerer, F9). «Ja, eine gewisse Risikobereitschaft muss da sein und man muss sich als Spital unserer Grössenordnung ganz klar überlegen, was kann man wirklich machen und was nicht. […] Und dann muss man abschätzen, wo bringt uns Digitalisierung wirklich einen entsprechenden Nutzen» (Laukemann, F15). «Digitalisierung ist ein Veränderungsprozess. […]. Es geht darum, Leute auf die Reise mitzunehmen. Es geht darum, schnelle Erfolge zu erzielen und ein gewisses Momentum zu erzeugen» (Märke, F7). 179 UK 3.2. Organisation Auswirkungen auf die Organisation. Informationen zur optimalen Verankerung und zur idealen Zuständigkeit für das Thema Digitalisierung. «Ich bin sonst sehr Fan für «Bottom-Up» und ebenfalls für wenig Hierarchien, musste aber in den letzten 3 Jahren lernen, dass das Gesundheitswesen einfach gewisse Hierarchien braucht» (Frangi, F9). «Das Thema muss auf jeden Fall so hoch wie möglich angesiedelt sein. In jeder Branche ist der Fehler, dass Digitalisierung oft noch diese Spielplatzecke ist und nicht die «Management Attention» hat, die es braucht. Und das ist im Gesundheitswesen genau gleich» (Frangi, F9). «Der Kulturwandel kann passieren, wenn der «Head of eHealth» oder «Head of Digitalisierung» wirklich eine sehr hohe Position hat, um nicht zu sagen in der Klinikleitung sitzt» (Frangi, F9). «Und das muss natürlich von «Top-Down» kommen. Das Top-Management muss bestimmen, denn es gibt die Gelder dafür. Aber es muss dann praktisch versuchen, «Bottom-Up» Lust für das Thema zu erzeugen, indem einzelne Projekte durchgeführt und die Erfolge/der Nutzen den Leuten aufgezeigt werden. […]. Die grosse Streitfrage lautet auch: «Big Bang» oder sequenziell […]. Lieber sequenziell, lieber mit einem Leuchtturmprojekt anfangen und den Leuten damit aufzeigen was man machen kann und das dann nach und nach ausrollen» (Angerer, F10). «Der Verwaltungsrat hat gesagt, Digitalisierung muss ganz oben beginnen, weil sonst versandet das in irgendwelchen Eigeninitiativen. […] Wenn man das im Unternehmen nicht zuoberst ansiedelt, dann verpasst man den Zug, weil Sie die Geschäftsleitung schon gar nicht mehr erreichen» (Laukemann, F7). «Digitalisierung und Innovation bringt uns vorwärts im Denken, weil Innovation ist nicht einfach etwas Lustiges, es beginnt mit Erfinden, mit Neuem schaffen. Und dazu braucht es gewisse Strukturen und ein Interesse von ganz oben. […]. Ich spüre, die Ausstrahlungskraft, die ist viel stärker wenn sie von ganz oben kommt» (Laukemann, F7). «Ich würde das «Top-Down» aufhängen. […]. Einerseits sind die Personen an der Basis sehr stark im Tagesgeschäft eingebunden. Das ist das, warum es geht, die wollen nicht Digitalisierung betreiben, die wollen Patienten pflegen» (Märke, F13). 180 «Wiederum ist Digitalisierung, wenn man auf disruptive Lösungen setzt, erst einmal teuer und kostet viel. Der Effekt davon ist aktuell auch noch sehr schlecht spür- oder messbar. Wenn man da wirklich eine Wirkung erzielen will in seinem Unternehmen, glaube ich, braucht es eine übergeordnete Strategie. Und dazu braucht es einen gewissen «Top-Down» Aspekt. […] Ich glaube anders wird das in einem so komplexen System unglaublich schwierig» (Märke, F13). UK 3.3. Mitarbeitende Hinweise auf die möglichen Auswirkungen auf die Mitarbeitenden und deren Fähigkeiten. Einschätzungen zu den Auswirkungen auf die Berufsbilder im Spital. «Ich denke, die grösste kulturelle Herausforderung im Spital ist, dass sich Berufsbilder verändern. […]. Das heisst, Leute die sich gewohnt sind oder waren, sich um die Telefonverkabelung von Patientenzimmern zu kümmern, müssen sich heute plötzlich mit interaktiven Terminals herumschlagen und sollen die Vernetzung vorantreiben. Das ist ein Kulturwechsel und auf Stufe der Mitarbeitenden eine der grössten Herausforderungen» (Frangi, F8). «Ich denke, das ist insbesondere im Gesundheitswesen die grosse Herausforderung, dass Du natürlich von der Erfahrung der Alten profitierst. […] Und ich bin dort immer wieder in diesem Zwiespalt: wie relevant ist die menschliche Erfahrung? […] Die Jungen, die mit Technologie aufwachsen und gewisse Tools von Anfang an nützen, für die wird das kein Problem sein. Aber die heutigen Koryphäen, die einen wichtigen Job im Spital haben, […] diese umzuschulen und zu entwickeln, das wird sehr schwierig sein. […] Die Koryphäen werden Aushängeschilder bleiben, aber die nachrückenden Jungen bringen eine neue Fachkompetenz mit» (Frangi, F10). «Ich bin der festen Überzeugung, dass du gerade im Pflegeberuf den Menschen brauchst. Und das ist gut so, weil Du Empathie brauchst, das Menschliche, was ein Computer niemals ersetzen können wird. Du wirst aber andere, neue Hilfsmittel haben und die werden die älteren Pflegepersonen vor gewisse Herausforderungen stellen. Aber dass du als Pflegeperson Angst haben musst um deinen Beruf, das glaube ich nicht. Und das wird die nächsten 5 bis 10 Jahre sicher noch so bleiben, da bin ich überzeugt» (Frangi, F11). «Ich glaube, dass es durchaus Experten im Haus braucht. Ob man sie bei der IT, Unternehmensentwicklung oder «Digital Koordinator» nennt, das ist, glaube ich, nicht wichtig, Hauptsache man hat einen harten Kern von Leuten, die das Thema richtig gut verstanden und durchdrungen haben» (Angerer, F10). 181 «Ich glaube, dass es auf jeden Fall etwas wie einen «Digital-Translator» oder «Trendscout» benötigt, der spürt, was es draussen im Markt gibt und es schafft, das Ganze in die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und Patienten zu übersetzen» (Angerer, F11). «Die Digitalisierung verändert die Berufsbilder, aber ich hoffe, dass sie viele Berufsbilder zum Besseren verändert. Sprich, dass ich letztendlich wertvollere und kreativere Aufgaben übernehmen kann und der Roboter mir zum Beispiel die schwere Hebe- oder Traglast abnimmt. Ich glaube also schon, dass sich da vieles verändern und dass es dabei Verlierer geben wird, aber insgesamt stehe ich dem eher positiv gegenüber» (Angerer, F12). «Als Spital brauche ich einen Digital-Officer, der als Technologie-Scout dient, der weiss, was da draussen auf der Welt und im Markt passiert» (Angerer, F18). «Also, da gibt es schon Veränderungen. […] Ich sehe es an der Informatik selber, denn das Wachstum […] von technisch orientierten Berufen ist massiv» (Laukemann, F10). «Auf der anderen Seite hoffe ich tatsächlich, dass es im pflegerischen Bereich keine Veränderung gibt. Ich glaube, dort wo man am Schluss direkte Mensch-Mensch-Kommunikation oder Mensch-Mensch-Behandlung hat, sollte man nicht reduzieren. Das ist eine Kernkompetenz eines Spitals und sonst kann man sich wirklich überlegen, ob das Unternehmensmodell Spital nicht veraltet ist» (Laukemann, F10). «Und ich denke es braucht sicher einmal so etwas wie «Digitalisierungsarchitekten» […]» (Laukemann, F14). «Ich glaube, das ist sehr stark davon getrieben, was die Patienten wollen. […] Letzten Endes wird es für ein Spital gerade da nicht möglich sein, etwas zu substituieren solange ein Mensch lieber von einem Menschen betreut werden will und nicht von einer Maschine» (Märke, F9). «Neue Jobs entstehen auf alle Fälle. Diese neuen Systeme müssen verstanden und gepflegt werden, wie auch immer die dann genau aussehen» (Märke, F9). «…ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei sicherheitsrelevanten Tätigkeiten wie Medikamente sortieren für verschiedene Patienten und Tageszeiten, ein Roboter ziemlich sicher besser ist, als ein Mensch» (Märke, F11). 182 UK 3.4. Ausbildung Konsequenzen der Digitalisierung für die Aus- und Weiterbildung im medizinischen Bereich. «Also ja, Basiswissen ist notwendig, aber dass der Arzt zum Programmierer wird, das glaube ich nicht. Auch in der Administration werden immer mehr ICT-Skills benötigt, davon bin ich überzeugt» (Frangi, F12). «Aber ich denke, ICT-Skills werden bis ans Patientenbett hin notwendig sein. Die benutzen heute schon teilweise nur noch Tablets und nicht mehr die Krankengeschichte auf Papier. […]» (Frangi, F12). «Im medizinischen Bereich, glaube ich, wirst Du aber immer noch diejenigen haben, die sie hinter diesem «Koryphäentum» verstecken können und wenig für die Weiterbildung im ICT-Bereich machen müssen» (Frangi, F13). «Als Pflegefachkraft muss ich hier nicht Programmieren lernen. Ich sehe das also nicht als die grosse Hürde, weil letztendlich die Technik und die Usability also die «Mensch-Maschine-Schnittstelle» immer einfacher wird. Deswegen braucht man gar nicht grosse Programmier- oder sonstige Fähigkeiten. […]. Flexibilität ist die neue Kompetenz, die man braucht» (Angerer, F11). «Ich denke, die Vorbereitung der Leute darauf ist enorm wichtig. […] Ich glaube nicht mehr, dass man einfach jetzt echte ITSkills aufbauen muss, so wie früher, wo jeder seinen Excel- oder Word-Kurs machen musste. […]» (Laukemann, F9). «Aber die Befähigung ist, diese Technologien einfach selbstverständlich anzunehmen und anzuwenden. Ich denke, das gehört zur Grundausbildung» (Laukemann, F11). «Ich glaube nicht, dass ein Arzt plötzlich programmieren können muss. Auch eine Pflegerin oder ein Pfleger nicht. […] Es gilt jedoch festzuhalten, dass man lernen muss, einen Operationsroboter zu bedienen. Genauso muss man lernen, wie man ein System in seiner Abteilung möglichst gewinnbringend einsetzt» (Märke, F8). 183 UK 3.5. Bereitschaft Bereitschaft für Digitalisierung bei med. Fachpersonen im Spital. Nötige Einstellung gegenüber dem Thema. «Wenn wir die Administrationsprozesse ins Daily Business aufnehmen, dann muss ich sagen, sie müssen es sein. Es gibt das, vom Gesetz her vorgeschriebene, elektronischen Patientendossier (EPD) und im administrativen Bereich da müssen sie sich bereit machen für die Digitalisierung. […]» (Frangi, F13). «2012 haben wir in der Spitalpoolstudie 500 Leute befragt bzw. mit psychologischen Tests gemessen, wie veränderungsbereit sie sind. […] Die ganz grosse Überraschung der Studie war, dass, wenn man die gleichen Fragen den Menschen auf der Strasse stellt, dann ist der Spitalmitarbeiter veränderungsbereiter, also flexibler» (Angerer, F14). «Wir stellen fest, im kulturellen Bereich, haben wir in vielen Spitälern Leute, die keine Maus bedienen können. […]. Aber die private Durchdringung der Digitalisierung kommt uns natürlich entgegen» (Laukemann, F7). «Auf der anderen Seite stellen wir natürlich fest, dass die jüngere Generation, die mit Social Media aufwächst, neue Ansprüche stellt, und das erlaubt es uns, neue Systeme einzubringen und von einer echten Digitalisierung zu sprechen» (Laukemann, F7). «Wenn ich einfach so traditionell in unser Spital reinschaue hätte ich vor ein paar Jahren zu allen gesagt, dass sie ihre PCs bedienen können müssen. Heute glaube ich, dass uns diese Fähigkeiten langsam aber sicher überholen und die Leute mit Anforderungen an Tools und Systeme kommen, welche wir nicht mehr einfach so erfüllen können» (Laukemann, F9). «Die Reaktionen sind sehr verschieden und, exemplarisch, am breitesten bei den Ärzten zu finden. Die Pflege ist tatsächlich noch sehr oft traditionell. […]. Ich erlebe bei uns Ärzte, das wären die besten Programmierer» (Laukemann, F12). «Wenn ich bei den Radiologen bin, dann denke ich die waren vor 10 Jahren schon weit voraus gegenüber den Anderen. […]. Die interessieren sich für Artificial Intelligence» (Laukemann, F12). «Ich glaube, grundsätzlich sind sie sehr bereit. Unter der Voraussetzung, dass sie eine echte Verbesserung spüren» (Märke, F14). «[…] Was man sicherlich sagen kann, ist, dass jüngere Personen stärker bereits mit der Technologie aufgewachsen sind und es da eventuell natürlicher ist oder man ist es stärker gewohnt» (Märke, F15). 184 «Aber nichts destotrotz, gerade Ärzte beschäftigen sich sehr stark mit medizinischen Innovationen. […] Ich glaube, da sind die Voraussetzungen vom «Mindset» her recht gut» (Märke, F15). OK 4. Geschäftsmodell Spital UK 4.1. «Big Data» Auswirkungen von «Big Data» und der «Platform-Economy» auf das Geschäftsmodell eines Spitals. Konsequenzen der enormen Datengenerierung und -sammlung im medizinischen Bereich. «Ich denke, das ist kein Problem des Gesundheitswesens, sondern mit der zunehmenden Digitalisierung ist Cybercrime ein allgemeines Thema. […]. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet die Post und die Swisscom im Bereich eHealth Marktleader sind. Sie investieren einfach sehr viel Geld in die Sicherheit» (Frangi, F14). «Es gibt Fälle, wo man sich als behandelnder Arzt in fremden Datenbanken bedienen kann. […]. Das bringt am Ende des Tages dem im Bett liegenden Patienten dann wirklich etwas. […] Immer mit immer der Prämisse, dass parallel dazu die Sicherheit im Spital ausgebaut werden muss. Und da müssen die Spitäler Geld investieren» (Frangi, F14). «Da ist die Frage halt auch, inwiefern sich der Patient auf das einlassen will. Wenn ich sehe, wie konservativ Schweizer mit Daten umgehen, bin ich zurückhaltend mit Aussagen, wie lange das geht, bis die Schweiz damit wirklich sehr offensiv umgeht» (Frangi, F15). «Wenn die gesammelten Gesundheitsdaten wirklich so grosse Möglichkeiten eröffnen für neue Geschäftsfelder, dann glaube ich schon, dass die Leute und Unternehmen, die verstanden haben, wie man mit Daten umgeht, da sehr grosse Vorteil haben werden» (Angerer, F7). «Also, ich würde erstmal sagen, die Daten sollten primär nicht für neue Geschäftsmodelle gebraucht werden, sondern um die bestehenden zu verbessern» (Angerer, F15). «Wir haben jetzt neu eine Forschungsabteilung, von dem her sind wir erst am Beginn von Überlegungen, was wir mit Daten anfangen. […]. Wir sind an ersten Überlegungen dran, mit der Universität Basel und mit dem Universitätsspital zusammenzuarbeiten. […]. Aber ich glaube nicht, dass in diesem Haus jemand beabsichtigt, die Daten zu kommerziellen 185 Zwecken zu nutzen, sondern sie stehen im Zusammenhang mit noch besserer Versorgung, noch besserer Diagnose für unsere Patienten in unserem Kernbereich. Und dort werden wir eher sagen, unsere Daten kombiniert mit anderen Daten, das gibt neue und bessere Informationen» (Laukemann, F13). «Aber wir spüren das natürlich auch: Amazon lebt von den Daten, die wissen wie damit umzugehen ist und das muss man schon im Hinterkopf haben» (Laukemann, F13). «Ich glaube, es wird sehr stark regulatorisch geprägt sein, was man mit diesen Daten tatsächlich machen darf und was nicht. Es wird eine politische Entscheidung sein» (Märke, F16). «Ein dynamisches Pricing in allen Bereichen ist denkbar» (Märke, F16). «Man könnte die Daten ja auch auf dem Arbeitsmarkt nutzen und bei der Personalbeschaffung Gesundheitskriterien hinzuziehen. […] Da gibt es viele Dinge, die wir sehr wahrscheinlich als Gesellschaft gar nicht wollen, wenn man da an den sozialen Gedanken denkt. […]» (Märke, F16). UK 4.2. Erforderliche Ressourcen Hinweise auf technologische, finanzielle und menschliche Ressourcen um das Thema Digitalisierung erfolgsversprechend angehen zu können. «Wir stellen hier aus Anbietersicht, den Kostendruck, der bei Spitälern sehr hoch ist, sicher fest. Vielleicht wurde jahrelang nicht oder zu wenig investiert und jetzt kommt halt alles miteinander. […]» (Frangi, F16). «Investitionen in die Digitalisierung stehen oft in Konkurrenz zu anderen Investitionskosten und das ist für mich eine Gefahr. Wenn Du Dich heute als Spital vielleicht eher für die Infrastruktur, die Küche oder das Bettenhaus, entscheidest und weniger für die Digitalisierung, dann wirst du in ein paar Jahren vor einem Problem stehen» (Frangi, F16). «Meine Hauptbotschaft ist immer, bevor man digital wird, muss man erst effizient werden. […]. Zuerst die Prozesse optimieren und dann kann man über Digitalisierung sprechen» (Angerer, F17). «Aber ohne echte Investition wird genau nichts passieren. Also es wird richtig Geld kosten» (Angerer, F17). «Also, Sie brauchen sicher einfach mal Geld. Oder Sie müssen sich sagen, es sind jetzt nicht mehr 2 %, sondern 5 % von unserem Umsatz, die wir investieren. […] Darum ist das «Top-Down» so wichtig» (Laukemann, F14). 186 «Aber Geld ist immer das erste was man braucht, weil man muss digitalisieren wollen. Man muss da schon mal was investieren und dann muss man vielleicht auch einfach mal etwas versuchen» (Laukemann, F14). «So, wie ich die Sache sehe, ist das limitierende die finanzielle Seite. […] Die Spitäler haben nicht so viel freie Mittel. Da gilt es wiederum Mittel und Wege zu finden, wie die aktuellen Prozesse so weit verschlankt werden können, damit diese Mittel frei werden – auch zeitlich. Zeit ist ein bekanntes Problem» (Märke, F17). UK 4.3. Patienten Hinweise auf die Erwartungshaltung von Patienten und deren Bereitschaft digitale Services und Angebote zu Nutzen. «Ich glaube, die Patienten über alle Altersstufen hinweg sind bereit. Du hast immer 10 bis 20 %, die wegen den Daten Sicherheitsängste haben, aber von der Usability her sind die Patienten bereit» (Frangi, F17). «Ich glaube, dass jeder, der versteht, was mit seinen Daten passiert und was er davon hat, dass man den für Projekte gewinnen kann» (Angerer, F16). «Es ist nicht so, dass die Leute immer nur den Datenschutz sehen, der ist für Sie zwar schon wichtig und kritisch. […]. Also grundsätzlich glaube ich, ist der Schweizer Patient schon empfänglich für neue digitale Lösungen» (Angerer, F16). «Heute bekommen wir böse Briefe, wenn nicht das W-LAN nicht in einer wunderbaren Stärke, und natürlich gratis, funktioniert. […]. Anhand der Patientenfeedbacks spüren wir sonst aber eher wenig Ansprüche. Die kommen einfach zu uns oder kommen nicht. […]» (Laukemann, F16). «Und wir spüren natürlich schon auch, dass sich die Ansprüche der Patienten generell gesteigert haben. Wir müssen uns zum Teil wirklich mit Hotels messen» (Laukemann, F16). «Ich glaube da ist es wichtig, den Patienten und seine Wünsche ins Zentrum zu stellen und da sehe ich ebenfalls einen Trend. Der Patient versteht sich immer stärker als Kunde und bringt seine Bedürfnisse aktiv ein, artikuliert diese» (Märke, F9). «Ich glaube, dort ist ebenfalls die Ausgangslage, wenn man dem Patienten glaubhaft vermitteln kann, dass Digitalisierung für ihn einen Nutzen hat, gesundheitlich sowieso, dann wird auch jemand, der nicht so Lust darauf hat, plötzlich willig» (Märke, F18). 187 UK 4.4. Technologie-Trends Informationen zu relevanten (Technologie-)Trends für Spitäler (Roboter, VR, ioT, Sensorik, Wearables etc.). «Wie gesagt im Medizinischen Bereich hört unser Wirkungsfeld auf, dort weiss ich, ist Virtual Reality (VR) ein Thema» (Frangi, F18). «Das ist insofern schwierig zu beantworten, weil ich glaube, dass diese ganzen bahnbrechenden Technologien in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Spitäler noch nicht erreichen werden» (Angerer, F18). «[…] Da sehe ich Beispiele, wie man mit Künstlicher Intelligenz, mit all diesen Untersuchungsmethoden, die es heute gibt, die auf Informatik-Mitteln beruhen, wie man da punktgenau einen Tumor treffen kann und das Ganze macht man an einem Bildschirm» (Laukemann, F2). «Ich glaube, die Big Data und Artificial Intelligence-Kombination ist sicher weit oben mit dabei» (Märke, F19). «Dann sehe ich auch das Internet of Things bis hin zu Wearables, zu smarten Pflastern, zu Medikamenten, die sich selber dosieren, wenn man sie mal geschluckt hat, also diese ganze Mini-Chip-Sache, die miteinander kommunizieren. Da sehe ich grosses Potenzial» (Märke, F19). «Dann gibt es einige technologische Entwicklungen, wo man sagt, wir können gewisse Elemente so klein bauen, dass wir den Körper nicht mehr aufschneiden müssen. Wir können eigentlich ein Mini-Operationsinstrument injizieren und dieses dann von aussen steuern» (Märke, F19). «Ja, und nicht zuletzt Blockchain im Zusammenhang mit der ganzen Datenverarbeitung, das ist sicher ebenfalls ein Punkt» (Märke, F19). 188 UK 4.5. Treiber Einschätzungen bzgl. den Treibern der Digitalisierung (Technologie, Innovation, Patienten, Mitarbeitende etc.). Hinweise auf die Relevanz des elektronischen Patientendossiers (EPD). «Ich bin überzeugt, es ist nicht der einzige und nicht der wichtigste Treiber in der Digitalisierung. Aber, und das ist das Gute, es ist ein gesetzlich verordneter «Turbo Boost». […]. Man muss schon bedenken, das Patientendossier ist nur ein kleiner Teilbereich der Digitalisierung» (Frangi, F19). «Der Vorteil ist, wenn Du jetzt plötzlich ein Patientendossier zur Verfügung stellen musst, dann beginnst Du plötzlich, Deine Infrastruktur zu hinterfragen. Du beginnst, Dein System in der Klinik zu hinterfragen, bis hin zum W-LAN. Ich würde mal sagen, es ist ein richtiger Türöffner. […]» (Frangi, F19). «Was nach der Einführung kommt, ist zuerst einmal das grosse Jammern. Weil die aktuelle Lösung, ist einfach so eine Minimallösung, die man da entwickelt hat. […] Sehr regional, sehr pluralistisch, jeder macht was er glaubt, was am besten ist mit möglichst wenig Zwang. […]. Deswegen glaube ich, ist das EPD der erste Schritt, aber es ist nur ein kleiner Schritt» (Angerer, F19). «Eigentlich ist das EPD das Letzte was wir wollen […]. Es ist aber der Auslöser, dass man überhaupt einmal in der ganzen Schweiz über solche Systeme nachdenkt. […] und von dem her ist es gut, dass man Themen wie Datenaustausch oder Datenverfügbarkeit von Gesundheitsdaten endlich mal auf breiter Basis diskutiert» (Laukemann, F17). «Aber EPD als solches selber, da gibt es so viele Beispiele, wie man dem wieder aus dem Weg gehen könnte, dass ich sagen muss, das alleine ist es nicht» (Laukemann, F17). «Ich weiss nicht, ob «Treiber» das richtige Wort ist. es ist viel mehr, aus meiner Sicht, eine Voraussetzung für sehr viele andere Dinge. […] Von daher denke ich, wenn das EPD eine mehr oder weniger einheitliche Lösung ist, dann ist das ein unglaublicher «Enabler» für sehr viele weitere Dinge» (Märke, F20). 189 UK 4.6. Spital der Zukunft Einschätzungen zum Spital der Zukunft, über dessen Aussehen, Infrastruktur, Geschäftsmodell etc. «Ich glaube, es funktioniert schon ziemlich anders. Ein Bereich, wo wir diese Tendenzen feststellen ist nur schon der «CheckIn», wenn du ins Spital kommst. […]. Du machst einen Online-«Check-in» und das ist für mich der erste Schritt zur Veränderung. Dass Du wenn Du ins Spital kommst, vielleicht in einer Couchumgebung sitzt und nicht mehr hinter diesen Tresen wie am Postbankschalter» (Frangi, F21). «Das geht dann hin bis zu den Hospitality Services. Wir haben ein spannendes Pilotprojekt mit Pepper dem Roboter in einem Altersheim in Montreux begleitet, wo Roboter nachtschichtmässig Gänge überwachen» (Frangi, F21). «Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es den Menschen immer brauchen wird. Ich bin aber überzeugt, dass die Hilfsmittel definitiv anders sein werden und dass das Spital anders aussehen wird» (Frangi, F21). «Wenn du Innovationsprozesse anschaust, dann sprechen wir auch schon vom «Lean Hospital», und für mich ist «lean» die Vorstufe zu «smart». […]. Heute versuchen wir noch die Prozesse zu verschlanken, was für mich die Vorstufe ist für Innovation und danach auch für das «smarte» Spital. […]» (Frangi, F22). «Also hoffentlich wird es ein «smart and lean Hospital» geben. Da muss man nicht träumen, da kann man in anderen Ländern schon gute Beispiele sehen» (Angerer, F20). «Ich glaube, Technologie wird uns noch lange eher als «enabler» unterstützen, das zu machen, was wir heute eh schon machen. […]. In den nächsten Jahren oder Jahrzenten wird die Technologie uns einfach ermöglichen, diese Kernaufgaben einfacher, effizienter und qualitativ besser zu erledigen. […]. Wir werden immer noch die gleichen Grundmuster sehen, aber wir werden sehen, wie dann vieles dank Technologien schneller, einfach und besser gemacht werden kann, als heutzutage» (Angerer, F20). «Ich sehe einfach verschiedene Wege und alle deuten darauf hin, dass sich die Spitäler verändern werden. […] Es gibt eine Entwicklung zu Arbeitsteilung. Also, die einen, die operieren nur und dann sind sie da besonders stark. Dann haben sie einfach ein Haus mit Operationssälen und entsprechendem Personal» (Laukemann, F18). 190 «Ich denke, es gibt sicher einen geografischen Ort mit Betten, wo Menschen von Menschen gepflegt werden. Das ist sicher eine Kernaufgabe, die wird bestehen bleiben. Und dann denke ich gibt es sicher Bereiche wo Therapie stattfindet. […] Es gibt sicher Orte, wo man gebären will. Dort zeigt es sich am deutlichsten. Das sind keine kranken Menschen. Die wollen möglichst eine coole Umgebung, sich wohl fühlen und wohlfühlen hat nichts mehr mit Spital zu tun. […] Von dem her wird das Spital sicher immer mehr Hotelcharakter haben» (Laukemann, F18). «Auf der anderen Seite kann es gut sein, dass ein Spital der Zukunft vielleicht sein Wissen virtuell mit anderen vernetzt und teilt und da sind wir dann wieder bei den Daten. Also das ärztliche Wissen wird vielleicht in grossen Wissensdatenbanken geteilt und jeder der angeschlossen ist kann beliebig davon profitieren» (Laukemann, F18). «Und vielleicht entstehen auch Franchising-Modelle wie bei McDonalds. […] Wir als Spital liefern nur noch die Infrastruktur und begleiten das Ganze. Du kannst also einfach ein Operationshaus betreiben und ich stelle alles rein. […] Aber das ist kein Modell, das in den nächsten 10 Jahren voll durchschlägt, dass die Spitäler sich völlig verändern. Die Schweiz wird traditionell bleiben, weil wir uns das leisten wollen und (noch) können» (Laukemann, F18). «Ich kenne von Deutschland her aber viel mehr die Tendenz, dass man z.B. eben solche Operationshäuser baut. Und mit der Ambulantisierung wird das bei uns sicher verstärkt kommen. Und dann braucht es Organisationen, die die Patienten länger zu Hause begleiten, was deutlich günstiger ist. Und wir kombinieren das einfach und nennen das dann noch Spital» (Laukemann, F18). «Ich glaube, der nächste Schritt ist erst einmal, die Prozesse grundlegend zu überdenken und da mal einen «Match» zwischen Infrastruktur, Prozessen und Rollen herzustellen» (Märke, F21). «Ich glaube nicht, dass es Richtung Patientenhotel geht. […] Und ja, genau dieser «Hotel-Teil» ist eigentlich der, welcher sich outsourcen liesse. […]. Und wiederum: Ich glaube, die Expertise, das Zusammenbringen von unterschiedlichsten Experten wird im Spital eine immer wichtigere Rolle werden. Auch dieses ganze Wissensmanagement rund um einen Krankheitsfall, das wird entscheidend werden für das Spital» (Märke, F21). 191 OK 5. Digitale Reife UK 5.1. Reifegrad der Spitäler Persönliche Einschätzung des Reifegrads der Schweizer Spitäler (Note 1 «schlecht» - 5 «sehr gut»). Hinweise zu Potenzialen, Hemmfaktoren und akuten Handlungsfeldern. «Das siehst Du als Patient teilweise sehr gut in der Auswirkung, dass es noch Schalter gibt. Ich meine in gewissen Regionalspitälern sitzen Damen noch hinter Panzerglas und geben Dir, wie früher in der Bank, untendurch einen Zettel, wo Du Deine Allergien angeben kannst. […] und dort merkt der Patient, dass die Branche noch hinterherhinkt» (Frangi, F5). «…ich würde 3 bis 3.5 geben, aber eher eine 3. Es ist knapp genügend – wir tun etwas aber wir haben immer noch eine gewisse Anzahl Verhinderer» (Frangi, F23). «Und der allergrösste Blocker ist nicht die technische Machbarkeit, sondern die fehlende Akzeptanz» (Angerer, F9). «Also, wenn man einen Gesamtindex macht, aus: welche Technologien haben sie, wie gut sind sie in der Organisation aufgestellt, wie viel strategische Gedanken machen sie sich zum Thema Innovations- und Technologiemanagement und wie ist die Bereitschaft der Mitarbeitenden, würde ich ihnen vielleicht eine 2 geben» (Angerer, F21). «Höchstens eine 3, wegen all meinen Argumenten. Eigentlich gibt es so viele tolle Beispiele, die in den Spitälern möglich wären. Aus der Welt, wenn man das alles zusammennimmt, was da so möglich ist, dann sind wir völlig am Anfang» (Laukemann, F19). «Es gibt einen Mangel an Fachpersonen, die sind alle hoch ausgelastet. Dass diese Personen dann auch Zeit haben und die Organisation das nötige Geld, um solche Entwicklungen intern treiben zu können, das ist die Krux an der Sache. Das ist die heikle Kombination, dass das Tagesgeschäft einem die Möglichkeit zur Innovation wie aufsaugt» (Märke, F17). «Schwierig zu sagen. Ich würde sagen eine 2, weil das Faxgerät noch überall präsent ist. Und wenn Sie wissen, was heutzutage möglich wäre und dann sehen, wie viel davon umgesetzt ist, dann sind wir nicht sehr weit, oder?» (Märke, F23). 192