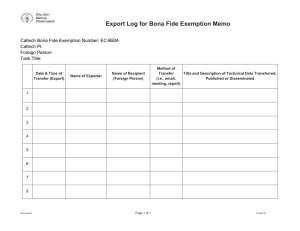Lehr-Lern-Plan (LLP) für das Modul „Kognitions- / Entscheidungspsychologie“ Basiert auf der Modulbeschreibung Name Studiengang: Bachelor (BBA 2.0) Angabe zum Studienzeitpunkt: Modul: Kognitions- / Entscheidungspsychologie Kurse: Unterrichtssprache: Deutsch ECTS-Credits/Modul: 6 ECTS-Credits/Kurs: 6 Erforderliche Vorkenntnisse: (u.a. Modul(e) / Fach) Siehe Modulbeschreibung Arbeitsleistungsaufwand in Stunden: Total: Präsenzunterricht: Betreutes Selbststudium: Freies Selbststudium: 180 48 90 42 Erstellungsdatum und Autor/in 1 20. März 2015, Sarah Chiller / Jörn Basel / Stefan Ryf / Christian Fichter. V1.1_01.04.2016, V4_20.04.2021 Eve Moser, Damian Läge, V5 11.02.22 Eve Moser, V6_20.12.2023 Samuel Studer Kompetenznachweis gemäss Prüfungsreglement Präsenzverpflichtung: Prüfungsform Prüfungsdauer Hilfsmittel Online oder Schriftliche Klausur 180min Onlineprüfung: open book / Schriftliche Prüfung: closed book 2 Dispositionsziele des Moduls/Kurses (Ausgangskompetenzen) Die Studierenden … • gewinnen einen Überblick über Inhalte und Methoden der Kognitions- und Entscheidungspsychologie und deren Anwendung im wirtschaftlichen Kontext. • lernen eine Auswahl der wichtigsten kognitions- und entscheidungspsychologischen Prozesse kennen und können auf dieser Basis das menschliche Verhalten in wirtschaftlichen Situationen zuverlässig erklären und vorhersagen. • gewinnen einen Überblick über das Themenspektrum der Kognitions- und Entscheidungspsychologie. • lernen eine Auswahl wichtiger kognitions- und entscheidungspsychologischer Konzepte und empirischer Befunde kennen. • stellen die kennengelernten Inhalte in Bezug zu ihrem Menschenbild und zur eigenen beruflichen Umwelt. • können das Gelernte gewinnbringend im eigenen beruflichen und privaten Umfeld anwenden. Seite 1 (von 18) 3 Angaben zum Lernprozess (Verzahnung Selbststudium, Präsenzunterricht, Kompetenznachweis) Betreutes Selbststudium 1: Kognitionspsychologie: Wahrnehmung Zeitraum: Begleitend zum Präsenzunterricht Arbeitsauftrag Thema/Lerninhalte Quellen obligatorisch: • Definition und Geschichte der Psychologie • Psychologische Schulen: Gestaltpsychologie und Kognitive Psychologie • Sokolowski: Kapitel 2: Was ist Psychologie? • Sokolowski: Kapitel 4: Wahrnehmung • Stock & Stock: Kapitel 2: Wahrnehmung und Handlungssteuerung • Hagendorf, Krummenacher, Müller & Schubert: Kapitel 4: Psychophysik • Dabic, M., Schweiger, G., &: Ebner, U. (2008). Printwerbung: Der erste Eindruck zählt! Werbeforschung mit dem Tachistoskop. transfer: Werbeforschung & Praxis, 54 (1), 26-35. • Tagesanzeiger (2010). Also doch: Frauen sind schmerzempfindlicher • Deutsche Schmerzgesellschaft: Schmerz bei Frauen und Männer Seite 2 (von 18) • Organisationsprinzipien der Wahrnehmung • Sinneswahrnehmung und Rezeptoren • Verfahren der Psychophysik Zielbeitrag: Transfer aF&E in die Lehre; Transfer Lehre-Praxis, Nachhaltige Entwicklung, Internationalisierung; Denken & Handeln in Wertschöpfungsprozessen Die Studierenden … Kompetenznachweis (Kompetenzbereich, Art, Umfang, Inhalt & Massstab) • kennen die Definition und die geschichtliche Einbettung der Kognitiven Psychologie • Reflexion des eigenen Menschenbildes • • kennen die Grundlagen der Wahrnehmung und die verschiedenen Verarbeitungsstufen der sensorischen Informationsverarbeitung Transfer in die eigene Berufs- und Lebensrealität • verstehen die Prinzipien der Psychophysik und kennen ihre Anwendungsfelder • verstehen die Gestaltprinzipien und ihre Anwendung im UsabilityBereich Operationalisierte Lernziele Zielbeitrag: Transfer aF&E in die Lehre; Transfer Lehre-Praxis, Nachhaltige Entwicklung, Internationalisierung; Denken & Handeln in Wertschöpfungsprozessen Präsenzblock 1: Kognitionspsychologie: Wahrnehmung Thema/Lerninhalte Rolle der Psychologie in den Kognitionswissenschaften • Geschichte der Psychologie • Die Anfänge • Psychophysik • Die psychologischen Schulen Kognitive Psychologie • Geschichtliche Einbettung • Definition • Prinzip der Modularisierung • Methode der Reaktionszeitmessung Wahrnehmung • Sensorische Wahrnehmung • Gesichterwahrnehmung • Informationsverarbeitung im Nervensystem • Top Down Wahrnehmung • Gestaltpsychologie Seite 3 (von 18) Operationalisierte Lernziele Die Studierenden … Lehr-Lern-Methode & Lehrmedien Kompetenznachweis • Kennen die Definition von kognitiver Psychologie • Lehrgespräch • Beteiligung im Unterricht • • Gruppenarbeit • Verstehen die Prozesse der sensorischen Informationsverarbeitung • Präsentationen Selbständige Überprüfung der Lernziele • Moderierte Diskussion • • Diskussion in Kleingruppen Reflexion des eigenen Menschenbildes • Transfer in die eigene Berufs- und Lebensrealität • wissen um die Anwendung der Wahrnehmungspsychologie im Bereich der Usability Betreutes Selbststudium 2: Kognitionspsychologie: Aufmerksamkeit & Gedächtnis Zeitraum: Begleitend zum Präsenzunterricht Kompetenznachweis (Kompetenzbereich, Art, Umfang, Inhalt & Massstab) • • Reflexion des eigenen Menschenbildes Filterfunktion der Aufmerksamkeit wissen um die Limitationen der Aufmerksamkeit (Flaschenhälse) • • Transfer in die eigene Berufs- und Lebensrealität Unwillkürliche und willkürliche Aufmerksamkeitsprozesse kennen die Prinzipien der Aufmerksamkeit • Kennen die Funktionen Enkodieren, Speichern, Abrufen im Gedächtnis; können für diese Funktionen Alltagsbeispiele geben und Fehlerquellen nennen. • Kennen die Unterteilung in sensorisches, Kurzzeitund Langzeitgedächtnis und können Alltagsbeispiele dazu nennen. Thema/Lerninhalte Quellen obligatorisch: • Inhalte und Funktionen des Bewusstseins • Sokolowski: Kapitel 3: Bewusstsein • Sokolowski: Kapitel 5: Aufmerksamkeit • Sokolowski: Kapitel 7: Gedächtnis • Tages-Anzeiger (2023). Putzerfische erkennen sich auf Fotos. • Schmeisser, D.R. (2009). Eyetracking – mit den Augen der Nutzer sehen. In F. Reese (Hrsg.), WebsiteTesting (S. 263-278). Göttingen: BusinessVillage. • Schriftreihe Verkehrssicherheit (2017). Wie kann die Unfallgefahr "Ablenkung im Strassenverkehr" verringert werden? 11-12 (bis Mitte) Seite 4 (von 18) • • Operationalisierte Lernziele Die Studierenden … Arbeitsauftrag • Zielbeitrag: Transfer aF&E in die Lehre; Transfer Lehre-Praxis, Nachhaltige Entwicklung, Internationalisierung; Denken & Handeln in Wertschöpfungsprozessen Mehrspeichermodell des Gedächtnisses Präsenzblock 2: Zielbeitrag: Transfer aF&E in die Lehre; Transfer Lehre-Praxis, Nachhaltige Entwicklung, Internationalisierung; Denken & Handeln in Wertschöpfungsprozessen Kognitionspsychologie: Aufmerksamkeit & Gedächtnis Thema/Lerninhalte Bewusstsein • Operationalisierte Lernziele Die Studierenden … Lehr-Lern-Methode & Lehrmedien Kompetenznachweis • • Lehrgespräch • Beteiligung im Unterricht • Gruppenarbeit • • Übungen (Plenum oder Kleingruppen) Selbständige Überprüfung der Lernziele • • Präsentationen Reflexion des eigenen Menschenbildes • Moderierte Diskussion • • Diskussion in Kleingruppen Transfer in die eigene Berufs- und Lebensrealität Bedeutung von Bewusstsein bei kognitiven Prozessen • Aufmerksamkeit • Selektive Aufmerksamkeit • Geteilte Aufmerksamkeit • Aufmerksamkeitsintensität • Aufmerksamkeitseffekte • Transfer: Menschenbild Gedächtnis • Netzwerkmodell • Mehrspeichermodell • Transfer: Nachhaltiges Lernen Seite 5 (von 18) • Kennen die verschiedenen Prinzipien der Aufmerksamkeitssteuerung Wissen um die Möglichkeiten der unbewussten Verarbeitung Können Wahrnehmungsprinzipien bei der Gestaltung von Werbe- und Informationsmaterial anwenden • Verstehen das Gedächtnismodell und können praktische Beispiele dazu nennen • Kennen den Zusammenhang von sensorischem, Arbeitsund Langzeitgedächtnis • Kennen die Netzwerk-Metapher des Gehirns • Wissen, dass das Gedächtnis nicht wie eine Kamera funktioniert, und verstehen, weshalb das so ist. • Verstehen, was diese Metaphern für ihr alltägliches Menschenbild bedeutet Betreutes Selbststudium 3: Kognitionspsychologie: Lernen & Gedächtnis Zeitraum: Begleitend zum Präsenzunterricht Arbeitsauftrag Thema/Lerninhalte Quellen obligatorisch: • Fehlerquellen im Gedächtnis • • Gedächtnistraining • Lerntheorien (Konditionierung, Modellernen) Dworschak, M. (2016). Das eingebildete Leben. In: Der Spiegel, 1, 14-21. • Sokolowski: Kapitel 6: Lernen • Texte zu "Bringt Gewalt in Medien Menschen dazu, selbst gewalttätig zu werden?" (Meyers (2014). Psychologie, 324 und Süddeutsche.de. Was sagt die Wissenschaft (2006)) Seite 6 (von 18) Zielbeitrag: Transfer aF&E in die Lehre; Transfer Lehre-Praxis, Nachhaltige Entwicklung, Internationalisierung; Denken & Handeln in Wertschöpfungsprozessen Operationalisierte Lernziele Die Studierenden … Kompetenznachweis (Kompetenzbereich, Art, Umfang, Inhalt & Massstab) • kennen mögliche Ursachen für Gedächtnisfehler • Reflexion des eigenen Menschenbildes • Kennen die drei klassischen Lerntheorien und können Alltagsbeispiele dazu nennen. • Transfer in die eigene Berufs- und Lebensrealität Präsenzblock 3: Zielbeitrag: Transfer aF&E in die Lehre; Transfer Lehre-Praxis, Nachhaltige Entwicklung, Internationalisierung; Denken & Handeln in Wertschöpfungsprozessen Kognitionspsychologie: Lernen & Gedächtnis Thema/Lerninhalte • Fehlerquellen im Gedächtnis • Gedächtnistraining • Lerntheorien: Konditionierung und Modellernen, erlernte Hilflosigkeit Seite 7 (von 18) Operationalisierte Lernziele Die Studierenden … • Setzen sich damit auseinander, wo in ihrem beruflichen Alltag verschiedene Gedächtnisfunktionen spielen: Konditionierung und Modellernen, Priming, Prozedurales Wissen, Elaboration von semantischem Wissen etc. • Kennen Möglichkeiten des Gedächtnistrainings und lernen, dies gleichzeitig kritisch zu betrachten. • Kennen Situationen, die anfällig sind für Gedächtnisfehlleistungen • Kennen das klassische und operante Konditionieren, das Lernen am Modell und die erlernte Hilflosigkeit Lehr-Lern-Methode & Lehrmedien Kompetenznachweis • Lehrgespräch • Beteiligung im Unterricht • Gruppenarbeit • • Präsentationen Selbständige Überprüfung der Lernziele • Moderierte Diskussion • • Diskussion in Kleingruppen Reflexion des eigenen Menschenbildes • Transfer in die eigene Berufs- und Lebensrealität Zielbeitrag: ☒ Transfer aE&F in die Lehre; ☒ Transfer Lehre-Praxis; ☒ Nachhaltige Entwicklung; Internationalisierung; Denken & Handeln in Wertschöpfungsprozessen Begleitetes Selbststudium 4: Denken & kognitiver Apparat Zeitraum: Begleitend zum Präsenzunterricht Arbeitsauftrag Thema/Lerninhalte Quellen obligatorisch: • Hauptprozesse des Denkens: Urteilen, Entscheiden, Problemlösen • Können die Begrifflichkeiten Urteilen, Entscheiden und Problemlösen definieren Operationalisierte Lernziele Die Studierenden … • Betsch, Funke & Plessner (2011): Kapitel 1 • Betsch, Funke & Plessner (2011): Kapitel 2.12.3 • Instinkt • • Bischof (2014): Kapitel 12.3.1-12.3.3 • Appetenzverhalten und Aversion Kennen die Grundlagen der Urteilsforschung • Können die Grundbegriffe Instinkt, Anreiz und Akzess im Kontexts des kognitiven Apparats erklären • Können die menschlichen CopingStrategien einordnen und erklären Quellen fakultativ • Bischof (2014): Kapitel 12 bis 14 • Kahneman, D. (2012). Schnelles Denken, langsames Denken. Seite 8 (von 18) • Anreiz und Akzess • Coping-Apparat Kompetenznachweis • Vorgängige oder nachträgliche Lernselbstkontrolle • Selbstreflexion und Transfer in den eigenen beruflichen und privaten Kontext Zielbeitrag: ☒ Transfer aE&F in die Lehre; ☒ Transfer Lehre-Praxis; ☒ Nachhaltige Entwicklung; Internationalisierung; Denken & Handeln in Wertschöpfungsprozessen Präsenzblock 4 Denken & kognitiver Apparat Thema/Lerninhalte Operationalisierte Lernziele Lehr-Lern-Methode & Lehrmedien Kompetenznachweis • Denken: Wozu nützt es in der Praxis? • • Lehrgespräch • Beteiligung im Unterricht • Grundbegriffe und -themen des Denkens • Gruppenarbeit • • Wo und wie findet denken statt? • Präsentationen Aktives Mitwirken in Gruppenarbeiten • Der kognitive Apparat: Instinkt, Antrieb und Anreiz • Moderierte Diskussion • • • Diskussion in Kleingruppen Selbständige Überprüfung der Lernziele Der kognitive Apparat: Coping-Strategien • Der kognitive Apparat: Phantasie und Reflexion Seite 9 (von 18) Ich kann die wichtigsten Themen der Denkpsychologie beschreiben • Ich kann die Praxisrelevanz anhand von Beispielen erläutern • Ich kann Denken in der Gesamtheit der kognitiven Prozesse positionieren • Ich kann die Hauptelemente des Denkens erklären • Ich kann den kognitiven Apparat erklären • Ich kann Begriffe wie «Phantasie» und «Reflexion» einordnen Begleitetes Selbststudium 5 Entscheiden & Urteilen Zeitraum: Begleitend zum Präsenzunterricht Arbeitsauftrag Thema/Lerninhalte Quellen obligatorisch: • Grundregeln und Strategien der Urteilsbildung • Kognitive Täuschungen Operationalisierte Lernziele Die Studierenden … • Können die wichtigsten kognitive Täuschungen erklären und deren Praxisrelevanz verdeutlichen • Können heuristische und systematische Modi der Urteilsbildung erklären • Kennen die Phasen des Rahmenmodells für Entscheidungsprozesse • Können den Einfluss von Gefühlen in Entscheidungssituationen einordnen Rahmenmodell für Entscheidungsprozesse • Können die Theorie des erwarteten Nutzens umschreiben • Betsch, Funke & Plessner (2011): Kapitel 4.24.3 • Betsch, Funke & Plessner (2011): Kapitel 5.3 • Modi der Urteilsbildung • Betsch, Funke & Plessner (2011): Kapitel 7 • • Betsch, Funke & Plessner (2011): Kapitel 8.3 Struktur von Entscheidungssituationen • Pfister, H. R., Jungermann, H., & Fischer, K. (2017). Kapitel: 6.1-6.2 • Grundlagen der Entscheidungstheorie • Typen von Entscheidungstheorien • Quellen fakultativ Zielbeitrag: ☒ Transfer aE&F in die Lehre; ☒ Transfer Lehre-Praxis; ☒ Nachhaltige Entwicklung; Internationalisierung; Denken & Handeln in Wertschöpfungsprozessen • Betsch, Funke & Plessner (2011): Kapitel 5 • Betsch, Funke & Plessner (2011): Kapitel 6 • • Pfister, H. R., Jungermann, H., & Fischer, K. (2017). Kapitel: 5 Erwartungs-Nutzen-Modelle • Können die Prospect-Theorie erklären • • Pfister, H. R., Jungermann, H., & Fischer, K. (2017). Kapitel: 9 Entscheiden unter Unsicherheit • • • Prospect-Theorie Können das Vierfeldermuster im Kontext der Risikowahrnehmung anhand von Beispielen erklären Kahneman, D. (2003). A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality. American Psychologist, 58(9), 697–720 • Können evolutionäre Ansätze des Urteilens beschreiben (Theorie der ökologischen Rationalität) • Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (Hrsg.). (1982). Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Cambridge, MA: Cambridge University Press. • Chaiken, S. (1989). Heuristic and systematic information processing within and beyond the persuasion context. Unintended thought, 212252. Seite 10 (von 18) Kompetenznachweis • Vorgängige oder nachträgliche Lernselbstkontrolle • Selbstreflexion und Transfer in den eigenen beruflichen und privaten Kontext Zielbeitrag: ☒ Transfer aE&F in die Lehre; ☒ Transfer Lehre-Praxis; ☒ Nachhaltige Entwicklung; Internationalisierung; Denken & Handeln in Wertschöpfungsprozessen Präsenzblock 5 Entscheiden & Urteilen Thema/Lerninhalte Operationalisierte Lernziele Lehr-Lern-Methode & Lehrmedien Kompetenznachweis • Recap: Grundkonzepte bei Urteilen und Entscheidungen • • Lehrgespräch • Beteiligung im Unterricht • • Gruppenarbeit • Ausgangslage: Die Frage nach der menschlichen Rationalität in Entscheidungsprozessen • Präsentationen Aktives Mitwirken in Gruppenarbeiten • Moderierte Diskussion • • Diskussion in Kleingruppen Selbständige Überprüfung der Lernziele • Erwartungs-mal-Wert-Entscheidungsmodelle: Historische Entwicklung • Exkurs: Zwei-Prozess-Modelle in Entscheidungen • Überblick: Heuristics & Biases – Ansatz • Ökologische Rationalität: Anpassung an die statistischen Normen der Umwelt • Verlust- vs. Gewinnszenarien: Prospect Theorie und motivationale Rationalität Seite 11 (von 18) • Ich kann die Grundfrage nach der menschlichen Rationalität einordnen Ich kann die historische Entwicklung der Erwartungs-malWert-Entscheidungsmodelle beschreiben • Ich kann die wichtigsten ZweiProzess-Modelle einordnen • Ich kenne die Relevanz «kognitiver Leichtigkeit» für die wirtschaftliche Praxis • Ich kann die wichtigsten Heuristiken und Biases anhand von Beispielen definieren • Ich kann die Bedeutung des Leitspruchs «simple heuristics make us smart» im Kontext der ökologischen Rationalität erklären • Ich kann die Hauptaussagen der Prospect Theorie und der motivationalen Rationalität wiedergeben Zielbeitrag: ☒ Transfer aE&F in die Lehre; ☒ Transfer Lehre-Praxis; ☒ Nachhaltige Entwicklung; Internationalisierung; Denken & Handeln in Wertschöpfungsprozessen Begleitetes Selbststudium 6 Problemlösen & Kreativität Zeitraum: Begleitend zum Präsenzunterricht Arbeitsauftrag Thema/Lerninhalte Quellen obligatorisch: • Grundlegende Konzepte und Theorien des Problemösens • Können Problemlöseprozesse von anderen Denkprozessen abgrenzen • Funktion von Zielen • • Rubikon-Modell Quellen fakultativ • Problemtypen Können die Phasen des Problemlösens anhand des Rubikon-Modells beschreiben • • Problemlösestrategien • Können den Zusammenhang von Problemen und Zielen erläutern • Können die handlungssteuernde Wirkung von Ziele erklären • Können die Taxonomie von Problemen anhand der jeweiligen Barrierearten nach Dörner mit Beispielen erklären • Betsch, Funke & Plessner (2011): Kapitel 12 • Betsch, Funke & Plessner (2011): Kapitel 14.114.2 Johansson‐Sköldberg, U., Woodilla, J., & Çetinkaya, M. (2013). Design thinking: past, present and possible futures. Creativity and innovation management, 22(2), 121-146. Rechercheaufgabe • Wie definiert die Psychologie Kreativität? • Wie lässt sich Kreativität messen? • Wie lässt sich Kreativität in der Praxis gezielt nutzen? Seite 12 (von 18) Operationalisierte Lernziele Die Studierenden … Kompetenznachweis • Vorgängige oder nachträgliche Lernselbstkontrolle • Selbstreflexion und Transfer in den eigenen beruflichen und privaten Kontext Zielbeitrag: ☒ Transfer aE&F in die Lehre; ☒ Transfer Lehre-Praxis; ☒ Nachhaltige Entwicklung; Internationalisierung; Denken & Handeln in Wertschöpfungsprozessen Präsenzblock 5 Problemlösen & Kreativität Thema/Lerninhalte Operationalisierte Lernziele Lehr-Lern-Methode & Lehrmedien Kompetenznachweis • Einführung: Grundelemente von Problemen • • Lehrgespräch • Beteiligung im Unterricht • • Gruppenarbeit • Aktives Mitwirken in Gruppenarbeiten Herausforderungen bei Problemen: Barrieren, Komplexität und Fixierungen • Präsentationen • • Moderierte Diskussion Selbständige Überprüfung der Lernziele • Diskussion in Kleingruppen • • Spezialfall des Problemlösens: Kreativität Prüfungsvorbereitung: Fragen und Prüfungsmodus Seite 13 (von 18) Ich kann Problemlösen im Kontext von Denkprozessen einordnen • Ich kann die Teilstrukturen des Langzeitgedächtnisses einordnen • Ich kann die Barrieretypen nach Dörner anhand von Beispielen erklären • Ich verstehe die Definition und die Herausforderungen im Umgang mit komplexen Problemen • Ich kann das Phänomen der Fixierung als Kontexteffekt beim Problemlösen erklären • Ich kann den Kreativitätsbegriff aus verschiedenen Perspektiven beurteilen • Ich kann erklären, was Kreativität auszeichnet • Ich kann die Relevanz und Anwendungsbeispiele von Kreativität in der Arbeitswelt einordnen Begleitetes Selbststudium Nachbereitung Präsenzblöcke 4, 5 und 6 Zeitraum: bis zum Modulende Arbeitsauftrag Thema/Lerninhalte Nachbereitung Präsenzblöcke 4, 5 und 6 • Urteilstheorien Quellen obligatorisch: • Arten von Urteilen • Betsch, Funke & Plessner (2011): Kapitel 2 • • Betsch, Funke & Plessner (2011): Kapitel 3 Rahmenmodell für den Prozess des Urteilens • Gigerenzer, G., & Gaissmaier, W. (2015). Intuition und Führung. In Emotion und Intuition in Führung und Organisation (pp. 19-42). Springer Gabler, Wiesbaden. • Wahrnehmen und Urteilen • Salienz • Vorwissen und Erwartungen • Schemata • Intuition • Intuition und Führung • Der adaptive Werkzeugkasten (adaptive Toolbox) • • Welche Empfehlungen geben Gigerenzer & Gaissmaier (2015) Führungskräften? Wie realistisch schätzen Sie als Praktiker deren Implementierung ein? • Was versteht man unter defensiven Entscheidungen? Entwickeln Sie ein Beispiel wie im Management defensive Entscheidungen getroffen werden und warum? • Lassen sich Probleme besser durch Berechnung lösen als durch Intuition? Nehmen Sie dazu Stellung. Quellen fakultativ: • Gigerenzer, G. (2004). Fast and frugal heuristics: The tools of bounded rationality. In D. J. Koehler, & N. Harvey (Hrsg.), Blackwell handbook of judgment and decision making. (S. 62– 88). Malden: Blackwell Publishing. • Gigerenzer, G., & Gaissmaier, W. (2011). Heuristic decision making. Annual Review of Psychology, 62, 451–482. doi:10.1146/annurevpsych-120709-145346. Seite 14 (von 18) Zielbeitrag: ☒ Transfer aE&F in die Lehre; ☒ Transfer Lehre-Praxis; ☒ Nachhaltige Entwicklung; Internationalisierung; Denken & Handeln in Wertschöpfungsprozessen Operationalisierte Lernziele Die Studierenden … • Kennen wichtige Strömungen wissenschaftlicher Urteilsforschung • Kennen Stärken und Schwächen klassischer Urteils- und Entscheidungsmodelle • Verstehen adaptive Urteilsstrategien im Kontext von Führung Kompetenznachweis • Quellenstudium mit Leitfragen • Gigerenzer, G., & Selten, R. (2003). Bounded rationality: The adaptive toolbox. Psychology & Marketing, 20(1), 87–92. • Gigerenzer, G., Todd, P. M. & the ABC Research Group (Eds.). (1999). Simple heuristics that make us smart. New York: Oxford University Press. • Weber, E. U., & Johnson, E. J. (2009). Mindful judgment and decision making. Annual review of psychology, 60, 53-85. • Greifeneder, R., Bless, H., & Fiedler, K. (2017). Social cognition: How individuals construct social reality. Psychology Press. • Probabilistische Wahrnehmung – Linsenmodell • Quellen vgl. Brunswick (1952, 1955) | Pfister et al. (2017) | Plessner (2011) | Abb.: in Anlehnung an Betsch et al. (2011), S. 27 | Pfister et al. (2017), S. 129 • Statistisches Schließen – Bayes-Theorem • Quellen vgl. Pfister et al. (2017) | Plessner (2011) | Gigerenzer (2013), S. 221 | Gigerenzer, G., Gaissmaier, W., Kurz-Milcke, E., Schwartz, L. M., & Woloshin, S. (2009). Glaub keiner Statistik, die du nicht verstanden hast. Gehirn & Geist, (10), 34-39. • Bernoulli, D. (1954). Exposition of a new theory on the measurement of risk. Econometrica, 22, 23–36. • Betsch, Funke & Plessner: Kapitel 8: Die selektionale Phase • Betsch, Funke & Plessner: Kapitel 9: Die präselektionale Phase • Analysieren Sie rückblickend den Entscheidungsprozess bei Ihrer letzten größeren Anschaffung. Was für Phasen gab es? Welche Entscheidungsregeln haben Sie angewendet? Seite 15 (von 18) • Chen, S. F. S., Monroe, K. B., & Lou, Y. C. (1998). The effects of framing price promotion messages on consumers' perceptions and purchase intentions. Journal of retailing, 74(3), 353-372. • Frederick, S. (2005). Cognitive reflection and decision making. Journal of Economic Perpectives, 19(4), 25–42. • Kruglanski, A. & Orehec, E. (2007). Particioning the domain of social inference: Dual mode and systems models and their alternatives. Annual Review of Psychology, 58, 291–316. • Levin, I. P., Schnittjer, S. K., & Thee, S. L. (1988). Information framing effects in social and personal decisions. Journal of Experimental Social Psychology, 24(6), 520–529. doi:10.1016/0022-1031(88)90050-9. • Strack, F. & Deutsch, R. (2004). Reflective and impulsive determinants of social behavior. Personality and Social Psychology Review, 8, 220– 247. Seite 16 (von 18) 4 Literatur, Hilfsmittel Die Lehrbücher „Allgemeine Psychologie für Studium und Beruf“ (Sokolowski, 2013) und „Allgemeine Psychologie für Bachelor: Denken, Urteilen, Entscheiden, Problemlösen“ (Betsch et al., 2011) werden von uns beschafft und Ihnen zugesandt. Die übrigen im Lehr-/Lernplan als obligatorisch aufgeführten Buchkapitel und Artikel stehen im Lernraum als PDFs zur Verfügung. 4.1 Eingesetzte Lehrmittel, Hilfsmittel • Betsch, T., Funke, J., & Plessner, H. (2011). Allgemeine Psychologie für Bachelor: Denken-Urteilen, Entscheiden, Problemlösen. Berlin: Springer. (versendet) • Bischof, Norbert (2014). Psychologie. Ein Grundkurs für Anspruchsvolle. Stuttgart: Kohlhammer. (OpenOlat) • Dabic, M., Schweiger, G. &: Ebner, U. (2008). Printwerbung: Der erste Eindruck zählt! Werbeforschung mit dem Tachistoskop. transfer: Werbeforschung & Praxis, 54 (1), 26-35. (OpenOlat) • Gigerenzer, G., & Gaissmaier, W. (2015). Intuition und Führung. In Emotion und Intuition in Führung und Organisation (pp. 19-42). Springer Gabler, Wiesbaden. (OpenOlat) • Hagendorf, H., Krummenacher, J., Müller, H.-J. & Schubert, T. (2011). Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Heidelberg: Springer. → Kapitel 4: Psychophysik. (OpenOlat) • Hildebrandt, T. (2015). Stubs zum Glück. In Die Zeit (01/2015). (OpenOlat) • Pfister, H.R., Jungermann, H., & Fischer, K. (2017). Die Psychologie der Entscheidung (4. Aufl.). Berlin: Springer. (OpenOlat) • Lovallo, D. & Sibony, O. (2010). The case for behavioral strategy. McKinsey Quarterly, 2, 30-43. (OpenOlat) • Schmeisser, D.R. (2009). Eyetracking – mit den Augen der Nutzer sehen. In F. Reese (Hrsg.), Website-Testing (S. 263-278). Göttingen: BusinessVillage. (OpenOlat) • Sokolowski, K. (2013). Allgemeine Psychologie für Studium und Beruf. München: Pearson. (versendet) • Stock, A. & Stock, C. (2007). Psychologie (2. Auflage). Nürnberg: MMD. → Kapitel 2: Wahrnehmung und Handlungssteuerung. (OpenOlat) 4.2 Empfohlene / weiterführende Literatur • Ariely, D. (2009). The end of rational economics. Harvard Business Review, 87 (7-8), 78-84. • Artinger, F., Petersen, M., Gigerenzer, G. & Weibler, J. (2014). Heuristics as adaptive decision strategies in management. Journal of Organizational Behavior, 36 (1), 33-52. • Bazerman, M. & Moore, D. A. (2012). Judgment in managerial decision making (8th Ed.). Hoboken: Wiley. • Felser, G. (2007). Werbe- und Konsumentenpsychologie (3. Aufl). Berlin: Springer. • Frey, B. S. & Benz, M. (2001). Ökonomie und Psychologie: eine Übersicht. Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich. • Gigerenzer, G. (2007). Bauchentscheidungen. Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition. München: Bertelsmann. Seite 17 (von 18) • Gigerenzer, G. & Gaissmaier, W. (2006): Denken und Urteilen unter Unsicherheit: Kognitive Heuristiken. In: Funke, J. (Hrsg.): Denken und Problemlösen, Göttingen 2006, S. 329- 374. • Gladwell, M. (2005). Blink!: Die Macht des Moments. Frankfurt am Main: Campus. • Goldstein, D. G., Johnson, E.J., Herrmann, A. & Heitmann, M. (2008). Nudge your customers toward better choices. Harvard Business Review, 86(12), 99-105. • Gudszeca, J. (2015). The last mile problem – how data science and behavioral science can work together. Deloitte Working Paper. • Heath, C., & Heath, D. (2007). Made to stick: Why some ideas survive and others die. New York: Random House. • Heath, C., Larrick, R.P. & Klayman, J. (1998). Cognitive repairs: How organizations compensate for the shortcoming of individual learners. Research in organizational behavior, 20, 1-37. • Hoeffler, S. (2003). Measuring preferences for really new products. Journal of Marketing Research, 40 (4), 406-420. • Johnson, E.J., Shu, S.B., Dellaert, B.G., Fox, C., Goldstein, D.G., Häubl, G. & Weber, E.U. (2012). Beyond nudges: Tools of a choice architecture. Marketing Letters, 23 (2), 487-504. • Kahneman, D. (2012). Schnelles Denken, langsames Denken. München: Siedler. • Mauboussin, M.J. & Callahan, D. (2015). Sharpening your forecasting skills. Credit Suisse Working Paper Series. • Nicholson, N. (1998). How hardwired is human behavior? Harvard Business Review, 76, 134-147. • Schomburg, U. & Drechsel, H.-J. (2015) Marktforschung für den besten Geschmack. Planung & Analyse, 1/2015, 32-35. • Schwaninger, A. (2005). Objekterkennung und Signaldetektion: Anwendungen in der Praxis. In B. Kersten (Hrsg.), Praxisfelder der Wahrnehmungspsychologie (S. 108132). Bern: Huber. Seite 18 (von 18)