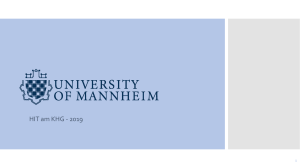Geschäftsprozesse und Marketingkonzept Modul 2: Marktanalyse Dr. Florian Hohmann St. Gallen, 3. Oktober 2022 From insight to impact Agenda 1. Administratives 2. Brush Up Vorlesung 1 & 2 3. Lösung Modul 2 Übung BWL A 2 Agenda 1. Administratives 2. Brush Up Vorlesung 1 & 2 3. Lösung Modul 2 Übung BWL A 3 Reminder: Ablauf Übung BWL A 4 Agenda 1. Administratives 2. Brush Up Vorlesung 1 & 2 3. Lösung Modul 2 Übung BWL A 5 Struktur der Geschäftsprozesse Übung BWL A 6 Unternehmen wollen Wertschöpfung erzeugen! Übung BWL A 7 Ziele der Geschäftsprozesse von Unternehmen Übung BWL A 8 Der Kunde ist König…und subjektiv! Übung BWL A 9 Ziele der Geschäftsprozesse von Unternehmen Übung BWL A 10 (Möglichst) langfristige Kundenbeziehungen Übung BWL A 11 Langfristige Kundenbeziehungen Übung BWL A 12 Langfristige Kundenbeziehungen – Prüfung 2018 Übung BWL A 13 Preis vs. Zahlungsbereitschaft Übung BWL A 14 Agenda 1. Administratives 2. Brush Up Vorlesung 1 & 2 3. Lösung Modul 2 Übung BWL A 15 Gliederung Modul 2 Übung BWL A 16 Prüfung 2016 Übung BWL A 17 Modul 2: Wertschöpfung, Ziele, SWOT-Analyse Modul 2 - Grundauftrag Erarbeiten Sie sich einen Überblick über die Wertschöpfungskette und führen Sie eine Angebotsund Marktanalyse auf Basis der SWOT-Analyse durch, indem Sie folgende Fragen beantworten. Frage 2a Was ist die Wertschöpfung der Destination Laax? Zeichnen Sie die Wertschöpfungskette der Destination und ordnen Sie darin das Unternehmen „Weisse Arena“ ein. Optional: Welchem Typ Wertschöpfungskonfiguration (vgl. Buch Abb. 60) entspricht die „Weisse Arena“? Übung BWL A 18 Übung BWL A 19 Frage 2a Übung BWL A 20 BSP Aus der Fallstudie… Übung BWL A 21 Ein Lösungsvorschlag vom letzten Jahr Übung BWL A 22 BSP Frage 2a - Beispiellösung Übung BWL A 23 BSP Frage 2a - Beispiellösung Übung BWL A 24 Modul 2: Wertschöpfung, Ziele, SWOT-Analyse Frage 2b Welche allgemeinen Unternehmensziele sind für die Geschäftsprozesse der Weissen Arena relevant? Leiten Sie daraus relevante Ziele für Geschäftsprozesse ab aus Sicht von … gewinnorientierten, kurzfristigen Anlegern … Vertretern von der Regierung der Region … Kundinnen und Kunden Berücksichtigen Sie die Bedürfnisse der verschiedenen Anspruchsgruppen und Umweltsphären der Weissen Arena. Beachten Sie dabei insbesondere die wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit der Organisation (s. Buch Kap. 1.3.3). Übung BWL A 25 Frage 2b Legitimation Abgeltung der Anspruchsgruppen Ziele auf Unternehmensebene Wertschöpfung Gewinn Umsatzerträge Ziele auf Ebene der Geschäftsprozesse Kundenzufriedenheit Qualität der Produkte Verkäufe Ø Preise Kosten Marketingkosten Kosten der Leistungserstellung Wachstum Marktanteile Innovationstätigkeit Erwartungen/ Positionierung statisch dynamisch Übung BWL A 26 Prüfung 2016 Übung BWL A 27 Modul 2: Wertschöpfung, Ziele, SWOT-Analyse Frage 2c Erstellen Sie eine Liste von mindestens sechs gesellschaftlichen Megatrends und leiten sie daraus relevante Nachfragetrends für Schneesportgebiete ab. Nutzen Sie dazu u.a. die Berichte auf dem StudyNet und weitere Publikationen. Übung BWL A 28 Hintergrundinfos für Frage 2c Reisetrends (Beispiel Tourismustrends nach Bieger & Laesser) I/III Trend Beschreibung Im Rahmen individualisierter Top-Produkte u.a. für die Global-Class und vermögende Rentner sind Zeiteffiziente (schnell erreichbar ab Flughafen, komfortable und rasche Ausrüstung bspw. im Skiurlaub) und Hide-Aways (Möglichkeit sich von Alltagsleben, vom Verkehrslärm, von der Masse etc. abzugrenzen) wichtige Stichworte. Komfort und Pampering Als Gegentrend zu Komfort und Pampering besteht eine zunehmende Nachfrage nach preiswerten und unterhaltsamen Standardprodukten. Hierbei sind v.a. Berechenbarkeit, Sauberkeit, Unterhaltungswert und Inszenierung besonders wichtig. Zwischen Class und Mass: Dieses Spannungsfeld entspricht der Ausdifferenzierung der Gesellschaft: Denn es gibt einerseits immer mehr Personen, die viel Zeit und wenig Geld und andererseits Personen, die immer weniger Zeit und immer mehr Geld haben. Orientierung Auf der einen Seite findet eine zunehmende Orientierung an Wahlgemeinschaften und an wertmässigen Communities im Sinne einer Neo-Tribalization und auf der anderen Seite eine Orientierung an Familien, traditionellen Wertegemeinschaften und auch einem neuen Nationalismus statt. Beiden Trends ist gemeinsam, dass sie zu einer zunehmenden Nachfrage nach Reisen führen, welche die soziale Interaktion fördern (z. B. Sport, Eventreisen, Besuch von Freunden und Bekannten aber auch Städtereisen und ähnlichen gesellschaftsorientierten Reiseformen). Zwischen Neo- und Old- Tribalization: Dieser Trend entspricht der zunehmenden Neustrukturierung mit Elementen der Entsolidarisierung der Gesellschaft. Quelle: Bieger & Laesser (2009) Übung BWL A 29 Hintergrundinfos für Frage 2c Reisetrends (Beispiel Tourismustrends nach Bieger & Laesser) II/III Trend Beschreibung Enabling vs. Relieving Dank mobiler Informations- und Kommunikationstechnologien stehen einerseits immer flexiblere Reiseformen zur Verfügung. Im Sinne des Freewheeling können auf Reisen flexibel neue Reisebestandteile gebucht werden (vgl. Hyde und Laesser, 2009). IT ermöglicht dabei neue Informations-, Nachfrage- und Reisemuster und befähigt die Konsumenten, die Planung in eigene Hände zu nehmen (Enabling). Als Gegentrend dürfte hierbei wieder ein Relieving im Sinne der Entlastung von Informations- und Entscheidungsaufgaben stehen. Sowohl die gute alte klassische Pauschalreise, die dank den Reisegarantien auch eine hohe materielle Sicherheit bietet, aber auch die individuellen Tours stehen dabei im Fokus. Zwischen Enabling von 'Freewheeling' und Relieving durch Pauschalreisen: Damit wird neue individuelle Flexibilität oder auch eine Erhöhung der Sicherheit und Komplexitätsreduktion ermöglicht. Motivation Zeit haben und Ausbrechen wird in der globalisierten Online-Gesellschaft ein immer wichtigeres Reisemotiv. Parallel dazu entwickelt sich zudem ein Trend, exotisches in der sich rasch verändernden, sich öffnenden Welt kennenzulernen. Den Bedürfnissen nach Ausbruch und nach aktivitätsorientierten Ferien entsprechen Ferien und Aufenthalte in 'Hyde-Aways' wie z. B. eine Hochseeyachtfahrt oder eine anspruchsvolle Bergtour. Auch Kulturreisen mit Begegnungen mit anderen Menschen sind auf die kulturellen Bedürfnisse des Gastes ausgerichtet und sind ideale Produkte, um dem heutigen Bedürfnis nach „Neuem Kennenzulernen“ Rechnung zu tragen. Zwischen Push (Ausbrechen) und Pull (Attraktion durch Sehenswürdigkeiten) Motivation Quelle: Bieger & Laesser (2009) Übung BWL A 30 Hintergrundinfos für Frage 2c Reisetrends (Beispiel Tourismustrends nach Bieger & Laesser) III/III Trend Authentizität vs. originale Kopie Beschreibung Einerseits werden authentische Angebote, vor allem wenn ihnen mehr Qualität, Natürlichkeit und damit Gesundheit sowie kulturelle Einzigartigkeit zugeordnet wird, an Bedeutung gewinnen. Auf der anderen Seite werden als Gegentrend auch gute Kopien, insbesondere in Form künstlicher Erlebniswelten, die Erfolgsgarantie und Sicherheit bieten, auf verstärkten Zuspruch stossen. Zwischen Themenpfaden an Originalschauplätzen und Themenparks lassen sich Angebote jedoch nur schwer positionieren. Dies weil Angebote mit einer geringen Tourismusintensität, z. B. mit mittlerer touristischer Eignung, nicht mehr die geforderte Atmosphäre, das Wohlgefühl und auch die persönliche Sicherheit sowie die Zeiteffizienz bieten. Zwischen Authentizität und originaler Kopie Quelle: Bieger & Laesser (2009) Übung BWL A 31 Hintergrundinfos für Frage 2c Trendliste (Beispiel Tourismustrends nach Bieger) I/II Trend Beschreibung More Quality for Less Money Der Kunde arbeitet heute für einen Franken mehr als noch vor wenigen Jahren. Er verlangt deshalb für diesen Franken mehr. Es geht darum, professionelle Dienstleistungen mit einer Nullfehlertoleranz zu bieten. Der Kunde weiss aufgrund der Reiseerfahrung und Informationszugänglichkeit (vgl. Internet), was er erwarten kann. Zeit- und Preissensibilität Emotionalität, Originalität, Authentizität Sinnstiftung Dieser Trend hängt eng mit dem „More Quality for Less Money“ zusammen. Dass wir in einer Gesellschaft leben, in der immer mehr Freizeit verfügbar ist, ist ein Irrglaube der 80er Jahre. Oft geht die tarifäre Arbeitszeit zurück, der Arbeitnehmer arbeitet jedoch stillschweigend einfach mehr. Gleichzeitig nimmt die Anzahl der Doppelverdienerhaushalte zu, wodurch die frei verfügbare (gemeinsame) Zeit ebenfalls sinkt. Daraus lässt sich eine extreme Zeit- aber auch Preissensibilisierung des Gastes ableiten. Er wird den Erfolg einer touristischen Leistung weitgehend daran messen, wie viele Erlebnisse pro Ferienminute er erhält. In einer künstlichen, oft auch entmenschlichten Arbeitswelt sucht der Kunde wieder Bindungen, Ursprüngliches und Echtes. Oft hängt er an Kindheitserinnerungen. Dabei wird die perfekte Kopie eines heimeligen Originals dem von schwankender, unberechenbarer Qualität belasteten Original vorgezogen (vgl. auch Standardisierungstrend etc.). In der heutigen wirtschaftlichen Entwicklungsdynamik fehlen klare Orientierungspfeiler. Oft bestehen spirituelle und wertmässige Defizite. Sinnstiftende Angebote erlauben es dem Gast, sich (wertebasiert) zu positionieren, sich zu orientieren (vgl. auch Community- und Referenzgruppenmechanismen / -Dynamiken). Sinnstiftende Angebote vermögen über die Wiederherstellung der eigenen Identität eine psychische Wiederherstellungsfunktion zu erfüllen. Quelle: Bieger (1998) Übung BWL A 32 Hintergrundinfos für Frage 2c Trendliste (Beispiel Tourismustrends nach Bieger) II/II Trend Beschreibung Multioptionale Angebote Der Gast möchte möglichst viel, möglichst gleichzeitig, möglichst sofort und möglichst gut machen können. Er will aus einer grossen Angebotsvielfalt auswählen können, auch wenn sich zeigt, dass letztlich doch oftmals immer dieselben, wenigen Angebote genutzt werden. Es geht um das Wissen von Möglichkeiten und Optionen nicht um tatsächlich wahrgenommene Angebote. Sicherheit und Sauberkeit Soft-Individualismus Lust auf positive Überraschung in der Traumwelt Zwar möchte der Gast echte Erlebnisse spüren, was mit einem Ausbruch aus Bekanntem und somit mit Risiko verbunden ist, doch möchte er das Risiko selbst bestimmen können. Risiko ist nicht ein Selbstwert sondern dient der Selbsterfahrung und Identitäts-(Neu)definition und übt damit eine psychische Wiederherstellungsfunktion aus (Walle, 1997). Ausserhalb dieser Situationen werden Sicherheit und Sauberkeit als Teil der Convenience gefragt. In den Ferien möchte der Gast vor allem Zeit für sich selbst haben, sich von Bindung und Verpflichtung lösen können, zu sich finden, möchte sich (Geist & Körper) etwas zu Gute tun (Wellness). Dies aber nicht mehr als ausgeprägter Egoist sondern im Kreise seiner engsten Freunde oder seiner Familie (Horx, 1996). Reisen erlaubt das physische und psychische „Hinter sich lassen“ von Alltag und Problemen, sowie den Eintritt in eine neue, unbekannte oftmals mystische Realität. Gleichzeitig hat der moderne Zeitgenosse sich an standardisierte Qualitäten in praktisch allen Lebensbereichen gewöhnt. Entsprechend projiziert er seine innersten Träume in eine heile Gegenwelt, in die Ferienreise. Oft möchte der Kunde deshalb bewusst oder unbewusst gar nicht alle Details und Hintergründe kennen. In immer mehr Feriensituationen ist die perfekte Traumwelt gefragt, in der man sich positiv überraschen lassen kann. (Romeiss Stracke, 1995) Quelle: Bieger (1998) Übung BWL A 33 Hintergrundinfos für Frage 2c Liste Trends (Wirtschaft & Gesellschaft) Bereich Trend Quellen • Zeitwettbewerb, Zeitsensitivität – Urlaubsdauer: tendenziell kurz oder länger als 2 Wochen – Abgrenzung der Reise (Arbeit/Freizeit) zunehmend schwieriger Zwei-Drittels-Gesellschaft (berufliche / soziale Desintegration von 1/3 der Gesellschaft) Globalisierung Liberalisierung Branchenübergreifende Kooperationen Bieger 1998, Reisemarkt Schweiz 2004 Boos-Nünning 1994; Bieger 1998 Bieger & Laesser 2009 Differenzierungswettbewerb Multioptionalisierung Kombination von verschiedenen Urlaubsarten Vielfältige Reisemotive (Prestige, Risiko, persönliche Herausforderung, Ruhe, Pflege von sozialen Netzwerken, physische Aktivität) Individualisierung, Entsolidarisierung Hedonismus Zeiteffizienz Convenience Communities Flexibilität Internationalisierung Risikogesellschaft Meffert/ Bruhn 2000 Gross 1994 Opaschowski 1996 Horx 1996 Reisemarkt Schweiz, 2004 Bieger 2004 Bieger & Laesser 2009 • Wirtschaft • • • • • • • Gesellschaft • • • • • • • • Übung BWL A 34 Hintergrundinfos für Frage 2c Trendliste Technologie Bereich Technologie Trend Quellen • • • Bieger 2000 Friedemann 2001 • • • • Standardisierung Integrative / Integrierte Systeme Informatisierung; kontinuierliche Weiterentwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) Digitalisierung Ubiquitous Computing Virtualisierung Mobiles Internet (Verbesserung der Anbindung und Datenrate) Übung BWL A 35 Frage 2c Liste relevanter Nachfragetrends für Schneesportgebiete Allgemeiner Megatrend Branchenrelevanter Nachfragetrend für Schneesportgebiete Übung BWL A 36 Ein Lösungsvorschlag vom letzten Jahr Übung BWL A 37 BSP Aufgabe 2c – Beispiellösung Liste relevanter Nachfragetrends für Schneesportgebiete Allgemeiner Megatrend Branchenrelevanter Nachfragetrend für Schneesportgebiete Multioptionale Angebote Vielfältiges Angebot an Haupt- und Neben-leistungen auf und neben der Piste (Pisten, Sport-geräte, Sportarten, Unterhaltung, Wellness…) Soft-Individualismus Unterbringung in Hotels o.ä. mit relativer Privat-sphäre, modulare Lösungen ("Sorglospakete"), Treffpunkte, 3rd-Places Authentizität und Emotionalität Wintersporterlebnis, das dem Ideal aus der Kindheit entspricht (vgl. Pistensport damals/heute) Demographischer Wandel Angebote für Generation 50+ und aktive Senioren die tendenziell eine höhere Ausgabebereitschaft aufweisen Zeitwettbewerb Zeiteffiziente Angebote (Informations-, Kauf- und Nutzungsprozess) Convenience Integrierte Dienstleistungspakete mit effizienten Buchungsmöglichkeiten, CRM- u. Informations-systeme Übung BWL A 38 Modul 2: Wertschöpfung, Ziele, SWOT-Analyse Frage 2d Beurteilen Sie die Chancen und Gefahren der Weissen Arena Gruppe in Bezug auf die in Frage 2c) erarbeiteten Trends. Übung BWL A 39 Frage 2d Chancen-Gefahren-Profil Nachfragetrend (aus Aufgabe 2c) Chance Gefahr Begründung für Beurteilung (grafische Bewertung mittels „x“ auf Pfeilskala) Übung BWL A 40 BSP Aufgabe 2d – Beispiellösung Chancen-Gefahren-Profil Nachfragetrend Chance Gefahr (aus Aufgabe 2a) (grafische Bewertung mittels „ x“ auf Pfeilskala) Begründung für Beurteilung Vielfältiges Angebot Neben Schneesport viele andere Angebote Unterbringung in Hotels relativer Privatsphäre, modulare Lösungen, etc. „Sorglospakete“ betreffend Wintersportaktivitäten, Hotels und Gastronomie auf Austausch ausgelegt, Treffpunkte Idealtypisches Wintersporterlebnis Modernes und komfortables Winter-sportgebiet mit wenig Romantik und Natur, aber trendy Angebote für Generation 50+ Ausrichtung junge/ältere aktive Winter-sportler, weniger auf andere Angebote für ältere Zielgruppen (bspw. Wellness) Zeiteffiziente Angebote Optimale Serviceketten, geringe Wartezeiten Integrierte Dienstleistungspakete Integrierte Diensteistungsketten, einfache Buchungen, CRM, NTC, moderne beheizte Liftanlagen = Weisse Arena Übung BWL A 41 Modul 2: Wertschöpfung, Ziele, SWOT-Analyse Frage 2e Wählen Sie drei Konkurrenzgebiete, welche ähnliche Produkte bieten sowie die gleichen Zielmärkte ansprechen und sammeln Sie für diese angebotsrelevante Informationen (Vorschläge für Konkurrenzgebiete: Engelberg/Titlis, ArosaLenzerheide, Davos-Klosters). Übung BWL A 42 Frage 2e Konkurrenzvergleich Gebiet / Unternehmen Gebiet / Unternehmen Gebiet / Unternehmen 1 2 3 ....................... ....................... ....................... Erreichbarkeit Grösse (Pistenkilometer, Anlagen, etc.) Höhenlage Restauration Preise Übung BWL A 43 BSP Aufgabe 2e - Beispiellösung Angebote möglicher Konkurrenzgebiete Angebotsdimension Weisse Arena St. Moritz Zermatt Adelboden-Lenk Erreichbarkeit ab Hauptmarkt Zürich 130 km, mit Auto ca. 1.5h, ÖV 2.25h 207 km, mit Auto ca. 2.5h, ÖV 3.5h 257 km, mit Auto ca. 3.75h, ÖV 3.25h 193 km, mit Auto ca. 2.5h, ÖV 2.5h Pistenkilometer, 220 km, 350 km, 313 km, 210 km, Anzahl Anlagen 27 Anlagen 60 Anlagen 32 Anlagen 72 Anlagen Höhe 1100 - 3300 m.ü.M. 1720 - 3300 m.ü.M. 1620 - 3883 m.ü.M. 1353 - 2362 m.ü.M. Restauration Mittlere Vielfalt Grosse Vielfalt Sehr grosse Vielfalt Geringe bis mittlere Vielfalt Preis für Tageskarte Erwachsene CHF 85.-- CHF 79.-- CHF 79.-- CHF 63.-- (vorgegeben) (High-End) (Party) (Skifahren wie früher) Übung BWL A 44 Modul 2: Wertschöpfung, Ziele, SWOT-Analyse Frage 2f Leiten Sie aus den in Frage 2c) erarbeiteten Trends und den allgemeinen Anforderungen der Schneesportkunden eine Liste von sechs Kriterien für eine Stärken-/Schwächen-Analyse (Konkurrenzanalyse) ab. Übung BWL A 45 Hintergrundinfos für Frage 2f Strukturierung des touristischen Angebotes: Touristische Wertekette (Bsp.) Quelle: Bieger (2001) Übung BWL A 46 BSP Frage 2f – Beispiellösung Kriterienauswahl für Konkurrenzanalyse Kriterium / konkrete Vergleichsgrösse Begründung für Wahl des Kriteriums Preis Differenziert die Gäste über Zahlungsbereitschaft Pistenkilometer Indikator für den Abwechslungsreichtum des Pistenangebots für Ski/Snowboard und Langlauf Beherbergungsangebot (Anzahl/Qualität) Muss sich mit den Präferenzen und der Zahlungs-bereitschaft der Zielgruppe decken Höhenlage Aussage über Schneesicherheit und Dauer der Wintersportsaison Landschaft Attraktivität für Segmente mit Anspruch auf authentisches und naturverbundenes Angebot Wintersportgerätvermietung Verfügbarkeit von Wintersportgeräten für abwechslungsreiche Betätigung am Berg Übung BWL A 47 Modul 2: Wertschöpfung, Ziele, SWOT-Analyse Frage 2g Beurteilen Sie die Stärken und Schwächen der Weissen Arena Gruppe im Vergleich zu den in Frage 2e) gewählten Konkurrenzgebieten hinsichtlich der in 2f) definierten Kriterien. Übung BWL A 48 Frage 2g Stärken-Schwächen Profil (für jedes Konkurrenzgebiet zu erstellen) Kriterium (aus Aufgabe 2e) Stärke Schwäche Begründung für Beurteilung (grafische Bewertung mittels „x“ auf Pfeilskala) = Weisse Arena = Gebiet 2 = Gebiet 3 Gebiete gemäss Auswahl in Aufgabe 2d = Gebiet 4 Übung BWL A 49 BSP Aufgabe 2g Stärken-Schwächen Profil Weisse Arena Kriterium (aus Aufgabe 2e) Stärke Schwäche Begründung für Beurteilung (grafische Bewertung mittels „x“ auf Pfeilskala) Preis Mittlere bis hohe Preise für Ticket, Restauration und Beherbergung Pistenkilometer Grosses Gebiet Beherbergungsangebot (Anzahl/Qualität) Breits und modernes Angebot, tendenziell eher auf jugendliche Wintersportler ausgerichtet Höhenlage Hoch (Gletscher) Landschaft Kein markanter Berg Wintersportgerätvermietun g Konzept New Technology Centers = Weisse Arena = St. Moritz = Zermatt = Adelboden Lenk Gebiete gemäss Auswahl in Aufgabe 1b Übung BWL A 50 Modul 2: Wertschöpfung, Ziele, SWOT-Analyse Frage 2h Identifizieren Sie die wesentlichen Unique Selling Propositions (USP) und Achillesfersen/Problembereiche für die Weisse Arena Gruppe. Übung BWL A 51 Frage 2h USPs - Achillesfersen ... ... ... ... Stärken USP‘s Achillesfersen ... ... ... ... Schwächen Gefahren Chancen Übung BWL A 52 BSP Frage 2h – Beispiellösung USPs - Achillesfersen der Weissen Arena • Attraktionspunkte • Begegnungen mit Freunden • Grosses, bequemes, zeiteffizientes Schneesportgebiet • Integrierte Dienstleistungskette • Image • Innovationskraft • Positionierung • Marktforschung Stärken USP‘s Achillesfersen Schwächen • Wenig Romantik • Wenig Natur • Einseitig auf Schneesport ausgerichtet • Zu starke Zielgruppenfokussierung • Bescheidene Grösse (im internat. Vergleich) • Fehlendes Wellnessangebot • Preis Gefahren Chancen Übung BWL A 53 Prüfung 2016 Übung BWL A 54 Gliederung Modul 2 Übung BWL A 55 Ausblick Normative Orientierungsprozesse Entwicklung von Vision, Mission, Leitbild, Ethik-Kodex, usw. Vision, Mission, Leitbild Modul 1 Marketingkonzept Marktanalyse z.B. SWOT-Analyse des Marktes Strategische Entwicklungsprozesse Strategische Analysen, z. B. • SWOT-Analyse • Branchen-Analyse • Portfolioanalyse zur Entwicklung von Portfoliostrategien • Fähigkeitsanalyse für den Aufbau von Kernkompetenzen • Analyse strategischer Gruppen • Anspruchsgruppenanalyse Operative Führungsprozesse Koordination und Führung des Alltagsgeschäfts Modul 2 Marketingstrategie - Zielmarktentscheid - Positionierungsentscheid Modul 3 Kundenprozesse Modul 4 Leistungserstellungsprozesse Woche 2 Marktanalyse Woche 3 Marketingstrategie Woche 4 Marketingmix I Leistungsinnovationsprozesse Controlling • Kennzahlenermittlung • Überwachung von Prämissen • Fortschrittsmessung Woche 1 Intro / Marketingkonzept MarktPreis- Kommunileistungs- gestaltung kation gestaltung Marketing-Mix Marketing Controlling Marktbezogene Kennzahlen Distribution Modul 5 Woche 5 Marketingmix II Modul 6 Woche 6 Controlling / Innovation Übung BWL A 56