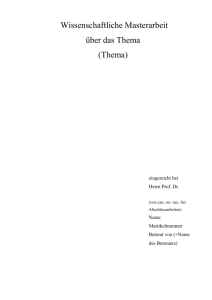Identitätsbildung in sozialen Medien Bernadette Kneidinger-Müller Inhalt 1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Identitätskonstruktion als Entwicklungsaufgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 „Virtuelle Identität“ als idealisierte Selbstdarstellung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Identitätstheorien im Kontext sozialer Medien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Identität als Phänomen mit vielen Facetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ausdrucksformen der Identität in sozialen Medien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Potenziale und Risiken der Identitätsbildung in sozialen Medien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Fazit – Soziale Medien als Ich-Plattformen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 192 193 194 197 199 203 206 207 Zusammenfassung Die Darstellung der eigenen Identität stellt eine Grundvoraussetzung der Nutzung sozialer Medien dar und wird dennoch sehr widersprüchlich diskutiert, beispielsweise, wenn in Massenmedien die „Selbstdarstellungskultur“ als bedenklicher gesellschaftlicher Trend dargestellt wird. Dieser Beitrag zeigt auf, wie Identitätskonstruktion als zentrale Entwicklungsaufgabe des Menschen auch innerhalb sozialer Medien stattfindet und welche besonderen Ausdrucksformen dabei auftreten können. Online- und Offline-Identitäten ergänzen sich gegenseitig und bringen jeweils spezifische Chancen, aber auch Risiken mit sich, die im Rahmen dieses Beitrags diskutiert werden. Schlüsselwörter Identitätskonstruktion · Soziale Medien · Selbstdarstellung · Virtuelle Identität · Identitätstheorien B. Kneidinger-Müller (*) Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Bamberg, Deutschland E-Mail: bernadette.kneidinger-mueller@sozialstiftung-bamberg.de © Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022 J.-H. Schmidt, M. Taddicken (Hrsg.), Handbuch Soziale Medien, https://doi.org/10.1007/978-3-658-25995-2_4 191 192 1 B. Kneidinger-Müller Einleitung „Ich zeige dir, wer ich bin . . . auf meinem Instagram-Profil.“ Derartige Sätze scheinen in der heutigen Internetgesellschaft keineswegs mehr so abwegig. Wer soziale Medien nutzen will, muss dafür zunächst ein gewisses Mindestmaß an Information von sich preisgeben. Die Erstellung und anschließende Pflege von Profilen – in welchem Maße auch immer – gehört für viele Menschen mittlerweile zu einer wenig hinterfragten, alltäglichen Praxis. Wer in sozialen Medien wahrgenommen werden möchte, muss sich in der Online-Umgebung selbst präsentieren, denn erst dadurch wird man für andere Nutzer innen überhaupt sichtbar. Der Terminus „Selbstpräsentation“ löst im umgangssprachlichen Gebrauch oftmals negative Assoziationen aus, indem er im Sinne eines sich „In-den-Vordergrunddrängens“ verstanden wird. In Anbetracht der genannten Notwendigkeiten einer Form der Präsenzmeldung an andere Nutzer innen sollte Selbstpräsentation jedoch zunächst komplett wertfrei gesehen werden. Sie beschreibt jenen Prozess, bei dem eine Person ihre Existenz und Anwesenheit in einem bestimmten Onlinekontext ausdrückt. Identität muss im Internet von den Nutzer innen stets aktiv aufgebaut werden, anders als außerhalb des Internets, wo allein durch äußerliche Faktoren bereits gewisse Eindrücke der eigenen Person vermittelt werden. Die „Online-Identität“ kann sehr unmittelbar an die Offline-Identität, d. h. an die Identität, die eine Person im „real life“ vertritt, gekoppelt sein („extended reallife“-Hypothese, Back et al. 2010), aber auch durchaus unabhängig von dieser existieren. Wie eng die Verbindung von Online- und Offline-Identität ist, hängt – wie noch gezeigt wird – stark vom jeweiligen Nutzungskontext ab. Im Rahmen dieses Beitrages wird zunächst auf die Frage eingegangen, mit welchen traditionellen soziologischen Ansätzen die Identitätsentwicklung in sozialen Medien untersucht werden kann. Dass die Identitätskonstruktion längst nicht allein durch das Ausfüllen vorgefertigter Profile erledigt ist, sondern es eine Vielzahl verbaler und visueller, aber auch indirekter Wege der Identitätskonstruktion gibt (Zhao et al. 2008), wird anschließend gezeigt. Es wird zudem diskutiert, was Menschen eigentlich dazu bringt, sich in sozialen Medien tatsächlich detailliert und vielfältig selbst zu präsentieren und kontinuierlich aktive Identitätsarbeit zu leisten. Abschließend werden Potenziale aber auch Risiken der Identitätskonstruktion in sozialen Medien erörtert. 2 Identitätskonstruktion als Entwicklungsaufgabe Die Ausbildung einer eigenen Identität gehört nicht nur bei Kindern und Heranwachsenden zu einer zentralen Entwicklungsaufgabe des Lebens. Im Gegenteil, die Identitätsentwicklung stellt einen kontinuierlich fortlaufenden Prozess dar, der auch bei Erwachsenen nie als abgeschlossen betrachtet werden kann (Erikson 1973). Was aber ist Identität eigentlich? Ein Blick in die Literatur zeigt ein enormes Spektrum an teilweise sehr gegensätzlichen Definitionen. Je nach gewählter Perspektive werden jeweils andere Aspekte der Identität hervorgehoben. So wird etwa Identität aus soziologischer Sicht als „Besonderheit eines Individuums (in Bezug auf andere)“ Identitätsbildung in sozialen Medien 193 (Krappmann 2000, S. 9) definiert, womit hier die wichtige Bedeutung der Gesellschaft als Referenzgruppe für die Identitätskonstruktion Erwähnung findet. Aus psychologischer Sicht wird Identität definiert als „unmittelbare Wahrnehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der Zeit, und die damit verbundene Wahrnehmung, dass auch andere diese Gleichheit und Kontinuität erkennen“ (Erikson 1973, S. 18). Hier stehen deutlich stärker die Prozesse innerhalb des Individuums im Mittelpunkt. Aus lexikalischer Sicht wird Identität hingegen als „Echtheit einer Person oder Sache; völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird“ (Duden Online 2019, https://www.duden.de/rechtschreibung/Iden titaet. Zugegriffen am 01.07.2019) definiert. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Identität als Ausdruck besonderer Merkmale einer Person gesehen werden kann, die das Individuum einerseits von anderen Individuen unterscheidbar machen, andererseits aber durchaus auch eine Zuordnung des Individuums zu gewissen sozialen Gruppen ausdrücken (vgl. Buckingham 2008, S. 1–2). 3 „Virtuelle Identität“ als idealisierte Selbstdarstellung? Diese grundsätzlichen Merkmale von Identität treffen auch für die „virtuelle Identität“ zu. „Virtuelle Identität“ wird von Döring als „die Form, wie sich Menschen im Rahmen computervermittelter Kommunikation selbst präsentieren“ (Döring 2000, S. 65) bezeichnet. Auch in der Online-Umgebung liegt das Ziel darin, die besonderen Merkmale einer Person zum Ausdruck zu bringen, sich aber gleichzeitig auch mit gewissen kollektivierenden Eigenschaften zu präsentieren, d. h. die Gruppenzugehörigkeiten als Teil der eigenen Identität auszudrücken. Bei der Bewertung „virtueller Identitäten“ werden in der Literatur sehr gegensätzliche Thesen angeführt. Eine eher kritische Perspektive nimmt die sogenannte „Selbstmaskierungsthese“ ein, die davon ausgeht, dass virtuelle Identität als „Scheinidentität“ bzw. als Ausdruck einer „selbstidealisierenden Maskierung“ (Döring 2000, S. 66) anzusehen sei. „Virtuelle“ Identitäten würden „idealized selves“ (Manago et al. 2008, S. 451) darstellen und dadurch falsche Erwartungen wecken. Die entgegengesetzte positive Sichtweise stellt die „Selbsterkundungsthese“ (Döring 2000, S. 65) dar. Hier wird „virtuelle“ Identität als eine Möglichkeit gesehen, persönliche Identitätsfacetten auszutesten und damit das eigene Selbst besser kennenzulernen, ohne die unmittelbaren Konsequenzen oder Irritationen derartiger Identitätsexperimente im „real life“ erleben zu müssen (z. B. im Rahmen von „Gender Swapping“, Musfeld 1999; Lou et al. 2013). Empirische Studien bestätigen vor allem die „extended real-life hypothesis“ (Back et al. 2010). Sie zeigen, dass die Identitätskonstruktion v. a. in Profilen von sozialen Netzwerkplattformen meist stark in Anlehnung an die „real-life“-Identitäten erfolgt (Gosling et al. 2007; Back et al. 2010). Das Internet erfüllt dabei eine gewisse „Selbstvergewisserungs- und Selbststabilisierungs-Funktion“ (Misoch 2005, S. 8). Allgemein kann für soziale Medien festgehalten werden, dass auf jenen Plattformen, in denen die Vernetzung überwiegend mit bekannten Personen erfolgt (z. B. Facebook), die Identitätskonstruktion weniger für eine idealisierende Persönlichkeitsdarstellung verwendet wird als auf Plattformen, die verstärkt auch für die Interaktion mit vorher unbekannten Personen genutzt werden (z. B. Instagram). 194 4 B. Kneidinger-Müller Identitätstheorien im Kontext sozialer Medien Die Prozesse und Folgen individueller Identitätskonstruktion beschäftigen aufgrund ihrer Vielfältigkeit und Dynamik seit jeher unterschiedlichste Wissenschaftsdisziplinen. Im Rahmen dieses Kapitels werden soziologische Ansätze in den Mittelpunkt gerückt, da diese den interaktiven Prozessen in sozialen Medien am besten gerecht werden. Einer der wohl bekanntesten soziologischen Ansätze zur Untersuchung von Identitätskonzepten stammt von George Herbert Mead, der als Vertreter des symbolischen Interaktionismus bereits 1934 einen theoretischen Erklärungsversuch der Identitätsentwicklung eines Menschen vornahm. Laut Mead (1978) wird der Mensch erst durch die Kommunikation mit anderen zu einem „sozialen Wesen“. Die personale Identität eines Menschen entwickle sich in einem Zusammenspiel von „I“, im Sinne eines impulsiven Ichs, das stark von den eigenen Trieben geleitet wird, und dem „Me“, das ein reflektiertes Ich darstellt und die Erwartungen der „verallgemeinerten Anderen“ an die eigene Identität ausdrückt. Für die Ausbildung der Identität muss der Mensch immer seine eigenen Wünsche und Sichtweisen mit der Meinung der „verallgemeinerten Anderen“, d. h. der Gesellschaft, in Einklang bringen. Dieser Aspekt zeigt sich auch bei der Gestaltung von Profilen in sozialen Medien, indem Nutzer innen oftmals sehr genau überlegen, welche Reaktionen und Emotionen Veröffentlichungen bzw. Selbstbeschreibungen bei anderen Personen hervorrufen (Kneidinger 2012). Der Einfluss der Gesellschaft auf die Identitätsbildung steht auch bei den Ansätzen von Goffman (1969) im Zentrum. Besonders hervorzuheben ist dabei Goffmans Bühnenmetapher (1969), derzufolge die Identitätsdarstellung jeweils davon abhängt, in welcher Rolle sich eine Person befindet. Ähnlich wie ein/e Schauspieler in auf der Bühne zeigt ein Individuum in unterschiedlichen gesellschaftlichen Situationen bzw. mit unterschiedlichen Bezugspersonen jeweils andere Identitätsfacetten von sich selbst. So wird etwa im Kontakt mit Arbeitskontakten eher die professionelle Seite des eigenen Ichs ausgelebt, während im Privatbereich die familiäre oder freundschaftliche Seite gezeigt wird. Abgesehen von den „Auftritten auf der Bühne“ wird in Goffmans Konzept auch ein Bereich „hinter der Bühne“ berücksichtigt. Dies ist jener Bereich, in dem das „impression management“ weniger bewusst geschieht, d. h. in dem keine konkrete Rolle erfüllt wird. Interessant an Goffmans Konzept der Bühne ist auch seine Unterscheidung in „Schauspieler in“ und „Schauspielfigur“. Das Individuum sei auf der Bühne stets beides: Schauspieler in, indem es eine gewisse Rolle erfüllt und in dieser handelt, und Schauspielfigur, weil es von den Menschen im Publikum dabei beobachtet wird, und deren Reaktionen sein Verhalten beeinflussen können. Man denke an diesem Punkt etwa an die Auswirkungen von Applaus oder Buhrufen für das weitere Agieren eines Schauspielers oder einer Schauspielerin in seiner oder ihrer Rolle. Dieser Faktor des sozialen Feedbacks spielt auch in sozialen Medien eine zentrale Rolle. Das Kommentieren von Beiträgen, das Teilen oder auch der simple Klick auf den „Gefällt mir“-Button sind direkte Formen sozialen Feedbacks. Die Besonderheit solcher technisch vermittelten Rückmeldungen ist darin zu sehen, dass sie nicht nur für das Individuum selbst sichtbar sind, sondern von einer teilweise sehr großen Identitätsbildung in sozialen Medien 195 Menge anderer, enger, aber auch ferner Bezugspersonen gesehen werden können. Diese Formen sozialen Feedbacks beeinflussen somit nicht nur die Handlungen oder Sichtweisen des Individuums in seinen Rollen, sondern werden selbst zu integralen Bestandteilen der Identitätskonstruktion dieser Person in den sozialen Medien. Besonders deutlich wird der Faktor des gesellschaftlichen Einflusses auf die Identitätsentwicklung auch bei der „Social Identity Theory (SIT)“, die von Tajfel und Turner entwickelt wurde. Ausgehend von den „minimal group“-Experimenten aus den 1970er-Jahren (Tajfel et al. 1971), bei denen es darum ging, welche Rolle allein die rein kognitive Gruppenzugehörigkeit für die Bevorzugung der eigenen Gruppe spielen kann, zeigten Tajfel und Turner (1986) auf, in welchem Zusammenspiel personale und soziale Aspekte bei der Identitätskonstruktion stehen. Personale Identität wird demnach stets in Abhängigkeit von einer sozialen Identität gebildet, die sich etwa durch die Zugehörigkeit zu gewissen sozialen Gruppen ausdrückt. Umgekehrt wird die soziale Identität im Sinne einer Gruppenidentität immer erst dadurch gebildet, dass eine Vielzahl an Individuen mit ihrer jeweils personalen Identität den Charakter der Gruppe mitformt. Auch dieser Theorieansatz lässt sich direkt auf soziale Medien übertragen. In unterschiedlicher Form existieren dort ebenfalls soziale Formationen, denen sich Individuen für andere Personen sichtbar anschließen. Die Mitgliedschaften können dabei einerseits ein Zeichen für tatsächliche Mitgliedschaften in „realen“ Gruppen (z. B. Sportverein, NGO) sein und damit eine Aussage über Interessen oder Einstellungen des Individuums ausdrücken. Andererseits können Gruppen in sozialen Medien rein in der Online-Umgebung existierende Zusammenschlüsse sein, die oftmals allein durch den jeweiligen Gruppennamen eine eindeutige Aussage vermitteln. Die öffentlich artikulierte Mitgliedschaft wird in jedem Fall zu einem weiteren Baustein der Identitätsbildung innerhalb der sozialen Medien. Als vierter Ansatz, der im Zusammenhang mit Identitätskonstruktion von hoher Bedeutung ist, und auch in der Onlinewelt nichts an Relevanz eingebüßt hat, ist die Theorie des sozialen Vergleichs von Festinger (1954) zu nennen. Seine zentrale Prämisse ist, dass Identität immer im Vergleich zu anderen (Personen, Gruppen etc.) gebildet wird. Indem wir uns mit anderen vergleichen, nehmen wir individuelle Eigenschaften oftmals erst wahr. So stellt etwa eine Person erst durch das Beobachten anderer Menschen fest, ob die eigene Körpergröße als groß oder eher als klein einzuschätzen ist. Ähnlich verhält es sich mit nicht rein äußerlichen oder körperlichen Merkmalen, indem auch kognitive Fähigkeiten im Vergleich mit anderen auf einer Art innerer Skala eingeordnet werden und erst so eine besondere Qualität als Identitätsmerkmal erhalten. Der Prozess des sozialen Vergleichs zeigt sich auch in den sozialen Medien. Das Betrachten anderer Profile dient nicht nur der Informationssuche über einzelne Personen, sondern führt auch zu Vergleichsprozessen mit der eigenen Person. Im besten Fall bedingt dies eine positive oder neutrale Evaluation der eigenen Person, teilweise kann dies jedoch auch negative Emotionen hervorrufen (Krasnova et al. 2013; Lup et al. 2015; Tandoc et al. 2015; Vogel et al. 2015). Empirischen Ergebnissen zufolge kann die Nutzung von Facebook zu gesteigerter Unzufriedenheit und Neid führen, indem die Nutzer innen ihre eigene Lebenssituation mit den von anderen Nutzer innen in Facebook geteilten Beiträgen vergleichen. Da tendenziell 196 B. Kneidinger-Müller eher positive Nachrichten über die soziale Netzwerkplattform vermittelt werden, kann das Gefühl entstehen, dass die beobachtete Person deutlich weniger Probleme zu bewältigen hätte, erfolgreicher sei und ein insgesamt positiveres Leben führe, als man selbst (Krasnova et al. 2013). Der soziale Vergleich findet dabei oftmals als unwillkürlicher kognitiver und emotionaler Prozess statt, d. h. die Profile anderer Nutzer innen werden nicht gezielt betrachtet, um sich selbst mit der jeweiligen Person vergleichen zu können, sondern dieser Prozess findet häufig unbewusst statt. Als letzter Theorieansatz, mittels dessen Identitätskonstruktion aus einer soziologischen Perspektive beleuchtet wird, ist abschließend das Konzept des „sozialen Kapitals“ von Bourdieu (1983) zu nennen. Es drückt die Quantität und auch Qualität von sozialen Beziehungen aus, auf die eine Person zurückgreifen kann, beschreibt dabei gleichzeitig aber auch einen bestimmten Aspekt der Identität einer Person. So werden etwa die Sozialkontakte eines Menschen oftmals als Indikatoren für die Soziabilität dieser Person interpretiert. Sozialkapital drückt sich auch in sozialen Medien aus. So werden innerhalb vieler sozialer Netzwerkplattformen für jede Person die Anzahl ihrer „Freunde“ oder Follower im Profil angeführt. Allein schon auf rein gestaltungstechnischer Ebene wird damit der Aspekt des Sozialkapitals zu einem integralen Bestandteil des Onlineprofils. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch Unterschiede zwischen sozialen Netzwerkplattformen in Hinblick auf Art der Beziehungsnetzwerke. Während bei Facebook die Vernetzungen zwischen „befreundeten“ Nutzer innen reziprok sind, d. h. sobald eine Person die Freundschaftsanfrage der anderen Person annimmt, sind beide Individuen miteinander vernetzt, sind die Follower-Beziehungen in Instagram oder Twitter nur einseitig gerichtet, d. h. eine Person folgt einer anderer Person, die dieser Person aber nicht automatisch auch folgen muss (Lup et al. 2015). Dies wirkt sich auch auf den Aufbau und die Art des Sozialkapitals innerhalb der Sozialen Medien aus. Beziehungsmanagement und Identitätskonstruktion gehen somit oft eng miteinander einher. Die Studie von Walther et al. (2008) hat gezeigt, dass von den Eigenschaften, die gewissen Personen aus der Freundesliste zugewiesen werden, auf die Eigenschaften des jeweiligen Profilinhabers geschlossen wird. Die sozialen Kontakte werden somit einerseits rein quantitativ in ihrer Anzahl, andererseits auch qualitativ interpretiert, zu einem Bestandteil der Identität von Social-MediaNutzer innen. Gemeinsam ist den vorgestellten fünf Theorien, dass sie Identitätskonstruktion stets in einen sozialen Prozess bzw. Kontext eingegliedert sehen. Das Individuum wird in seiner Identitätskonstruktion durch eine Vielzahl sozialer Faktoren beeinflusst. Dies können allgemeine soziale Normen sein, die sich etwa durch das (erwartete) Feedback anderer Personen äußern, ebenso wie soziale Rollen, die beeinflussen, welche Identitätsaspekte eine Person von sich in der jeweiligen Situation offenbart. Identitätskonstruktion geschieht somit immer in Gesellschaft und wird durch diese mehr oder weniger stark geformt. Dieses Faktum ist auch auf die Identitätskonstruktion in sozialen Medien übertragbar. Jedoch muss dabei die Besonderheit beachtet werden, dass die technischen Möglichkeiten der computervermittelten Interaktion vollkommen neue Kommunikationsräume schaffen, in denen die unmittelbare Ko-Präsenz der Interaktionspartner nicht mehr notwendig ist. Die soziale Komponente der Identitätskonstruktion wird somit nicht mehr Identitätsbildung in sozialen Medien 197 durch direkt anwesende Personen repräsentiert, sondern auch durch virtuell präsente Personen. Allein diese technischen Möglichkeiten führen trotz räumlicher Abwesenheit direkter Interaktionspartner zu neuen Formen der Selbstdarstellung des Individuums und des sozialen Feedbacks auf dieselbe. Da die genannten Theorien jedoch von einer direkten Face-to-Face-Interaktion des Individuums mit der sozialen Umgebung ausgehen, sind in diesem Punkt gewisse Modifikationen bei der Verwendung der Theorien notwendig. Werden die Besonderheiten der neuen Kommunikationsräume in sozialen Medien bei der Verwendung traditioneller Identitätstheorien berücksichtigt, so bieten diese nach wie vor eine wichtige Grundlage für die Analyse von Selbstdarstellungspraktiken in sozialen Medien. 5 Identität als Phänomen mit vielen Facetten Identität besteht seit jeher aus vielen Identitätsteilen bzw. -facetten, die je nach Situation, Interaktionspartner oder auch Zielsetzung in unterschiedlicher Form aktiviert werden. So wies etwa bereits Simmel in seinem „Exkurs über den Fremden“ (1908) darauf hin, dass sich die Identität eines Menschen immer durch die Differenzierung der eigenen Person zu anderen „fremden“ Personen ausbildet. Die Ausformungen von Identität hängen zudem mit den Rollen zusammen, die eine Person in den jeweiligen Handlungssituationen innehat, was ausführlich in der Rollentheorie behandelt wird. Als ein Vertreter dieser theoretischen Strömung zeigt Dahrendorf in seinem Werk Homo Sociologicus (Dahrendorf 1958/2006), inwiefern die Rollenerwartungen mitbeeinflussen, wie sich eine Person in der Gesellschaft präsentiert. Dementsprechend führen unterschiedliche Kontexte und Interaktionspartner auch zu unterschiedlichen Darstellungen der eigenen Identität. Nicht zu unrecht ist daher die Rede vom „Patchwork-Charakter“ der Identität, der sich in vielen alltäglichen Situationen meist vollkommen unbewusst äußert. Während etwa im beruflichen Kontext ganz andere Aspekte der eigenen Identität aktiviert und in der Interaktion mit entsprechenden Kontakten ausgelebt werden, sind dies im privaten Kontext oftmals deutlich abweichende Facetten der eigenen Identität (vgl. Goffman 1969). Diese bewusste, aber auch unbewusste Aktivierung bestimmter Identitätsteile kann durchaus eine gewisse Herausforderung darstellen. Vor allem in Situationen, in denen Interaktionspartner gemeinsam auftreten, die ansonsten nur in voneinander getrennten Kontexten auftreten, stellt das Identitätsmanagement nicht immer eine einfache Aufgabe für das Individuum dar. Diese Problematik wird auch im Bereich sozialer Medien immer wieder deutlich. Döring spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten „Nutzungskontexten“ (Döring 2000), die beeinflussen, welche Identitätsfacetten aktiviert werden. Präsentiert sich eine Person innerhalb der sozialen Medien einer Reihe von Personen, mit der sie im Offline-Kontext in sehr unterschiedlicher Beziehung steht, mit ein- und demselben Profil, dann kann es zu einem „context collapse“ (Ellison und Boyd 2013) kommen. Dies impliziert eine Reihe von möglichen Irritationen, die dadurch entstehen, dass plötzlich Identitätsfacetten auch in Interaktionsgruppen präsentiert werden, in denen diese ansonsten eher ausgespart bzw. nicht aktiviert werden (DiMicco und Millen 2008). Zusätzlich intensiviert wird diese Problematik des 198 B. Kneidinger-Müller Rollenmanagements in Sozialen Medien auch dadurch, dass oftmals gar nicht mehr klar ist, wer überhaupt die Inhalte eines Profils sehen kann, weshalb Boyd (2014) von „invisible audience“ schreibt. Duffy und Chan (2019) beschäftigen sich daher auch mit der Frage, inwiefern diese „vorgestellte Beobachtung“ („imagined surveillance“) durch unterschiedliche soziale Akteure in sozialen Medien die Selbstdarstellung der Nutzer innen beeinflusst. Während die Praxis des „Ein Profil für alle“ zu Beginn der Etablierung sozialer Medien noch als Standard anzusehen war, bieten mittlerweile viele sozialen Netzwerkplattformen auch auf technischer Ebene Optionen zu einem gezielteren Rollenmanagement an. Inhalte der Profile können somit vom einzelnen Nutzer innen gezielt nur ausgewählten Gruppen ihrer Netzwerkkontakte zugänglich zu machen. Erfolgte dies anfangs nur auf der Ebene einer allgemeinen Beschränkung der Einsehbarkeit des eigenen Profils, ist mittlerweile meist eine punktuelle Anpassung jedes einzelnen Eintrags möglich. Dies erweitert einerseits die Möglichkeiten der Identitätskontrolle, indem von jeder/m Nutzer in gezielt gesteuert werden kann, welche Informationen für welche Personen sichtbar sind. Andererseits stellt es auch große Anforderungen an die Reflexionsfähigkeit in Bezug auf das Identitätsmanagement. Mehr denn je bedarf es nun (vorab) einer gezielten Überlegung, welchen Personenkreisen ein Foto oder ein Posting zugänglich gemacht werden soll, oder umgekehrt, welche Informationen welchen Personen besser vorenthalten werden sollten. Zudem zeigt sich, dass die Nutzer innen beginnen, unterschiedliche OnlineIdentitäten auf unterschiedlichen sozialen Medien zu konstruieren oder unterschiedliche Plattformen für die Kontaktpflege zu unterschiedlichen Personengruppen zu nutzen (van Dijck 2013; Boyd 2014; Duffy Brooke 2017; Duffy und Chan 2019). Berufliche Kontakte werden dabei etwa ausschließlich über soziale Netzwerkplattformen wie LinkedIn oder Xing gepflegt und dementsprechend wird dort auch eine primär professionsorientierte Identität präsentiert. Umgekehrt dienen Facebook oder Instagram eher der Pflege privater Kontakte, denen man sich wiederum mit anderen Identitätsfacetten präsentiert (vgl. Gershon 2017). Neben einem gewissen technischen Know-how in der Nutzung der jeweiligen Social-Media-Angebote bedarf es somit auch eines ausgeprägten sozialen Wissens, mittels dessen eingeschätzt wird, welche Identitätsfacetten in welcher Situation und in welchem Interaktionskreis angemessen, positiv oder auch negativ sein können. Dieser Prozess deckt sich mit Giddens’ Thesen zur „Identität als reflexives Projekt“ (Giddens 1991). Er wies in Form von zehn Thesen darauf hin, dass Identitätskonstruktion stets ein dynamischer und v. a. reflexiver Prozess ist, indem eben auch mitbedacht wird, welche Konsequenzen gewisse Ausdrucksweisen der eigenen Identität haben könnten. Genau diese aktive Gestaltung und damit auch einer zeitweisen Beschränkung der eigenen Identitätsdarstellung gehört zum Alltag der meisten Nutzer innen sozialer Medien dazu (Lincoln und Robards 2017). „Wie bin ich?“, „Wie möchte ich sein?“, „Wie sehen mich die anderen?“ sind daher drei Fragestellungen, die viele Profilbesitzer innen in sozialen Medien bewusst, aber auch unbewusst beschäftigen. Identitätsbildung in sozialen Medien 6 199 Ausdrucksformen der Identität in sozialen Medien Aktive Selbstdarstellung im Internet begann technologisch gesehen schon lange vor Netzwerkplattformen wie Facebook oder Mikroblogging-Diensten wie Twitter, etwa auf privaten Homepages (Chandler und Roberts-Young 2000; Vazire und Gosling 2004) oder auch im Rahmen der Chatkommunikation (z. B. bei Gebhardt 2001; Misoch 2005). Die Selbstdarstellung endet bei sozialen Medien meist auch lange noch nicht beim Ausfüllen des Profils oder Anlegen eines Weblogs, die Siles (2012) als „technologies of the self“ bezeichnet. Vielmehr beginnt erst mit dem Einstieg und den ersten Nutzungsversuchen der jeweiligen Plattform das Bewusstsein zu wachsen, dass innerhalb dieser Anwendungen eine Vielzahl an verbalen, visuellen und auch auditiven Möglichkeiten zur Verfügung steht, mittels derer die eigene Person unterschiedlich detailliert einem mehr oder weniger eingrenzbaren Personenkreis präsentiert werden kann (Zhao et al. 2008, S. 1824). Wie detailliert diese Selbstdarstellung in den sozialen Medien tatsächlich geschieht, hängt neben gewissen individuellen Persönlichkeitsmerkmalen (z. B. Narzismus, Selbstvertrauen etc, Buffardi und Campbell 2008; Mehdizadeh 2010; Ong et al. 2011) auch von der Art der jeweiligen Plattform (Le et al. 2010) sowie den konkreten Nutzungsintentionen der Anwender innen (Schwämmlein und Wodzicki 2012; Rosenberg und Egbert 2011) ab. Beachtenswert ist dabei, dass die Identitätskonstruktion keineswegs nur aktiv durch den oder die Nutzer in selbst geschieht, sondern gleichzeitig auch immer zu einem gewissen Grad durch die Interaktionen mit und durch die Kommentare von anderen Nutzer innen mitgestaltet wird. In welchen Formen also äußert sich die „virtuelle“ Identität in sozialen Medien? 6.1 Verbale Formen der Identitätskonstruktion in sozialen Medien Der erste Schritt, um seine Präsenz in sozialen Medien zum Ausdruck zu bringen, erfolgt nahezu immer auf verbaler Ebene. Dies ist zum Großteil schon rein technisch bedingt, da die meisten sozialen Medien vor der Nutzung eine Anmeldung und damit das Ausfüllen eines (zumindest rudimentären) Persönlichkeitsprofils verlangen. Diese Profile fallen je nach Anwendung und je nach Intention des/der Nutzer in sehr informationsarm oder aber auch durchaus reich an privaten Informationen aus. Als Grundform gilt jedoch bei nahezu allen Anwendungen, dass sich die Person mit einem Namen (englisch auch als „nickname“ oder kurz „nick“ bezeichnet) sowie einer E-Mail-Adresse registriert. Während Letztere anderen Nutzer innen meist verborgen bleibt, wird der (Nick-)Name häufig zur ersten verbalen Repräsentation der Person (Whitty 2008; Whitty und Buchannan 2010). Nutzer innen haben bei der Auswahl des namentlichen Auftritts durchaus großen Spielraum; sie können sowohl mittels Klarnamen einen direkten Bezug zu ihrer tatsächlichen Identität herstellen als auch bei Verwendung eines Pseudonyms, das ein Spitzname oder auch Fantasiename sein kann, eine weitere implizite Botschaft darüber vermitteln, wie sie sich selbst 200 B. Kneidinger-Müller sehen (Stommel 2008; Gatson 2011). Untersuchungen zeigen, dass Nicknames in den meisten Fällen sehr eindeutig auf das Geschlecht der dahinterstehenden Person schließen lassen (Gatson 2011, S. 228). Darüber hinaus fungieren oftmals die Nicknames als Ausdruck gewisser Identifikationen des Nutzers oder der Nutzerin mit anderen Personen (Sportler in, Schauspieler in etc.) oder Themen (BecharIsraeli 1996; Misoch 2005, S. 18). In Profilen, die mehr als nur den (Nick-)Namen enthalten, stellt jedes zusätzliche schriftliche Posting, jeder Tweet und jeder Kommentar einen weiteren verbalen Bestandteil der Online-Identität dar. Die Persönlichkeitsinformationen können dabei sehr explizit sein, in Form einer Beschreibung der eigenen Person, oder auch implizit vermittelt werden, indem die Veröffentlichungen indirekte Hinweise auf Interessen, Aufenthaltsorte, Aktivitäten und ähnliche Daten der Person geben. Neben den Inhalten, die in den Profilen ausgefüllt bzw. die bei Aktivitäten innerhalb der sozialen Medien veröffentlicht werden, lässt auf verbaler Ebene auch noch der Schreibstil bzw. die Schreibgeschwindigkeit gewisse Rückschlüsse auf die Person zu (Walther und Burgoon 1992, S. 67). 6.2 Audio-visuelle Formen der Identitätskonstruktion in sozialen Medien Die verbale Ebene bietet zweifelsohne sehr vielfältige Möglichkeiten, anderen Nutzer innen eine Menge an Informationen über die eigene Person zu vermitteln. Es zeigt sich jedoch zunehmend der Trend, dass (audio-)visuelle Kommunikationsformen zur schnelleren und kompakteren Vermittlung persönlicher Informationen an Bedeutung gewinnen. Die Möglichkeiten derartiger Darstellungsweisen sind vielfältig, wie die Aufstellung von Reißmann (2014, S. 90) eindrucksvoll zeigt. Vor allem sogenannte Selfies, also Fotos, welche die abgebildete Person von sich selbst macht, repräsentieren eindrucksvoll eine besondere Art der visuellen Selbstdarstellung (Lasén 2012; Rettberg 2014), weshalb Murray Selfies auch als „one of the most effective outlets for self-definition“ (Murray 2015, S. 490) bezeichnet. Eine erste Visualisierung der Identitätsdarstellung erfolgt häufig durch das ausgewählte Profilbild innerhalb eines sozialen Mediums. Dieses Bild erhält besonders große Bedeutung, weil es bei (fast) allen Aktivitäten eines Nutzers oder einer Nutzerin zusammen mit dem (Nick-)Namen angezeigt wird. Es stellt somit für die Interaktion mit anderen Nutzer innen die zentrale visuelle Repräsentation eines Menschen dar, die deutlich mehr implizite Informationen vermittelt, als dies rein durch den (Nick-)Name möglich ist (Astheimer et al. 2011). Die hohe Bedeutung des Profilbildes ist auch den Nutzer innen selbst bewusst. Eine Reihe von Studien weist hoch aktive Selektionsprozesse der Nutzer innen bei der Auswahl bzw. auch bei der Gestaltung dieses Bildes nach (Krämer und Winter 2008; Raacke und Bonds-Raacke 2008). Vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, bei denen die visuelle Darstellung auf sozialen Netzwerkplattformen neben verbalen Ausdrucksformen eine besonders wichtige Rolle spielt, wird dem Profilbild auch zugleich eine gewisse Aussagekraft über die eigene Person attestiert Identitätsbildung in sozialen Medien 201 (Autenrieth 2011; Reißmann 2014, S. 91). Zum Teil gerät dabei der Aspekt, auf dem Foto tatsächlich auch erkannt zu werden, zur Nebensache. Vielmehr stellt die Möglichkeit des Nicht-Erkanntwerdens oft ebenso eine Aussage dar wie die bewusste Verwendung von Bildern, die andere Personen wie etwa Sportler innen oder Stars zeigen. Auch die Präsentation der eigenen Person in Gesellschaft einer oder mehrerer anderer Personen lässt sich auf Profilbildern beobachten. Auf diese Weise sollen oftmals soziale Bindungen als integraler Bestandteil der eigenen Person ausgedrückt werden. Das gemeinsame Bildnis wird als Symbol der Zusammengehörigkeit gesehen (Strano 2008). Verschiedene Studien haben Geschlechterunterschiede bei der visuellen Selbstdarstellung vor allem bei der jüngeren Generation nachgewiesen (Siibak 2009, 2010; Kapidzic und Herring 2011, 2015). Junge Frauen zeigen sich etwa auf Bildern auf sozialen Netzwerkplattformen häufig in freundlicher, lächelnder Pose, sie sehen dabei direkt in die Kamera und oftmals wird eine Obersichtperspektive gewählt, d. h. eine Kameraposition, die die Person von oben herab abbildet. Die jungen Männer zeigen sich auf ihren Profilbildern tendenziell eher mit ernster bzw. ausdrucksloser Miene und blicken vergleichsweise selten direkt in die Kamera. Während männliche Nutzer innen mit ihren Profilbildern häufig einen gewissen Ausdruck von Stärke und Coolness vermitteln wollen, scheint bei den jungen Frauen vor allem eine gewisse Körperlichkeit, Unschuld und Ungefährlichkeit signalisiert zu werden. Es kann dabei durchaus problematisiert werden, dass stereotype Geschlechterbilder von den Nutzer innen sozialer Medien bei ihrer Identitätskonstruktion nachweislich stärker aktualisiert werden, als dies bei massenmedialen Abbildungen der Fall ist (Mascheroni et al. 2015). Aber auch kulturelle Unterschiede konnten in Studien nachgewiesen werden (Zhao und Jiang 2011). Neben dem Profilbild nehmen Fotos und Bilder allgemein eine immer dominantere Rolle in der Online-Identitätskonstruktion ein. Die gerade bei Jugendlichen aktuell sehr beliebte soziale Plattform Instagram basiert sogar größtenteils auf dem kollektiven Teilen (audio-)visueller Inhalte. Während auf sozialen Netzwerkplattformen wie Facebook Fotos oftmals nur mit ausgewählten Personen oder Gruppen geteilt werden, lebt Instagram vor allem auch vom öffentlichen Teilen von Fotos, die durch selbst-bestimmte Hashtags öffentlich durchsuchbar und sichtbar werden. Mittels Fotos können eigene Interessen, Erlebnisse, Ereignisse, aber auch Einstellungen oftmals ohne weitere Kommentare ausgedrückt werden (vgl. Taddicken und Schmidt in diesem Band). Untersuchungen zeigen, dass persönliche Fotos auch eine wichtige Funktion erfüllen, um soziale Beziehungen zu pflegen oder gar erst aufzubauen (van Dijck 2008, S. 59; Mynatt et al. 2001). Vor allem bei geografischer Distanz spielt das persönliche Bildmaterial oftmals eine wichtige Rolle, um den Interaktionspartner innen ein Gefühl der gegenseitigen Partizipation am Leben der oder des jeweils anderen zu ermöglichen (Go et al. 2000). Instagram beweist zudem sehr eindrucksvoll, wie sich rein basierend auf Fotos und Bildern soziale Beziehungen auch zwischen vormals einander unbekannten Personen aufbauen können. Die fortschreitenden technischen Möglichkeiten zur Integration von Videos in sozialen Medien erweitern die zunehmende Dominanz visueller Identitätsbausteine im Internet. Der zusätzlich zur visuellen Komponente vorhandene auditive Moment 202 B. Kneidinger-Müller intensiviert das Gefühl des Dabeiseins und erhöht die Aufmerksamkeit. Handlungen oder Emotionen werden nun nicht mehr nur sichtbar, sondern auch hörbar, wie etwa das Lachen einer Person. Auch die Sprache, typische Bewegungsmuster, tatsächliche Verhaltensweisen werden mittels Video in die Online-Umgebung integriert und somit ebenfalls zu einem weiteren Bestandteil der virtuellen Identität einer Person. Eine besondere Form der (audio-)visuellen Identitätskonstruktion lässt sich im Zusammenhang mit den sogenannten „Influencern“ beobachten, also jenen Personen, die sich durch gezielte Selbstdarstellung in Sozialen Medien zu einer Art Eigenmarke machen und in der Folge eine gewisse Vorbildfunktion für ihre Fans und Follower einnehmen können (Rasmussen 2018). Die Influencer formen ihre Identität durch ein gezieltes Selbst-Branding zu einer Art Marke, die in der Folge auch für ökonomische Ziele eingesetzt wird (Khamis et al. 2016). Dadurch entsteht der Eindruck, dass jeder durch eine gezielte Selbstdarstellung in den sozialen Medien Berühmtheit, Reichtum und Online-Ruhm erzielen könne (Khamis et al. 2016, S. 4; Marwick 2015). Diese Entwicklung wird durchaus kritisch beobachtet, etwa wenn MacDonald (2014) soziale Medien zumindest mitverantwortlich für eine zunehmend narzistisch veranlagte Gesellschaft sieht und Marshall (2016, S. 235) von einer „ubiquity of the exposed self“ schreibt, durch die nicht mehr nur Prominente sondern jedes Individuum zunehmen erwartet, von anderen beobachtet zu werden und umgekehrt auch bereit ist, private Teile des Selbst bekannten und unbekannten Beobachtern zu präsentieren (Gamson 2011, S. 1068). Gamson konstatiert gar: „perhaps the unwatched life ist invalid or insufficient“ (2011, S. 1068). Weitere (audio-)visuelle Selbstdarstellungsformen sind Avatare, d. h. virtuelle Kunstfiguren im Cyberspace (vgl. Duden Online 2019, https://www.duden.de/recht schreibung/Avatar. Zugegriffen am 01.07.2019) als visuelle Repräsentationen von InternetNutzer innenn. Diese Avatare haben dabei oftmals äußerlich gesehen keinerlei Bezug zur jeweiligen Person. Sie übernehmen aber z. B. in Chatforen oder bei Online-Multi-Player-Spielen eine wichtige Rolle der Verbildlichung der Gesprächsbzw. Spielpartner innen (Geser 2007). Auch hier erfolgt die Auswahl bzw. Gestaltung der Avatare oftmals nicht willkürlich, sondern mit gewissen gestalterischen Intentionen der jeweiligen Nutzer innen (Nakamura 2009; Pearce und Artemesia 2009). Auch das Veröffentlichen oder Teilen von Musikfiles bzw. Musikvideos stellt v. a. für Jugendliche einen weiteren Aspekt ihrer Identitätskonstruktion in sozialen Medien dar, da gewisse Musikrichtungen oder Musiker und Bands eine wichtige Rolle für die eigene Person spielen können (Livingstone 2008; Wagner et al. 2009). 6.3 Systemgenerierte Identitätskonstruktion und Identitätskonstruktion durch Dritte Abgesehen von diesen Formen der bewussten und eigenständigen Identitätsgestaltung der jeweiligen Nutzer innen von sozialen Medien wird Identität auch von Dritten (d. h. anderen Nutzer innen) und dem System (d. h. dem jeweiligen sozialen Medium) mitgestaltet (Ellison und Boyd 2013). So fügen andere Nutzer innen durch Identitätsbildung in sozialen Medien 203 ihre Aktivitäten, Kommentare und sonstigen Reaktionen wichtige Zusatzinformationen zur Selbstpräsentation einer Person hinzu, wie etwa durch den Klick auf den „Gefällt mir“-Button oder das Re-Tweeten eines Beitrages. Dieser Mehrwert der Information kann einerseits in der inhaltlichen Komponente eines Kommentares gesehen werden, der zusätzliche Hinweise auf gewisse Eigenschaften, Interessen und Einstellungen der Profilinhaber innen liefert. Andererseits kann der Informationszuwachs auch auf der sozialen Ebene angesiedelt sein, indem etwa eine gewisse Gruppenzugehörigkeit einer Person zum Ausdruck kommt bzw. teilweise auch von Profilbeobachter innen von den Eigenschaften der „Freunde“ auf die Eigenschaften des Profilinhabers geschlossen wird (Walther et al. 2008). Systembasierte Identitätsfacetten werden automatisch bei der Nutzung einer Plattform generiert, wie beispielsweise Hinweise auf den konkreten Zeitpunkt einer Veröffentlichung, die Aufschluss darüber geben, zu welchen Zeiten und in welchem Ausmaß eine Person auf der jeweiligen Netzwerkplattform aktiv ist. 7 Potenziale und Risiken der Identitätsbildung in sozialen Medien Abschließend stellt sich die Frage, wie all diese Entwicklungen im Bereich der Identitätskonstruktion in sozialen Medien einzuschätzen sind. Welche Potenziale, aber auch welche Risiken sind damit verbunden, dass sich immer mehr Menschen in sozialen Medien selbst präsentieren? Die Meinungen dazu gehen nicht nur in der öffentlichen Diskussion, sondern auch in der Forschung deutlich auseinander. In der öffentlichen Diskussion wird v. a. das Thema Datenschutz sowie der Schutz der Privatsphäre kritisch thematisiert. Durch die Selbstdarstellung in sozialen Medien werden zwangsläufig persönliche Daten im Internet preisgegeben, die in der Folge auch einer möglichen missbräuchlichen Verwendung zugänglich gemacht werden. Gerade in sozialen Medien, deren zentrales wirtschaftliches „Gut“ die Daten ihrer Nutzer innen sind, ist oftmals nur wenig transparent, was mit den persönlichen Daten tatsächlich geschieht. Vor allem die zunehmende Vernetzung von OnlineDiensten und die sich daraus ergebende Vielfalt an persönlichen Datenspuren von Nutzer innen, die zusammengesetzt dem Eindruck eines „gläsernen Menschen“ durchaus nahe kommen, sind als eine Herausforderung für die digitale Netzwerkgesellschaft zu sehen. Derartige personenbezogene Daten können nicht nur für personalisierte Werbung sondern auch von anderen Nutzer innen für kriminelle Aktivitäten genutzt werden. Identitätsdiebstahl, d. h. die Übernahme einer Online-Identität durch eine andere Person, sind dabei ebenso zu nennen wie gezielte Angriffe auf die Online-Identität im Sinne von Bloßstellungen oder anderen Formen des CyberMobbings, bei denen das Ziel verfolgt wird, das Image bzw. den Ruf einer Person gezielt zu beschädigen (Campbell 2005; Cassidy et al. 2009; Sontag et al. 2011). Derartige Risiken sind mittlerweile vielen Nutzer innen durchaus bekannt – das führt zu Vermeidungsreaktionen und Selbstzensur, was wiederum ebenfalls problematisch gesehen werden muss: So kann etwa die Angst vor Anfeindungen oder abwertenden Kommentaren dazu führen, dass Nutzer innen sich in ihrer Selbstdar- 204 B. Kneidinger-Müller stellung bzw. in der Artikulation eigenen Ansichten und Erlebnisse ungewollt einschränken, was der demokratischen Prämisse des Internet widerspricht. Duffy und Chan (2019) identifizieren drei Strategien, die Nutzer innen sozialer Medien anwenden, um die vorgestellte Beobachtung („imagined surveillance“) ihrer Profile durch andere Akteure zu kontrollieren, nämlich 1) die bewusste Nutzung von Privatsphäre-Einstellungen und damit verbunden die intendierte Kontrolle des Publikums, 2) die bewusste Selbst-Beobachtung, um die Inhalte zu kontrollieren, und 3) die Verwendung von Pseudonymen als Profilnamen um die Verbindung zur eigenen Offline-Identität zu kontrollieren. Der gezielte Einsatz unterschiedlicher Strategien der reflektierten Selbstdarstellung weist darauf hin, dass trotz eines vorhandenen Bewusstseins möglicher problematischer Folgen der Online-Identitätspräsentation dennoch das Bedürfnis nach einer sichtbaren und aktiven Präsenz innerhalb sozialer Medien vorhanden ist. Trotz einer durchaus begründeten Sorge um die Privatsphäre zeigen somit viele Nutzer innen eine durchaus hohe Bereitschaft zur Selbstoffenbarung. Ein Phänomen, das unter dem Begriff des „privacy paradox“ (Barnes 2006; Taddicken 2014) analysiert und diskutiert wird. Die Erklärungen für diese widersprüchlichen Einstellungs- und Verhaltensweisen sind vielfältig. Häufig wird von einem mehr oder weniger gezielten Abwägen von Kosten und Nutzen der Veröffentlichung privater Informationen ausgegangen. Überwiegen die erlebten oder antizipierten Benefits resultierend aus der Selbstdarstellung in sozialen Medien die antizipierten Risiken in Hinblick auf die eigene Privatsphäre, so zeigen sich Nutzer innen trotz vorhandener Datenschutzbedenkens dennoch bereit, persönliche Daten in sozialen Medien zu veröffentlichen. Aber auch mangelnde Medienkompetenz und das illusorische Gefühl einer kompletten Selbstkontrolle aller veröffentlichter Daten (Trepte und Reinecke 2011, S. 62) oder auch eine allgemein erhöhte Bereitschaft zur Selbstoffenbarung sowie der Einfluss der Verhaltensweisen der Peers in Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre (Taddicken 2014) werden als Erklärungsfaktoren angeführt. Als weiteres Risiko muss angeführt werden, dass eine Gesellschaft, in der die Selbstdarstellung im Online-Bereich zum Alltag geworden ist, auch kritische Phänomene wie die zunehmende Ausprägung von Suchterscheinungen und dem in empirischen Studien nachgewiesenem Phänomen der sogenannten „Fear of Missing Out“ (FOMO, Przybylski et al. 2013) begünstigt. Die Angst bei längerer OnlineAbsenz wichtige Informationen zu verpassen oder von sozialen Kontakten nicht mehr wahrgenommen zu werden, verstärkt das Bedürfnis einer regelmäßigen und im Extremfall nahezu lückenlosen Online-Aktivität einzelner Nutzer innen. Dies kann Stress auslösen und gar zu suchtartigem Online-Nutzungsverhalten führen, bedingt durch das Bestreben einer möglichst lückenlosen Online-Präsenz in sozialen Medien (Andreassen et al. 2017; Blackwell et al. 2017; Oberst et al. 2017). Neben diesen eindeutig als potenzielle Risiken zu thematisierenden Aspekten lassen sich auch noch eine Reihe weiterer Merkmale der virtuellen Selbstdarstellung in sozialen Medien anführen, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben können. Zunächst ist in diesem Zusammenhang der soziale Vergleichsprozess zu nennen, der bei der Nutzung sozialer Medien nahezu zwangsläufig stattfindet. Diese bewussten aber auch unbewussten Vergleiche der eigenen Person mit anderen Identitätsbildung in sozialen Medien 205 Nutzer innen können nicht nur positive sondern auch vielfältige negative Effekte auf das Individuum haben (de Vries et al. 2017). Letztere treten v. a. bei einer überwiegend passiven Nutzung auf, bei der die Beobachtung der Aktivitäten anderer Nutzer innen im Vordergrund steht, weniger die eigene aktive Interaktion. Darüber hinaus begünstigt eine sehr exzessive Nutzung der sozialen Medien Neid-Gefühle und negative Emotionen (Tandoc et al. 2015; Vogel et al. 2015). Zu den Intensivnutzer innen sozialer Medien gehören häufig Personen, die dazu tendieren, sich selbst mit anderen zu vergleichen, und häufig auch Angst haben, etwas zu verpassen („fear of missing out“), wenn sie von ihren gewohnten Kommunikationskanälen abgeschnitten sind (Reer et al. 2019). Die exzessive Nutzung kombiniert mit Dispositionen für soziale Vergleichsprozesse und/oder für die Angst etwas zu verpassen, können das allgemeine Wohlbefinden des Individuums reduzieren (Verduyn et al. 2015, 2017; Satici und Uysal 2015; Kross et al. 2013) und zu Depressionen beitragen (Lin et al. 2016; Appel et al. 2016). Vergleiche, bei denen die eigene Person positiver wahrgenommen wird als die Vergleichsperson, können hingegen depressive Symptome reduzieren (Lup et al. 2015, S. 250). Positive Effekte des sozialen Vergleichs auf das Wohlbefinden eines Nutzers oder einer Nutzerin zeigen sich v. a. dann, wenn eine sehr aktive Nutzung sozialer Medien vorliegt, d. h. wenn das Individuum sehr aktiv Online-Identitätsarbeit betreibt. Verduyn et al. (2017) erklären dies vor allem durch den mit der aktiven Identitätsarbeit verbundenen Aufbau und Erhalt von Sozialkapital und das damit verbundene Gefühl der sozialen Verbundenheit. Gonzales und Hancock argumentieren zusätzlich, dass die Betrachtung des eigenen Facebook Profils zu einer Bewusstwerdung des eigenen Selbst beitragen kann, was wiederum das eigene Selbstbewusstsein der Nutzer innen erhöhen kann: „(. . .) selective self-presentation in digital media, which leads to intensified relationship formation, also influences impressions of the self“. Lup et al. (2015) identifizieren die Bedeutung der Anzahl fremder Personen, denen auf Instagram gefolgt wird, für die Auswirkungen sozialer Vergleichsprozesse auf das Wohlbefinden des Individuums. Im Vergleich zu Nutzer innen, die überwiegend bereits persönlich bekannten Personen folgen, führt eine intensivere Nutzung von Instagram bei jenen Nutzer innen, die eher fremden und nicht persönlich bekannten Personen folgen, zu verstärkten sozialen Vergleichsprozessen und in der Folge zu verstärkten depressiven Symptomen. Lup et al. (2015) erklären dies dadurch, dass beim Folgen von fremden Profilen häufiger Attributionsfehler entstehen, die zu einer verzerrt positiven Wahrnehmung der Leben anderer Nutzer innen führe. Dies begünstige wiederum einen negativen sozialen Vergleich, was zu Neid und negativen psychologischen Folgen führen könne. Umgekehrt werden Inhalte, die von bekannten Personen gepostet werden, anhand der Kenntnisse über das reale Leben der jeweiligen Person relativiert, was positive soziale Vergleichsprozesse erleichtere. Zudem könne die Freude über den Informationstausch von Freunden auch Gefühle sozialer Verbundenheit auslösen, was ebenfalls positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden hat (Lup et al. 2015). Lup et al. (2015) sehen daher auch bei sozialen Netzwerkplattformen wie Instagram, bei denen das Folgen von und damit auch der soziale Vergleich mit persönlich unbekannten Personen häufig der Fall ist, höhere Risiken für negative Auswirkungen auf den individuellen Nutzer 206 B. Kneidinger-Müller oder die individuelle Nutzerin, als bei Plattformen, auf denen Verbindungen zu überwiegend bereits bekannten Personen gepflegt werden (z. B. Facebook). Risiko und Chance in einem kann auch das Erleben sozialen Feedbacks auf die individuelle Selbstdarstellung in sozialen Medien sein. Ausgehend von einer positiven Sichtweise kann ein großes Potenzial der virtuellen Identitätskonstruktion in der Möglichkeit des Erprobens bisher eher verdeckt gehaltener Identitätsfacetten gesehen werden. Turkle (1995) spricht in diesem Zusammenhang von einer „emotional gefahrenlosen“ Identitätskonstruktion. Die emotionalen Reaktionen, die auf Identitätsfacetten folgen, die neu ausprobiert werden, sind in der Online-Umgebung meist deutlich geringer als im direkten Face-to-Face-Kontakt. Soziale Medien werden als Versuchsfläche für soziale Verhaltensweisen gesehen (Ellison et al. 2006). Kumru und Thompson (2003) sprechen von neuen Möglichkeiten des „Self Monitorings“, bei dem soziales Feedback durch andere Nutzer innen eine zentrale Rolle spielt. In sozialen Medien gehört das Äußern von derartigem Feedback zum Alltag und beginnt bei dem einfachen Klick auf den „Gefällt mir“-Button, um die positive Bewertung eines Postings, Bildes oder Links auszudrücken, und reicht bis hin zum Verfassen mehr oder weniger ausführlicher verbaler Kommentare. Die Nutzer innen bekommen dabei Rückmeldungen von einem teilweise deutlich erweiterten Personenkreis, als dies bei Face-to-Face-Interaktionen der Fall wäre (Manago et al. 2008; Siibak 2009; Valkenburg et al. 2006; Zhao et al. 2008). Dieses Feedback ist meist positiv. Problematisch ist es jedoch dann, wenn negative Kommentare und Reaktionen oder auch einfach nur Missachtung auftreten, die kognitive und emotionale Reaktionen bei den Profilinhaber innen auslösen (vgl. Kneidinger 2012). Ein große Chance der Identitätskonstruktion im Internet und damit auch in sozialen Medien kann auch darin gesehen werden, dass äußerliche Merkmale ebenso wie körperliche Beeinträchtigungen an Bedeutung verlieren können, weil diese den Interaktionspartner innen nicht direkt bzw. weniger bewusst sind. Dies kann dazu beitragen, dass Vorurteile und Stereotypisierungen abgebaut werden, da andere Faktoren bei der Interaktion mit der jeweiligen Person im Vordergrund stehen (Bowker und Tuffin 2006; Söderström 2009; Thoreau 2006). Gleichzeitig aber liefern empirische Studien Hinweise dafür, dass die Nutzer innen selbst bei ihrer Selbstdarstellung in sozialen Medien Stereotypisierungen aufgreifen und reproduzieren (Mascheroni et al. 2015). Zusammenfassend muss somit festgehalten werden, dass die Frage nach den Chancen und Risiken der Identitätskonstruktion in dozialen Medien weniger durch technische Komponenten der jeweiligen Plattformen bedingt ist, als vielmehr von der individuellen Art und Weise der Nutzung durch die einzelne Person bestimmt ist. 8 Fazit – Soziale Medien als Ich-Plattformen? Soziale Medien werden in der öffentlichen Diskussion häufig als Plattformen zur eigenen Selbstdarstellung bezeichnet. Diese Zuschreibung ist bis zu einem gewissen Grad berechtigt, wenn man von der Notwendigkeit einer Selbstpräsentation zur Nutzung derartiger Plattformen und Netzwerke ausgeht. Nur wer sich in den sozialen Identitätsbildung in sozialen Medien 207 Medien präsentiert, wird von anderen Nutzer innen überhaupt erst wahrgenommen. Abgesehen von dieser eher pragmatischen Bedeutung der Identitätskonstruktion in sozialen Medien erfüllt sie auch für die individuelle und soziale Entwicklung der Nutzer innen eine durchaus wichtige Rolle. Online- und Offline-Identitäten sind in sozialen Medien keine voneinander getrennten Aspekte, sondern verschmelzen immer mehr miteinander. Die Selbstpräsentation einer Person kann für manche Bezugspersonen in sozialen Medien ein deutlich differenzierteres Bild der Person vermitteln als der direkte Face-to-FaceKontakt. Aber auch umgekehrt wird die Identitätskonstruktion einer Person in der Online-Umgebung für sehr enge Bezugspersonen nur als ein kleiner Ausschnitt der Persönlichkeit dieser Person erscheinen, da bei engeren Beziehungsstrukturen mehr Informationen und genaueres Detailwissen über eine Person vorliegen, als dies rein durch die Identitätskonstruktion in sozialen Medien erfolgen kann. Soziale Medien können je nach Ausrichtung Identitätskonstruktion eher zu einer strategischen und stark reflektierten Aufgabe machen, oder aber auch eine Möglichkeit des spielerischen Erprobens von Identitätsfacetten eröffnen, die in sonstigen Kontexten eher verborgen bleiben. Um diese unterschiedlichen Möglichkeiten der sozialen Medien als Plattformen zur Erprobung der eigenen Identität tatsächlich nutzen zu können, werden die Anwender innen vor neue Herausforderungen der reflektierten Identitätskonstruktion gestellt. Anders als bei Face-to-Face-Interaktionen, bei denen allein aufgrund der visuellen Anwesenheit der übrigen Personen sehr schnell und klar eingeschätzt werden kann, welche Personenkreise im konkreten Augenblick die eigene Person beobachten und einschätzen können, fehlt dieses unmittelbare Bewusstsein bei Interaktionen in sozialen Medien. Die Herausforderung besteht vor allem darin, zu abstrahieren, welche Personen eine Veröffentlichung innerhalb des jeweiligen sozialen Mediums sehen können bzw. welche Personen dies sehen dürfen oder sollen und was mit den online hinterlassenen Identitätsspuren möglicherweise geschehen kann. Identitätskonstruktion geschieht somit mehr denn je vor dem Hintergrund einer sozialen Einbettung, die in sozialen Medien deutlich vielschichtiger, dynamischer und teilweise auch unübersichtlicher geworden ist, als dies bei der traditionellen Offline-Identität der Fall ist. Literatur Andreassen, Cecilie S., Ståle Pallesen, und Mark D. Griffiths. 2017. The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. Addictive Behaviors 64:287–293. Appel, Helmut, Alexander L. Gerlach, und Jan Crusius. 2016. The interplay between Facebook use, social comparison, envy, and depression. Current Opinion in Psychology 9:44–49. Astheimer, Jörg, Klaus Neumann-Braun, und Axel Schmidt. 2011. MyFace: Die Porträtfotografie im Social Web. In Freundschaft und Gemeinschaft im Social Web. Bildbezogenes Handeln und Peergroup-Kommunikation auf Facebook & Co, Hrsg. Klaus Neumann-Braun und Ulla Autenrieth, 79–122. Baden-Baden: Nomos. Autenrieth, Ulla P. 2011. MySelf. MyFriends. MyLife. MyWorld. Fotoalben auf Social Network Sites und ihre kommunikativen Funktionen für Jugendliche und junge Erwachsene. In Freundschaft und Gemeinschaft im Social Web. Bildbezogenes Handeln und Peergroup- 208 B. Kneidinger-Müller Kommunikation auf Facebook & Co, Hrsg. Klaus Neumann-Braun und Ulla Autenrieth, 123–162. Baden-Baden: Nomos. Back, Mitja B., Juliane M. Stopfer, Simine Vazire, Sam Gaddis, Stefan C. Schmukle, Boris Egloff, und Samuel D. Gosling. 2010. Facebook profiles reflect actual personality, Not self-idealization. Psychological Science 21(3): 372–374. Barnes, Susan B. 2006. A privacy paradox: Social networking in the United States. First Monday 11(9). http://www.firstmonday.org/issues/issue11_9/barnes/index.html. Zugegriffen am 04.09.2014. Bechar-Israeli, Haya. 1996. From < Bonehead > to < cLoNehEAd>: Nicknames, play, and identity on internet relay chat. Journal of Computer-Mediated Communication 1:2. Blackwell, David, Carrie Leaman, Rose Tramposch, Ciera Osborne, und Miriam Liss. 2017. Extraversion, neuroticism, attachment style and fear of missing out as predictors of social media use and addiction. Personality and Individual Differences 116:69–72. Bourdieu, Pierre. 1983. Ökonomisches Kapital – Kulturelles Kapital – Soziales Kapital. In Soziale Ungleichheiten, Hrsg. Reinhard Kreckel, 183–198. Göttingen: Schwartz. Bowker, Natilene, und Keith Tuffin. 2006. Dicing with deception: People with disabilities’ strategies for managing safety and identity online. Journal of Computer-Mediated Communication 8:2. Boyd, Danah. 2014. It's complicated: The social lives of networked teens. New Haven: Yale University Press. Buckingham, David. 2008. Introducing identity. In Youth, identity, and digital media. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on digital media and learning, Hrsg. David Buckingham, 1–24. Cambridge, MA: The MIT Press. Buffardi, Laura E., und Keith W. Campbell. 2008. Narcissism and social networking web sites. Personality and Social Psychology Bulletin 34:1303–1314. Campbell, Marilyn A. 2005. Cyber bullying: An old problem in a new guise? Australian Journal of Guidance and Counselling 15(1): 68–76. Cassidy, Wanda, Margaret Jackson, und Karen N. Brown. 2009. Sticks and bones can break my bones, but how can pixels hurt me?: Students’ experiences with cyber-bullying. School Psychology International 30:383–402. Chandler, Daniel, und Dilwyn Roberts-Young. 2000. The construction of identity in the personal homepages of adolescents. Welsh Journal of Education 9(1): 78–90. http://www.aber.ac.uk/ media/Documents/short/strasbourg.html. Zugegriffen am 29.01.2014. Dahrendorf, Ralf. 1958/2006. Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der sozialen Rolle. Wiesbaden: VS Verlag. Dijck, Jan van. 2013. ‚You have one identity‘: performing the self on Facebook and LinkedIn. Media, Culture & Society 35(2): 199–215. Dijck, José van . 2008. Digital photography: Communication, identity, memory. Visual Communication 7:57–76. DiMicco, Joan M., und David R. Millen. 2008. Identity management: Multiple presentations of self in Facebook. In Proceedings of GROUP’07, November 4–7, 2007, 383–386. Sanibel Island. Döring, Nicola. 2000. Identität + Internet = Virtuelle Identität? Forum Medienethik 2:65–75. Duffy Brooke, E. 2017. Not getting paid to do what you love: Gender, social media, and aspirational work. New Haven: Yale University Press. Duffy, Brooke E., und Ngai K. Chan. 2019. „You never really know who’s looking“: Imagined surveillance across social media platforms. New Media & Society 21(1): 119–138. Ellison, Nicola, und Danah Boyd. 2013. Sociality through social network sites. In The oxford handbook of internet studies, Hrsg. Willian H. Dutton, 151–172. Oxford: Oxford University Press/Pre-Press. http://www.danah.org/. . ./SocialityThruSNS-preprint.pdf. Zugegriffen am 01.09.2014. Ellison, Nicola, Charles Steinfield, und Cliff Lampe. 2006. Spatially bounded online social networks and social capital. The role of Facebook. Paper presented at the annual conference of International Communication Association ICA in Dresden. Erikson, Erik H. 1973. Identität und Lebenszyklus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Festinger, Leon. 1954. A theory of social comparison processes. Human Relations 7:117–140. Identitätsbildung in sozialen Medien 209 Gamson, Joshua. 2011. The unwatched life is not worth living: The elevation of the ordinary in celebrity culture. Theories and methodologies 126(4): 1061–1069. Gatson, Sarah N. 2011. Self-naming practices on the internet: Identity, authenticity, and community. Cultural Studies , Critical Methodology 11:224–235. Gebhardt, Julian. 2001. Inszenierung und Verortung von Identität in computervermittelter Kommunikation. Rahmenanalytische Überlegungen am Beispiel des „Online-Chat“. kommunikation@gesellschaft 2(7): 1–21. Gershon, Ilana. 2017. Down and out in the new economy: How people find (Or Don’t Find) work today. Chicago: The University of Chicago Press. Geser, Hans. 2007. Me, my self and my avatar. Some microsociological reflections on „Second Life“. In Sociology in Switzerland. Towards cybersociety and vireal social relations. Online Publikationen. http://www.socio.ch/intcom/t_hgeser17.pdf. Zugegriffen am 30.01.2014. Giddens, Anthony. 1991. Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press. Go, Ken, John Carroll, und Atsumi Imamiya. 2000. Familyware: Communicating with someone you love. In Home informatics and telematics. Information, technology, and society, Hrsg. Andy Sloane und Felix van Rijn, 125–140. Dorfrecht: Kluwer. Goffman, Erving. 1969. Wir alle spielen Theater. München: Piper. Gosling, Samuel D., Sam Gaddis, und und Simine Vazire. 2007. Personality impressions based on facebook profiles. In Proceedings of the ICWSM’2007, March, 26–28. Boulder. Kapidzic, Sanja, und Susan C. Herring. 2011. Gender, communication, and self-presentation in teen chatrooms revisited: Have patterns changed. Journal of Computer-Mediated Communication 17:39–59. Kapidzic, Sanja, und Susan C. Herring. 2015. Race, gender, and self-presentation in teen profile photographs. New Media & Society 17(6): 958–976. Khamis, Susie, Lawrence Ang, und Raymond Welling. 2016. Self-branding, ,micro-celebrity‘ and the rise of Social Media Influencers. Celebrity Studies. https://doi.org/10.1080/19392397.2016.1218292. Kneidinger, Bernadette. 2012. Sociability in social network sites. Facebook as trial platform for social behavioral patterns. In Networked sociability and individualism. Technology for personal and professional relationships, Hrsg. Francesca Comunello, 126–146. Hershey: IGI Global. Krämer, Nicole C., und Stephan Winter. 2008. Impression Management 2.0. The relatiopnship between self-esteem, extraversion, self-eficacy, and self-Presentation within social networking sites. Journal of Media Psychology 20:106–116. Krappmann, Lothar. 2000. Soziologische Dimensionen der Identität. Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen. Stuttgart: Klett-Cotta. Krasnova, Hanna, Helena Wenninger, Thomas Widjaja, und Peter Buxmann. 2013. Envy on Facebook: A hidden threat to users’ life satisfaction? In Proceeding of the 11th International conference on Wirtschaftsinformatik, February 27–March 1, 2013, Leipzig. Kross, Ethan, Philippe Verduyn, Emre Demiralp, Jiyoung Park, D Avid S. Lee, Natalie Lin, Holly Shablack, John Jonides, und Oscar Ybarra. 2013. Facebook use predicts declines in subjective well-being in young adults. PLoS One 8(8): 1–6. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0069841. Kumru, Asiye, und Ross A. Thompson. 2003. Ego identity status and self-monitoring behavior in adolescents. Journal of Adolescent Research 1:1–16. Lasén, A. 2012. Autofotos. subjetividades y medios sociales [Selfies: Subjectivities and social media]. In Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales. Prácticas emergentes en las artes, el campo editorial y la música [Young people, urban cultures and digital networks. Emerging practices in arts, editorial field and music], Hrsg. N. García-Canclini und F. und Cruces, 243–262. Madrid: Ariel. Le, Linda, Ivan Beschastnikh, und David W. McDonald. 2010. Self-presentation: Structured and semi-structured user profiles. In Proceedings of the CHI 2010, April 10–15, 2010, Atlanta. Lin, L. Y., J. E. Sidani, A. Shensa, A. Radovic, E. Miller, J. B. Colditz, B. L. Hoffman, L. M. Giles, und B. A. Primack. 2016. Association between social media use and depression among U.S. young adults. Depression and Anxiety 33:323–331. https://doi.org/10.1002/da.22466. 210 B. Kneidinger-Müller Lincoln, Sian, und Brady Robards. 2017. Editing the project of the self: sustained Facebook use and growing up online. Journal of Youth Studies 20(4): 518–531. Livingstone, Sonia. 2008. Taking risky opportunities in youthful content creation: teenagers’ use of social networking sites for intimacy, privacy, and self-expression. New Media & Society 10(3): 393–411. Lou, Jing-Kai, Kunwoo Park, Meeyoung Cha, Juyong Park, Chin-Laung Lei, und Kuan-Ta Chen. 2013. Gender swapping and user behaviors in online social games. In Proceedings of ACM WWW 2013, May 13–17, 2013, Rio de Janeiro. Lup, Katerina, Leora Trub, und Lisa Rosenthal. 2015. Instagram #Instasad?: Exploring Associations Among Instagram Use, Depressive Symptoms, Negative Social Comparison, and Strangers Followed. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 18(5). https://doi.org/10.1089/ cyber.2014.0560. MacDonald, Pat. 2014. Narcissism in the modern world. Psychodynamic Practice 20(2): 144–153. Manago, Adriana, Michael B. Graham, Patricia Greenfield, und Goldie Salimkhan. 2008. Selfpresentation and gender on MySpace. Journal of Applied Development Psychology 29:446–458. Marshall, David P. 2016. Exposure: The public self explore. In A companion to celebrity, Hrsg. David P. Marshall und Redmond Sean, 497–517. Chichester: Wiley. Marwick, Alice E. 2015. Instafame: Luxury selfies in the attention economy. Public Culture 27(75): 137–160. Mascheroni, Giovanna, Jane Vincent, und Estefanía Jimenez. 2015. „Girls are addicted to likes so they post semi-naked selfies“: Peer mediation, normativity and the construction of identity online. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 9(1), article 5. https://doi.org/10.5817/CP2015-1-5. Mead, Georg H. 1978. Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Mehdizadeh, Soraya. 2010. Self-presentation 2.0: Narcissism and self-esteem on Facebook. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking 13(4): 357–364. Misoch, Sabina. 2005. Abschlussbericht der Studie „Jugendliche und Medien. Eine qualitative Analyse der Nutzung Neuer Medien für jugendliche Identitätsbildung unter besonderer Berücksichtigung des Chat.“ Murray, Derek. 2015. Notes to self: The visual culture of selfies in the age of social media. Consumption Markets & Culture 18(6): 490–516. Musfeld, Tamara. 1999. Gender swapping in Cyberspace. Postmoderne Auflösung von Raum und Identität oder Inszenierung des Geschlechterverhältnisses mit anderen Mitteln? Psychologie und Gesellschaftskritik 1–2:9–27. Mynatt, Elizabeth, Jim Rowan, Annie Jacobs, und Sarah Craighill. 2001. Digital family portraits: Supporting peace of mind for extended family members. In Proceedings of the CHI 2001, 31.03.–05.04.2001, 3(1): 333–340. Nakamura, Lisa. 2009. Don’t hate the player, hate the game: The racialization of labor in the World of Warcraft. Critical Studies in Media Communication 26:128–144. Oberst, Ursula, Elisa Wegmann, Benjamin Stodt, Matthias Brand, und Andrés Chamarro. 2017. Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. Journal of Adolescence 55:51–60. Ong, Eileen Y. L., Rebecca P. Ang, Jim C. M. Ho, Joylynn Lim, Dion H. Goh, Chei Sian Lee, und Alton Y. K. Chua. 2011. Narcissism, extraversion and adolescents’ self-presentation on Facebook. Personality and Individual Differences 50:180–185. Pearce, Celia, und Artemesia. 2009. Communities of play: Emergent cultures in multiplayer games and virtual worlds. Cambridge, MA: MIT Press. Przybylski, Andrew K., Kou Murayama, Cody R. DeHaan, und Valerie Gladwell. 2013. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior 29:1841–1848. Raacke, John, und Jennifer Bonds-Raacke. 2008. Myspace and Facebook. Applying the uses and gratifications theory to exploring friend-networking sites. Cyberpsychology & Behavior 11(2): 169–175. Identitätsbildung in sozialen Medien 211 Rasmussen, Leslie. 2018. Parasocial Interaction in the Digital Age: An Examination of Relationship Building and the Effectiveness of YouTube Celebrities. The Journal of Social Media in Society 7(1): 280–294. Reer, Felix, Wai Yen Tang, und Thorsten Quandt. 2019. Psychosocial well-being and social media engagement: The mediating roles of social comparison orientation and fear of missing out. New Media & Society. Online First. Reißmann, Wolfgang. 2014. Bildhandeln und Bildkommunikation in Social Network Sites. Reflexionen zum Wandel jugendkultureller Vergemeinschaftung. In Digitale Jugendkulturen, Hrsg. Kai-Uwe Hugger, 89–103. Wiesbaden: VS Verlag. Rettberg, J. W. 2014. Seeing ourselves through technology: How we use selfies, blogs and wearable devices to see and shape ourselves. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Rosenberg, Jenny, und Nicole Egbert. 2011. Online impression management: Personality traits and concerns for secondary goals as predictors of self-presentation tactics on Facebook. Journal of Computer-Mediated Communication 17:1–18. Satici, Seydi A., und Recep Uysal. 2015. Well-being and problematic Facebook use. Computers in Human Behavior 49:185–190. Schwämmlein, Eva, und Katrin Wodzicki. 2012. What to tell about me? Self-Presentation in Online-Communities. Journal of Computer-Mediated Communication 17:387–407. Siibak, Andra. 2009. Constructing the self through the photo selection – Visual impression management on social networking websites. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 3(1): 1. Siibak, Andra. 2010. Constructing masculinity on a social networking site. The case-study of visual self-presentations of young men on the profile images on SNS Rate. Young 18:403–425. Siles, Ignacio. 2012. Web-technologies of the self: The arising of the „Blogger“ identity. Journal of Computer-Mediated Communication 17:408–421. Simmel, Georg. 1908. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Berlin: Duncker & Humboldt. Söderström, Sylvia. 2009. Offline social ties and online use of computers: A study of disabled youth and their use of ICT advances. New Media and Society 11(5): 709–727. Sontag, Lisa M., Katherine H. Clemans, Julia A. Graber, und Sarah T. Lyndon. 2011. Traditional and cyber aggressors and victims: A comparison of psychosocial characteristics. Journal of Youth and Adolescence 40:392–404. Stommel, Wyke. 2008. Mein Nick bin ich! Nicknames in a German forum on eating disorders. Journal of Computer-Mediated Communication 13:141–162. Strano, Michele M. 2008. User descriptions and interpretations of self-presentation through Facebook profile images. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 2(2): 5. Taddicken, Monika. 2014. The ‚privacy paradox‘ in the social web: The impact of privacy concerns, individual characteristics, and the perceived social relevance on different forms of selfdisclosure. Journal of Computer-Mediated Communication 19:248–273. Tajfel, Henri, und John C. Turner. 1986. The social identity theory of intergroup behavior. In Psychology of intergroup relations, Hrsg. Stephen Worchel und William G. Austin, 7–24. Chicago: Nelson-Hall. Tajfel, Henri, M. G. Billig, R. P. Bundy, und Claude Flament. 1971. Social categorization and intergroup behavior. European Journal of Social Psychology 1:149–178. Tandoc, Edson C., Patrick Ferrucci, und Margaret Duffy. 2015. Facebook use, envy, and depression among college students: Is Facebooking depressing? Computers in Human Behavior 43: 139–146. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.053. Thoreau, Estelle. 2006. Ouch!: An examination of the self-representation of disabled people on the internet. Journal of Computer-Mediated Communication 11:442–468. Trepte, Sabine, und Leonard Reinecke. 2011. The social web as a shelter for privacy and authentic living. In Privacy online. Perspectives on privacy and self-disclosure in the social web, Hrsg. Sabine Trepte und Leonard Reinecke, 61–73. Berlin/Heidelberg: Springer. Turkle, Sherry. 1995. Life on the screen: Identity in the age of the Internet. New York: Simon & Schuster. 212 B. Kneidinger-Müller Valkenburg, Patti M., Jochen Peter, und Alexander P. Schouten. 2006. Friend networking sites and their relationship to adolescents’ well-being and self-esteem. Cyberpsychology & Behavior 9:584–590. Vazire, Simine, und Samuel D. Gosling. 2004. e-Perceptions: Personality impressions based on personal websites. Journal of Personality and Social Psychology 87(1): 123–132. Verduyn, Philippe, David S. Lee, Jiyoung Park, Holly Shablack, Ariana Orvell, Joseph Bayer, Oscar Ybarra, John Jonides, und Ethan Kross. 2015. Passive Facebook usage undermines affective well-being: Experimental and longitudinal evidence. Journal of Experimental Psychology 144(2): 480–488. Verduyn, Philippe, Oscar Ybarra, Maxime Résibois, John Jonides, und Ethan Kross. 2017. Do social networking sites enhance or undermine subjective well-being? A critical review. Social Issues and Policy Review 11(1): 274–302. Vogel, Erin A., Jason P. Rose, Bradley M. Okdie, Katheryn Eckles, und Brittany Franz. 2015. Who compares and despairs? The effect of social comparison orientation on social media use and its outcomes. Personality and Individual Differences 86:249–256. Vries, Dian A de, Möller, Marthe A., Wieringa, Marieke S., Eigenraam Anniek, W., und Hamelink, Kirsten. 2017. Social comparison as the thief of Joy: Emotional consequences of viewing strangers’ instagram posts. Media Psychology, 21(2): 222–245. Wagner, Ulrike, Niels Brüggen, und Christa Gebel. 2009. Web 2.0 als Rahmen für Selbstdarstellung und Vernetzung Jugendlicher. Analyse jugendnaher Plattformen und ausgewählter Selbstdarstellungen von 14- bis 20-Jährigen. Projektbericht zum ersten Teil der Studie „Das Internet als Rezeptions- und Präsentationsplattform für Jugendliche, im Auftrag der Bayrischen Landeszentrale für neue Medien (BLM). Walther, Joseph B., und Judee K. Burgoon. 1992. Relational communication in computer-mediated interaction. Human Communication Research 19:50–89. Walther, Joseph B., Brandon van der Heide, Sang-Yeon Kim, David Westerman, und Stephanie Tom Tong. 2008. The role of friends’ appearance and behavior on evaluations of individuals on Facebook: Are we known by the company we keep? Human Communication Research 34:28–49. Whitty, Monica T. 2008. Revealing the „real“ me, searching for the „actual“ you: Presentations of self on an internet dating site. Computers in Human Behavior 24(4): 1707–1723. Whitty, Monica T., und Tom Buchannan. 2010. What’s in a screen name? Attractiveness of different types of screen names used by online daters. International Journal of Internet Science 5:5–19. Zhao, Chen, und Gonglue Jiang. 2011. Cultural differences on visual self-presentation through social networking site profile images. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1129–1132. Zhao, Shanyang, Sherri Grasmack, und Jason Martin. 2008. Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships. Computers in Human Behavior 24:1816–1836.