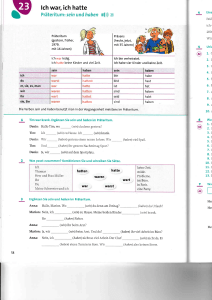z
roz
ra
u
u.r
os ol
I
l6ur-Eu-!l
'uoIFIIeU rep IäsBuEquV lqclu uere.&\
lualrqelafsuo
UEqcsuassIIA pun
-FIeu
]sun)
rap reflu-e.;dureslqeJeg eule>l uare,&\
reqcsrreH er6 's9f11er qcrnp pun qcrnp
qcou 'qcsrluElsr urer rapo,&\ rE.&\ ON reC -
:ro,r (95) suel
sO uaqeN sep alqcrqcsefslplqelueq pun
-rnlln) eura 1fe1 reneg saruoql 'reuqal
-ec repueqrerr{Js tlcsIqEIE IuEIsl ueqcsl}Iu
-uns' <<ueleJuolo{ro >>' <<ue,trlnuro;1sod>>
sep urepuos 'ueuefiepelun edorng 'ueleds
sep lqcru 'uer{nrJ sep }qclu 'ure1s1 uaqctl
relTele11rru sep Funärprelra epuqqqleq
nEeArN ruetsqcqr{ ;nr Funrg14;ny
pun
rypueteg
gt6lotrggt
' t t oz
/
NgSl''59€t
69 'au4dosoyt14 41t tlut4tslaT alouorlou
-.Dlul
ory.toiuoS'
1.to oruabag
np
anqdo
sopu,l
alpstwolst rqcnqo,ry : (' 611) uolytog 'qrnor1q
'lssEJlun
Ellulr{rs eellsnEN
ruEIsI pun >IooqecEc sIE ll{alu }Ie.&\ trleru
ueqcslqere räp uI ue>lueq seqcsrssgueBlraz
ssep 'esrerl6 rello^s{rnrpule uy 1ä1az rg
'qE puefl ueue,&\suasäI rqäs lruesafsur uep
uapunr arqdosolrr{d ueqcslqere rnzuafiunu
-reqcsrenaN uallenl{E
nz
'lllälsrep >llllr{uunure^
ueuolsuezed
uaqrslqEJtr rep
ueqcsl{
.o6
'luue>leq Eluaru puel
qrrs re pe,u. epereF 're,tr qcrer8yoJre ruEIsI
uelseluue>leq
'ualre,{.qE
rruEp pun uerarrouBl uolllperl el{crer eule
od pun uelleuollnrlsuo>I ueFrzura ruaure
'ellepouslqcer
ra
lrazaqdord geueg 'Jeuoral uelreqdrra4
ro
re a1p 'ue8e81ua uaBunqcsl1,q
-oc erp uarsrJa]{ErErlc pun snusIIE}ueIJo
uaueqelrqcseq Ilepoluzueululoc pun ilep
s1>1e(or4 seure zJEsuV uärlJsrleroäql ueu
-res rep 'yqoflo paqv pawulollolN ueqdosol
rqd ueqcsrue>l{orBru ueueqrolsre elle,&\
-reFllur urep lrru qcprdsag sapua{cnrpure
-aq rqes ule ssnlqcs unz 18urrq putg rec
'uezlasrep
-rlsrunueJ uafunlqcrg uelsuepalqcsreA
I
saflru-e..,wusfl
'ller^A uerlcslqBrE rep ur sllapolN
rep ilepotr{ ure rueserp
rnlln)I
sIE
1{ouog, uossolT uaqdosolq4 ueqcsrtddEr
fltrltag - eqcsrd(1 uql rnJ - rep qcnv
sep
'(tr'
g) ..u1eputH rureq lnIN uep
pun eqcns ueqcsrlsrrneq rep efluerlg etp
'flunu;;og arp 'uenerue^]sqles sep 'lntu
-eC a1p 'asa4sy aIIen»IeIIelu elp>> tlcrnp
uorsre qns alp paISITaDIETEI{o rg '(ot 's)
..alpg8erJ uaqcsrqcarr8 rep 3un14c1.tt1ug
uäreqpue,{\qBun rep euuls IUI }EISueluI
aqcq8erl eura uälJBrIcsllesec uererl{eIu uI
]qclarra pun uepro,trafl qclfElIIE lsl uolsre
-qns rep 1rv oICI>> :uezlEs - uepueliluuE
qcsrleqdord uIeuI{qcBN rur - uapueFlo;
Itu uolsra qns
asorp lqrarqcseq 'lsl ueqrols
-efl otoa rap 'uno4ry 'lsr uasrlce,&\re ellep
-oIN ueurepou rep punueso1Ellar ualp rep
uelreqcs Iuep snE arp 'uunure^ rep uolsra^
-qns uallenHellelul rep {I1I1o4 eualpun}
lanlrrrds eule uerzzr{s r[ 'uallels nz efletg
ur uefunuprg '4er;1 erp uno{rv luur,vr.afl
zlEsuv Iueselp snv 'lEq uerolre uErx eAIs
-re qns eluarEqur TUEISI urap arp sEp 'suas
-srr11
-af 4r1rr41;unure
-rnl sep 191I^I1{eD1V epueluqeunz eurä
(tqce6 nz urnraperm) ra lrazeqdord puey
-erlqcsqv 'Ie{mr rap u1 8un14cr1vuuf, rep
eqcsrqer rued ärp qrne lrruep lrars
{r}ll)
uE
tuv
-qcslneq uI slleluelggrä purs uerolny stq
er{csr4rntr rep ssep 'sre.ttqcelq uep JnE llolz
asaql stuzv lV '(vz'S) ..ura1sdg uaqcsltll
'ueqarzeq e>Ira.&\zlaN ueIEIZos alp ,ne rnu
qcrs alp 'uauoqnlo,t ag ueqcslqErE rep ezles
ur euorla ueJEIn{ES pun ueqcsl}Er{ouap
rep uorlerFälul» eure urapuos 'Ilalsrtp
silusrreln{Es sep 3un11e1sefer;u1 eura>1
IerynI rap ur relreds1nleJlqo1\ rep Utqcs
rreH arp ssep 'r{Jne lelnepeq sar6 'ue1srrfl
-elul pun uelsrrEln{Es ueqcsl.&l,z aydurg4
-ueqerc uätrle rep Eunpur,ttraqn ap rU
srseg eqcsrruouo>IQolzos '.&{zq eIEIZos aule
<<ruEIsI sseursng>> aura flunqalslu[ Jap ur
lqels rg 'slseg elBlzos uerep pun IerynI rep
sep elu ellepoN arEIn{Es reqn lqlalqcsu/zy
rqdosolrq4 eqcsrrds req']EIrqn{ES
1a bwog
rep Eueql ruep qcls uelupl^\ eEgrlrag re,trz
-uer{csuel{ euerseqllern{n{ ueIsI}Ir{ pun
elqcerueqcsuel4 Jep uorldazuo; erql pun
aurepo6 rep lElIIESre Iun erpohua4oTpong
uo,t fierlrag rep luoleq qcluqE pun 'uut{
ualerds uernqn; rep Eoprq uaura uI Uunu
ra elqrxeu aure äIIou eqcle,4a pqsnu uql
uaqdosopq4 uer{crlre11elaltrIur uep ;ne grrF
->Icnu Jalun lä1ez pun uernlln;1 uol zueu
-pro(I rep repo sfloprq sep aferg bpuloq
-saIN pawalolN qcnE qrrs lelupl&L qclluqv
'Ilepolusuorlesrlr^rz pun -rnllnx ue^Il
-euJetrle rueule nz 'q'p sntusllelueplz>lo
runz snrusllEluelro uro,t Eueflraqn uau
uep rualle
pun uern11n) uo tlellel^ pun erreqdpe4
IIäls rE 'ldneqreq4
rnlln)I uel{clllse,t\ rep zuEullu
-olusueqcsJJeH slE rur{r uorruep ueflefi qcrs
lepue.&r qeueH 'uesel qcslleqdord qcrs 1ssg1
uBuresne uefunre;arpeqn uesgläqer uep
]rlu uorluelul rer{cslIeuIoJeI uI qcnE Jepo
'qcsrllr{ aselp qcls ar.tr '}Eraz
^rltrurgJt
pun ro^ urepuE'I uer{csrqerB ul sua>luoc
ueuelluärro uelqceluenEIc uE repo ueqcs
elp lllels '.LUEISI pun uenBrC nz uo]lEqeC
alp reqn {crlqreqn ueule tqlfl auoopa I rwqag
'1fa1 <<uaqcsualx ua8rlressarp>> uep
Jne
>peuueflny uras pun 1qeflun qcsr]
re>Iretrs
srzrtr{el{e ueflunlqezrg uayorfl uep lFu
rap 'uaperuoN ualrelsrleqol8 sap 1epontr
ura uefiaäep lllels pun 'cle TUEISI pun Uunu
re 'ulerapuv Iuop pun qcl uo^ snlusll
-enq säura srer{sleJnel ueqcsrBoloepr usu
-re re lllalsrelun ura>Iuac ueqcllpelqcsrel
-un uesalq 'ure>IrlrJ1 uerarJ pun e1>1alor4
raIIemlFI urelerge1'uaroleluaturuoy
uerlcsu{eplp uaqssll\.2 }epleqcsrälun
tg qtoH tly s:. llälsryIrr{cs pun ueqdosopq4
uaqcsrsauEqll sep 1Ie \ uaqcslqBIE rep ur
runturrgcs seqcsrqdosollqd
-efi req4 4c11qreqn rep tsl qclerssnlqcsJnv
uesgrFgor uslrrtlsJe seure uorl4npord
uol qcne qe 1sr lpprd
uet{clllse.tt uelrerrtds
'-aä rap >lrlrr11 reure
rep 'zlesuv ueqcsrddl ueules {eIclr\uue
uno>lrv 'ules uno4w pallruaqory qdosopq4
eqcsrsozuerJ efirururglsqcsrreflle rep prr,tt
-r1rr{ pun - gelspeflro qcsrltr{ouep qrrs
'zrirzq wlq lrarfluerre eller{orueg rep rru
-ur qcsrlsrlErn]>Inrlslsod raulo uol Iqo,{\os
-uespunrpl4rg pun qeE ueuoltlptrl eqcsll
-Er>Ioluep IeIA ueqcslqErB rap uI ue>Iuac
rur sä ssep 'qc111nap prrrr.r. 'purs EuerII
ure{ qcou urepuET ueuapelqcsre^ uep
ur uaflunfiezrteqarler{otueq elp pueg ruep
ur uue^r rlcnv ']sr ua{ueq seqcsrqdosoyqd
seqcsrssguafllrez seqcslqerr flr1p;yera pun
araa. 'qclpnap rqes uefiraz efiErtrefl
ftpueqel
erql 'luneu ueqcsrqerE rul ualqceruaqcs
-uel I
-uenEIc pun trEIIEIn{ES 'ell
"&\zquo,t uaflerg uep
'rn11n;1 ueqcslur
pun uafiunlqcr6 ueqcsrqdosol
-er{oueq
-EISr rap
rqd ueueperqcsre^ rep Eo1e1c ruep UeIIE
ro,t 1pfl ' \zq IIIä ua{ueq rqr - suererqd
-osolrqd ueqcslluelsl-qcsrqerB ure4lssBlx
uep nz ueroqofl urepue'I ueqärs snt ulr
-olnv
eura pun
uerolnv uallqEutteFsnr lqce
aIC 'uarerzrlqnd
eqcrrdg ueqcsr
-edorne
ur rapo
Jeule
qcslqErv
ur l>Ierrp repe,&\1ue
arp 'ueqef ueqdos
-ollqd
reFlqc
-erdsqcsrqere
raqcsrssoueflraz
ua{ua6 saqcsrqd
osolqd q {cIIq
-urflueule elqcgru
pueg aurell rac
orqdosol Iqd eqlst ruElsl
' uau+alp sD (o dday) t un
NneDq
lsl,ppuutap pnm aqobstwlaud alo '-Itrn uauaq
a 6 a buo np nlun uapolnz.Llluluall §! lpnfl sD O
gS =pnuaq,catS
-er-ro - er- oroz :zY =ptlng
zS - 6z - 6 o -
-t?
fi -
t o - zr oz : z BV - AA apntD - (n aln.q lu a tuü ut 03
=uoqdofirqd' xopul/lu»' qun:»l- a' mmm/ / : ütq
( apw-u b ta ruq1 ualvu o s a al! ?un
yapunryt4ol 'oz tut uau6g u uaDLLod ualpsll
-!pd aru)' uo?uol - qntnq- a (et o z) o6fi ,ary1h
-1o orln,om[a om u:Ullst,-lv u"rob-1o o6t
-
ng
{
o
66r so
6r s -
(
so quzllv - lV ouuv H qullop qV
're,u uasaltaä ueleued ual{rsr1r1od rep ap
-unlssunqeC erp sletulsure arp '.uallalqlseJ
(unqe8reparl6 eqcsrqere) <<EpI{EN>> rep uE
qcnB punuorleN rap lIequIE rep uE uelsleIu
rue reqrsq erp 'ueue[ 'ue1;gry ue{ull pun
ualflrygrue8
'{uarEIn>IES
uep nz Eunleg
erqr pun ueqelrqcsaq uelqcrqcssflunre4
-lp.^ag ueuaperqcsrel rep 8un1pg eqcqF
-oloepr ailepuEre^ erp prr,{\ qcnfl ruep uI
'ueprn^\ l{uprqcsafura lqcru
lnlosqe eltels
ruo pun ueputJ
ua8unl
-qJrrurg uelauproafinz uap pun ueeqcsolN
uep ur llelsrureH erql elp 'ua§untugrlg
Fttpaurt§I
l
?
4
?.
z
z
z
E
c
z
z
z
z.
z
,
z
c
e
z
äP'rn l!ln
p
u-uolllpa'aaa
snlltnt,N uoll!pI
ffi
'!orluaurlo uotsrlo+usuDpunJ
pun sProlJn^A u3lsa/\A rep om 'uDlsruoqo,v
r.1)ou J€para Pu0 uouls 'lorl 'uarqorY-rPnos
'usrsaunl'ua{qr'l 11)ou aq)nsuärndS rouros
lno ro+nv uap +r110, a6prl 3rc urr+)opzlos
-ur] aiqr raP€ra 3lnäq olvN 3rP taPunr6
usaPl usJep ,no louqlärö6snv 'srolrllw pun
allan+lallälul ägfsrpdorns urapuos'aq)sru
-rlsnu lq)ril Purs raluaPro^ uaPue6old oJql
6un-rn111ny-r1uy usr.jf, rl+so-lsaa uauDsutau
-a0 Jaura ur llazrna ujapuos'uapuolslug
iualJo u! urallo +t.1llu lsl )snusruolsl' JoP
q)öo 'o)irrloproN inD llrlg lru ra+L{)oqoog
at6;ossq ua6Dl, '»äuäurirar ounqts Jop
+,u unu uorlnlo^au iap qlDu rla uassflw«
Z
I
z
e-
z
c
ä
1
z
2
*.
c
@
t
f.
6
a
e
z
c
,
o
J
c
ädtä$*äs§:'r* §f}1il.*s#
]ONI]J
]U]{l oNfl
N0rrfl]0,1IU
IHSS|SYUV
It0
6
?
z
?
1
o
o
t6
setuer^ep qclos :sloqräA sep lle{ftl145 ery
ueuflneT ures qcrnp rFpJp»Iaq '.lelrarlseq
reqe sarp '.llletsre^ atoqren a1p uaFeä re16r,
'ellBq trs8uv pun elruErlcs gcls uBru IIo^ .
'urraqef se llerq ueru repo ureuuelN ueqcs
-1,{1.z xes uer{crluqaure ure ueura{ repe,&\
1ua qefl sg 'uefiunfl41e,ua8ra^ nz zlesuafr
-ec rq - raqnrtp slqcru ldnBqreqn uessr,&\
JI,{\ - 'uessl,&\ <<ureuuEJN ueqcsr.&\z xas
uaqcrlruqeure.t ura' uefl elt uafi unyrelrnren
reel} Eruaan Jr^ . sstp 'os lnu trqJru el lsr sg
'lEq Ueld8{ s}qclu re ssep 'telataz
'<<1ue,r.a1errr>> zleseC sEp ras uu8p ']ulelu
raqe ra uuel6 'r{cll8eru srupuptrseC rueule
req rnu ]sEJ rE,&\ aJErlS rep Enzlon rap
qcop 'ftflUF lnlosqE rE.&\ loqre sEC 'uap
-rn,ry\ lelqcrrre ueprnr{sre.r\eg eqoq lsqles
zleseC rul ssep 'ue ]qIF lsqlas rg 'uursun
lsr 'rss ..ueflueäaflurn xEI>> ueuqr lllu utru
ssEp pun ualäs <<reqrqnJr{Jrnpun ezlesec >>
eserp sstp 'Ies ..ErInE ]qcru pun Btrmfi,
leurqn>Iuo) pun eqE uo qlEqreunE xes
ue8eF loqra1 stp ssep'funldneqag sreneg
'
qw
eqg
erp
D
soleqg erp rlEZEqC -IE
6a4ft
zuBc 'srepuB sEp Ies a}neq
{le}s snlnEd
eI,&\
'uesazrefl ftfqcnf pun flrlqcgz uenerC erp
ueres ruEIsI sap uarqe{ ooz uelsre uep ur
rng :ueqeflnzqe 11eun ..se,tr1rsod 1>1uErr{cs
aflureun>, ure sle erapue selle '{elaleJ
-req ua.,lalrlA pun uanErc 'uäqrpEl/{ eulel{
§
c
urilu§fir sr?3!l
z
z
qclluue4eq rep 'ueleqdord sep spllqro1
ztorl reflos sa 1flu11efl qEzErIC-lV 'uaru
sep
-ruo>I nz IarururH uap ur
un
'ft1-o.,t
qpq
-sep qcrs UJIArelun 'uepnerJserperEd JnE
?,
4ceuqcseflron ueule lturuo{eq uuEI i rec
:sotrloc >Icrrl sle pun
pun ile{o{ uäqEux uep uelllo,ry\ relqcrc
erp :lElrlrrr^ Iun elu se lqe8 'lqnElre >lrlEur
-ruEJc er{csrqErB erp sE 4.'lsl luleluaE nBrc
eure>l uqn>lsEl,{ Iuep 1ru o.&\ 'qcny .'' >1ceds
-,(qeg'Fur3 repuleddrrl'rlcsreTäIre,1
'e1;ng alra.tr uessep 1181s "' 'uur) seäIl
Ue>I '.qcneqllerqqrsel\ aru 'ueEunseq lleq
-ugqcs eqcrluuEru eru prr,&\ '1Qs3 uanerc
run qrll4cnrpsnE lqr!u se ueuep ur uetqclp
-e8seqerl uo^ uepuasnel uep uI 'lqclu se
lq13 rpryp eFaleg '<<puls ue,&\sue:oqafleqau
-WIN a8un[ euer{cs ssEp'qcr1pue1sre,r,1sq1es
se rE.&\ uelso ueqEN uolBruolo>Iro^ tul>>
'(Prq
'IV,t\ITlep'tuEISrsäplle^\// :d11q :11IIuqc5
<<JsI ualoqrel ueleqdor4 sap uo
'V)
1811e6 rep ur sery\ 'lqnelrä se,u1a rep 'refirq
-nEISuO ure lsr rep uuaq 'uepre.{\ lr{ctrq
-eE uosred rnz ssnru '1e1rer1seq 1re>181tr1qg
euräs 'uerlleqer zJeseC sep uafiefl qcopel
ra16 'uasselafi uap
-errC ur prr.u 'ue;
-rctflnzue tle{äp
-ßC
euraua8lle
aulas euqo '1z1as
uEr>I reunE qcrs
ro suEJES sap 3nez4ra16 ura sIE LlEzeqg
-lE lllels lsnl arq 'ureyorflrerr nz epuleru
-oC ar{Js[urlsnu erp snlrox qcrnp 'urnrBp
qcne se lqafi gop pun <<auqes>> purärr6
IuI lqels ..slqcelqcseflueqcsuer{ sep puEls
aquoc>> ]trEtrs '<<reuuew>> pun <<Jelr{cs
-reg ueqcrleqe>> urn lqefi sa [o,r. <<uaqcs
uew>> qcou <<rrle>lre^slqcelqcsec>> rep
ueruruo>I lra.ttldneg sllezeqa 1o) uq
-e
^.
-lo uffino6r11 rcp ur 'afi1o;ueqrag erp re8os
'.qcsIEJ sep lsl raprel 'unN ..1efl1o;ueqre6 erp
- uaEros nz qtlcayqcsabuaqcs
yuo$aqlßfl uep rnJ 'suälra,&\z pun
alqreeq ueru
-uaw
sa?
'ueqefi nz selpered sep JnE 4ceuqcsa§ron
ua.trlrsod uauß uaq) sualN utep nzep suelsre
'IIEZEqC IE os 'eualp rqe{ra slqcelqcsec
raq 'uaqesap se rJrsod l{upJqcse§ureun
sB{\le slB xes p4,&\ Ilr{lelBnxes ueqcslru
elsr rep uI>>
'llleunre^ ureuuetr\l
ueqJsr,4az
xas ueqcrlruqeurelule uefla,u. pueruelu
w ue
EI>IS sIE
'.ualqcnsra.r s§unl arar;
reflos tuellrq resseq se eselp llurBp 'repuly
ueqne{rel ure11g 'uraddalqcg uarqr nz uafl
lqclu
prr,e\
eprn^\ uerqe{ puesnq uI 'qcsr}eroeql ureJ
uere.e\ aloqJe1 'run <<uefiun,la,zeflun pun
re{col>> ueur flu13 xes 1lntr :pgg sapuefllo;
renBfl leuqcrez uJtneq lElrlEnxes erp SEIA
'uafiue1afl nz uellelsutuelnr>la6
erp
rnJ se '.Uorulun>I
qcEJuIe
loqre^ure Iun oslE
qcrs '.llEqre qcsrls
-uqlqcnusryEqcslrrl6 uaFl]naq rap sep sle
Iesseq 1le.t\4.I8^{ ulalpuEH ueIql nz ue el>IS
rap srullEqre^ sec 'uepre,r\uellns ueluuo>I
- rruroJuo>l - uou
qcrs reIA 'uarral
-ol
sdag ueqoq seule repo suElInS sep
ue
epIS
rnN'alErauec qcllUellqcssna urepuos
uallEqre^
'
arrrl>1suef
elurr.
rr;'-;;;:tJ'=*r*
-nX slBtueru reqE '.ue EI{S-xg reqcsJreH
allo ueßln 1eZ Dp ur :<<Dlno? letlseu.(6r,
uelen§ ueqcsrqere uep ur try1eq 'agerflar
uerddfiV arp'.rnlE]>IrprEtIIIW aftrqp[-ooS
alp qcnv
'relqcelqcsec uelqcsrreq
lsralN'eprn.&\ 1sg1efiqe raflerr4seruuelg
rueure uol rep 'e1f1o; aAEpIS ure JnErEp
'ralqcrq ure raElo;qceg ulas 'rE^\ JaqcsrreH
Je{cpfl ule lsre ssep'os lqclu JeqE rE^,\ sU
<<'uepre^\ ueJsrnc lunz ueAEI4s
luo^ qcrlrlcgslEl uEru äluuo>l uelso ueq
-EN rul
"'
solue>IuErqcs nzapere8 rr-tr 1EtrII
-rqow elerzos erc>> :uessep llBls 'luqE,4 ,re
lqcru uep8eluo epls erp reqE 'lurrE,&\qcs
uesrers8un>Icepluf, uol
E{IIJV ur
Je uue,&\
ellrJ8 eloJEsor erp qcJnp lneqcs rE
.segedxaqtlp
-e11 'uafoloeql 'sgng 'ualsrrn{ ueqcs
-r,lrr.z ..flunlelslreqrv>> urapuos'l;eqcs
-trrr.&\pueT '.IepueH '.>Ire.&\putH u1 Eunr
-arsrlerzedg lqcru re Jureu 1rruep qcop '.rol
..flunpe1s1reqrv>> Iuruo{ urqrerurul'ugr{
-eF alu raneg leq flunlrelslreqrv reqcslu
-qle uo^'reqlarlulerenelS'usqderflo1oq4
'rerelsnepl're41sn6'eperurqcsreqlls'rep
-ersuaJres E,tue 'l4uergcseq e;nrag efirua,tt
JnE ers uarE,&l. oIJEJ oc 'ueluuoä uäpre,{\
ulzzenlN repo rpe§ ars ssep 'lqc1u qcnt
eqne18 qc1 'flpp4paqztnqcs repur) pun
uenBr! erM uerE,r\ 'ue8elt ue#E/l aureT
ueurnp ualsrrq3 pun uapnl
'Funlqcarlufl
aJBlualuele urapuos'loqre^sJnJeg rnu
]qcru se ]sr sarelzle'I pun trrlclu lrurulls sar
-alsrE 'ueJJo eJnrafl oIIE rElrIrI l luep reunE
uepuels ueuqr 'ureJroc UoIIE ur uEru puEJ
uelsrrql pun uepnl :lqrärllcs rE 'I{celqcs
ra 1sr '1qefl 1;eqcsurrl6 pun UtqcsllesäC run
se uue,r\ 'lnfl ra lsr 'lreueJer alxel eqcsrq
-Ere re uua.rt le8olollqd lsl reneg seruorll
'run eselp eluoruaflaqsrn>1
-srq aqcrpse^{ ON lul e1p1safl '.ep1q }El
-rlBtuew pun mllnx ru neqrelun uep qIeT
rap uetsalA rur osIE puerqpl& - '11e1Epnep
Jtlehl raqnueflefl zuerelol elp oN rul uer
-qe{ ooz Jres ä>Iurs suelsel6 sap uoIlElIIuI
qcJnq
<<'uarqnJ zutralolurslglrnflrqury
re>lrels nz [ueuugq] elqnJeC uelualt^rq
-rue fuepuerarllnser sntrep erq] "' 'ueyap
-unqrqel lres suelselA sep ueqcsuel4 elp
1a1reyfleq redrgy ueueflta urerqr ro,r lsfuy
eqcrllr{cErleq eur[>> :eser{lure) eules
'uuE>I uepre r ppuarrteflur lqcru reE
(e,ueqs) ErrEqcS erp qpqsep 'uauulels urqr
uo qcIpIrL&\ ..eqcnrdsueleqdor4r, al{cle1lt
pun trEq lularuaE Doc sBlv\ 'uuB{ uesslr\
pueueru JeqE'ueqcnrdsueeq flunqeg e1n1os
-qe teMz u1efle6 se]loc pun uelaqdor4 sap
lerdsreg sep '.qcnfl selloc sstp 'raneg 1§rez
lqced pun qllpeH 'uerox req4 ulalrdey u1
'uaFelqcs
nz uepoqlaw uessep lrtu uelsalA
uep
'qcnsran ula urepuos '.rutlsl uelleuorlrp
erl tunz rqe>l{cnd eule{ lsl snlusruElsl '1alqcru
-rel uelleqrepur6 esglfller qcou uersru
-eflro uaflunraqnps eqcspqla repa.tt lerl rf,
'ep4rd pun urtsplnpun'qcsrleruEop
]qclu rB^r ruEIsI aqcrlrelElauru rec
-
p'an bl lEtrl o l d ! p-ap uout -rutJ[m
aaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaatta
a
9-88.189186-E 316 NgSr
Jdtros zIT t.e ,.a' o ril 3 0E'8
Sunlpur:qq:ng rarLll lr lapo
LlJrllleqra oqv ut Lltnv
anblleuroldlp apuol,U
al uolllpil
rap uaH enou §Eo
'llata uaq)sltl
D.L
D
-t
)
p
a !) Lta] a r ft a I p .t a q n' ü' n LrLtD ut a p al *1 all(\.tD t-l )
plü S p -tü ttlp g's all I L e {f r »lloA' ! p ! tls Dü t f ,, u r ul.- DÄ
r a lq 3!s
t
'lll!.rJre lqxlu qrou ertrBr{ourao JnB
äunugog erp lsl uälodsefl Jep zrnls ruäp l$r
qloü 'lgalJopr/$ elräIrnJoÄ aql§lse/lr 1€q .SuJIrInJd
§qxsrqBryrep * slrrnJ ur JaSSoIg asunf 'ruuu5
uoa uauBrls IlapJnu u§uuFslÄIply äuärälqlsra^
'4u1dr1.rqu; Jeorrell rrrap JnE surJlluqllnd
anluu rop §ns uollloqau alo
' t r o z uauorbrla
41aX4 .op 6oyar1 uu
Dp NUItN alq :Dngg sowo6
:
ng lpynbrqwv
qcsrlrruFop sIE uelrlrze],ntr{ <<ueqcsrlsrl
-EuoIlEr>> erp 'reurroJeu rep <<uepleH>> erp
puerrIE,AA. :qcsrreged
n!urqrsourv'al4edsyeqcrlzlpsnzqcne
läu1rq urepuos '<ärlrr>Ilreleq run rnu trqcru
'äunsse;Fue1 elp Lun ]qc1u.qcrs lleputq
s['uE renEq/uElsr/rerssop/ep'oruEul'.&\,r\,ry\
relun nzep uerlerrele141 ap tflupequn qcrs
als uanEqrs 'uelssaralu! qrng sEp ets s[leJ
luqg.ry\reun uaqrelq af uerfi e1
'
cu?p?rc pun uos.&l.ou '>I llera g uo^ ual
-raqry erp qcnB :renefl sIE ueqBr{ lqcsroJre
reneuefl lelqaC sep arp '(tsef, eppp{ ueru
uI esrnocsrc Ienxas Eu1äueq3
-o11O eq1
'ensaq fiurcnpor4 '^epz ßt1l pun oogr
-oosr plrol6 cruEISI-qErV aql u1 dlgrnxes
-oruoH eroJeg'qeq(enog-1a pepq;)'1ssp1
luqpltreun SrIIo^ uelnäIqcec uo^ uelreqrv
erp Eweql tuep nz ranefl ssep 'Fpreuaärg
'ueqcetunzralunr - re,tr 1flrr;
-relurqun eurfloq sep ruäp uI - ueqcsr,4az
-ep ruep reqnueäsfl - uerolesruoloy erp Jne
ueuo,&uuv erp
- ua1gds
uep
pun
eprn.&\
uerln>lsrp qcou arfloloeql ruap ur - ruET
sI ueqnrJ uep 'erfla1rr1g sraneg nz ggqafl
seq ('uepreg pun ualsrrqJ 'uepnl rnu lqcru
pun ueluluo>I eIIqH alp ur 'uenereq ]qcru
pun uaErpu4s Je,&\qcs ers uue,{ 'erurTsnll
qcne ueuqr req sstp 'urrep ue1r1rze1,n11
rep
<<le1rsoro316r, arp lqalseq sueflrrqn)
'lqclu'uelrleqtueHuep'raufleg - uesorofl
-Ir pun uer{csrleruflop osneuefi - uerqr 1ru
ra 1;durqcs 'uepre,&\ l1epr1efi sorofir pun
qcopal re lsr ueuqv
er{JSrqErE sEp ssEp 'ualle}snzro re,r\qcs
uuap 'uorlrperl afluqE[puesnele \z>>
lsl
se
eure epue uelqcrpefiunelg ue1zlal uap
llru
'lqlorqcs reneg 'uelltr{ epuny eure4 refl
ssep'arflolorlsvpun >Irlrrueqlel{'elqdosol
]ruuo{ 'lEq
oqddeg pun sel4oqdog 'reluoH uol raqe ars
uaärtre,ue( uerqr req :qe uaC rqr eurepory
elp JnE ueuorl>leed ele usfiar»1 tuql Ieg
'trqclu renEg
unl nz lJrr{cslleseC rap ur nerg rep flun11e1g
rep llur 'ue1re1rleue4 rep EuntrqcEra^ erp
ssep 'eepl erc '>Icrrls rueure uE ueIIEqruEH
' uefluar1s llur
UnS rere>Icol qcueru reflos
lqerz uenerc rap fiun1e;ne1re rep Iäq pun
'rqeru osrun nErc erp elurlsnl\l ue{eJneue
os '<<sun req>> sle apJn^, lleJnelre.t reflru
uerqafieg sep <<ruEIsI rur>>
-e,&\ seuuelN sap
pun 'ueqe1rl ueplunp uon ueqcerds
elurlsnlN r{cnv 'lqJru ltutur}s 'uaqrrpre,r
uue,e\
uqluerreqleruolo) arp srqres uase.uefiqor;
-uauuls Jnu qcBJura <<ruelsl rep>> ssBp reqe
'ue4urpeg ur uoqcs urepuos 'ue8rpu4s
uoIA pun treI qcmp rnu lqcru uEru uuEI
<<sun raq>> 'ss1,uag 'UoIA nz lqclu reqe ueru
-Iuo>I euelrleued pun uenerc uäluuo{
ueuorJ lsn'I rerqr uelserepEd pun 'uepln.rr
uezurrd nz ua epIS luap uI 'ON uelBruolo>l
ro ruol plrfl sefirsor
u1e re 11eru
luresaflsul
'uellalsro ]qctu..Funz
-lesuoc>> srenefl Jrru qcr uuel retrrqalac
rar{csnuelsr zlrsafl rur >p(1 raqcsrqcerrfi
1nu ueldrr>lsnuer{ pun relqcrq ueqcsrq
-erB raq assruluue)-qcsrqcerrc reqn
ueuolleruJolul euqo :pe1uafleg rul
rq4 'urzrpel4i :uelrerdrzar ueqcerrC Jap rnl
-Erelrl eqcrlzlnu erp rnu elurlsnlN erp ssBp
'uE uelu lrururu qrrluqg,Lrag 'Eunldneqeg
-<<ueqaluoc>> sJenEg qcne flrpr4m4repn
'
ue sqce.r\run
1
zlel w4r
erp '.ueqcrEqsflulqnru relrez uaäa.u lqcru
uepnerC relrep Jne ]elqcrzre^ 'apln,n ues
-seleEurar snuv ueuEEqequn ueure ur Jar!\
:ralqcrq rep läes rqeuler^ 'res uoqcs uEB
rep qcne trrurep pun uoqrs runpunt lzlel
pueflag.arp ssrp 'urnrep lqcru raqe 1qefl sg
'uallauds
uawryqsbu-y1tqltt uuam 'yol trlplu tqalz hp
' yuoI lowtaH ?ua 6ag .orqmq rn.Dm wD o
,..111a1se8rep
selrlrsod runpunr se^\le sle
sqcn,ryuJEg rep>> apre,r\
lqcrpec elsrlJEu rul
'1ssEI uarerrleuad qcrs
re ssep qcrlrupu 'a.u1omab seuoqcs rerurur
qcou Je ssBp reqE lr{els EC 'res <<$ns rerurul
qsou
"'
3u11Bu4l, rep IIe.&\ 'uetuurouaä
-apa6
JnEX ur epre.&\ utg rap 'leldneqeq rg
etpwnovwalmz uo raruurr raqe]srse ia1ryg
ak{y.14 run se aEuIE ..ueruurrflldesqcn^\
-UEg>> uep
ur 'leldneqeq reneg seruorll
'unlnz slqcru
<<'lzJas
- owoH
lqcp uruerfrdasqcnnlreg eqcsrlefolodr
'{uaqcrelC seure uerqefieg
-uoJ reJnElro ue>lrlue raures uor]IpEJI arp
lpr
sBp
leq
osle '.>Irlorg
IW'FIäUaE pun lßz'Egr4,la.re1un
F!lDE
il
Materialien zu
Thomas Bauer
Die Kultur der Ambiguität
Eine andere Geschichte des Islams
Berlin: Verlag der Weltreligionen 2011
Dies ist keine Langfassung meiner Besprechung im Heft, sondern Auszüge aus der
Rohfassung und dem Exzerptenheft – kaum geordnet. Fünf der zehn Kapitel des
Buches sind toll und auch in den andern gibt es viel Richtiges, und auch viel von
dem Falschen ist anregend. Die theoretische Einleitung finde ich langweilig und
wenn von Nicht‐Arabien die Rede ist, wird es dünn, aber bei andern Kapiteln meint
man, der Autor habe ein paar Jahre im mamelukischen Kairo und im osmanischen
Damaskus verbracht.
Wenn er noch Praktika als Bauer, Sklavin, Handwerker, Jüdin, Kurdin, als Ismāʿilī
und 12er‐Schiʿit drangehängt hätte, wäre des Buch makellos geworden.
Die Probleme beginnen beim Titel. Warum schreibt er „ambig“ (sprich ammbick)
und nicht „vieldeutig“? Und „der Islam“ ist eine Unverschämtheit. Es geht nur um
den sunnitischen Gelehrtenislam des Nahen Ostens; Schiʿa, Indien, Indonesien,
Afrika kommen nicht vor und die Muʿtazila nur als Buhmann. Die theologischen
Debatten der „formativen Periode“ übergeht er. Auch der Maghreb und Zentralasien
interessieren nur, wenn dort jemand ein arabisches Buch schreibt, das auch in Kairo
und Aleppo gelesen wird. Ob er wirklich eine Mentalitätsgeschichte des Nahen
Osten vom 10. bis zum 19. Jahrhundert geschrieben hat, wie er glaubt, weiß ich nicht.
Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob man von den Abhandlungen der städtischen
Gelehrten auf die Mentalität der Bauern schließen kann – so wenig wie man von
William von Ockhams Schriften auf die seelische Verfassung bayrischer Bauern, und
von denen eines Erasmus auf die von Rheinschiffern schließen kann.
Bauers These, dass Unbehagen an eigenen Körper Intoleranz gegenüber Vielfalt und
Abweichung produziere, ist unbewiesen, aber (für das Vereinigte Königreich und die
Vereinigten Staaten) ist nachgewiesen, dass Dummheit mit Intoleranz korreliert.
(http://scottbarrykaufman.com/wp‐content/uploads/2012/02/Psychological‐Science‐
2012‐Hodson‐0956797611421206.pdf – falls Link nicht mehr klappt:
doi:10.1177/0956797611421206 Hodson/Busseri in Psychological Science
0956797611421206, January 5, 2012) Da die von Bauer herangezogenen Autoren in
einer weitgehend analphabetischen Gesellschaft lebten, waren sie gewiss überdurch‐
schnittlich intelligent. Dass die nahöstlichen Bauern intoleranter waren als die
Gelehrten, behaupte ich nicht, nur dass Bauers Verallgemeinerungen unhaltbar sind.
Alles Falsch
Wenn ich kritisiere, dass Bauer sich seinen Islam zurechtlegt, indem er fast alle Islame
ignoriert – sowohl im Sinne von „nicht kennt“ wie im Sinne von „übergeht = dem
Arno Schmitt
2
Leser vorenthält“, dann geht es nicht nur um Faulheit. Bauer tut so, als sei der Muslim
vor der Ansteckung durch das moderne Europa gar nicht in der Lage gewesen,
Eindeutigkeit zu verlangen. Zu solchen Ausführungen über den Koran, wie sie
saʿudische Gelehrte heute produzieren, sei der von Europa noch nicht verdorbene
Muslim nicht in der Lage gewesen, für ihn sei Vieldeutigkeit geradezu eine Notwen‐
digkeit gewesen. Nun schreibt Aḥmad b. Muḥammad as‐Saiyārī im Kitāb al‐qirāʾāt
über den Koran: bal huwa ḥarf wāḥid min ʿindi wāḥid nazala bihi malak wāḥid ʿalā nabī
wāḥid (er hat éine Lesart, kommt von Einem, ist éinem Propheten durch éinen Engel
geoffenbart); Saiyārī lebte aber tausend Jahre vor der Bauerschen Verschwörung des
Westens, den Islam auf Linie zu bringen.
Die Belege, die Bauer von seinen Gelehrten bringt, sind höchst aufschlussreich; mit
dem (vormodernen) Islam darf man sie aber nicht verwechseln.
Islamisierung des Islam
Seitenlang wütet Bauer – zu Recht – gegen die „Islamisierung des Islam“, was
zweierlei meint: einmal, dass man die islamische Religion theologisiert, sie paralleler
zum Christentum macht als sie ist, spielt doch in ihr das Dogma eine weniger
wichtige Rolle, zum andern, dass man die Gesellschaft religiöser macht als sie ist.
Und in diesem Zusammenhang schimpft er gegen die Dummheit, „Islam“ und
„islamistisch“ zu benutzen, wo die Religion gar nicht gemeint ist. Er selbst macht
dies leider auch immer wieder – nicht nur im Titel des Buches. Ich selbst behelfe
mich damit, dass ich „muslimisch“ eher für religiöse Aspekte nehme und „islamisch“
für die Zivilisation benutze. Er zetert über Islamexperten und Orientalisten, aber er
erwähnt nicht, dass das einer Binnensicht entspricht: Die Muslime nennen die
gesamte von Muslimen beherrschte Welt das „Haus des Islam“; wenn etwas davon
an die Fehlgläubigen verloren geht, sind sie gekränkt und in ihrem Haus ist ein
christlicher Präsident unvorstellbar. Bauer übersieht auch, dass Religion nicht nur
Dogma, persönlicher Glaube, offizieller Ritus, Zauberei/Hexerei, Versenkung und
Verzückung ist, sondern auch ein gesellschaftliches Phänomen. Egal wie unfromm
einer ist, wenn er Alawit, Jude, Druse, Christ ist, wird er im Dār al‐Islām anders
behandelt als ein Rechtgläubiger – und (deshalb?) handelt er auch anders.
Bauer kämpft gern gegen Pappkameraden: Er tut so, als hielten die Orientalisten die
Medizin des Nahen Ostens für religiöse Medizin, obwohl sie doch völlig unreligiös
sei, nämlich die alte hippokratisch‐galenische. Acht Seiten später – wenn von Medi‐
zin nicht mehr die Rede ist – schreibt er, dass im vorkolonialen Nahen Osten „auf
allem ein religiöser Feinstaub“ (201) liege. Es gebe Religion gar nicht als eine eigene
Sphäre, alles sei irgendwie religiös. Hätte er das eingangs eingeräumt, hätte er sich
viel Schaum vorm Mund sparen können. So gibt es auch gar nicht die von ihm be‐
hauptete harte Trennung (195: wenig Ambiguitätstoleranz) zwischen „griechischer“
und „prophetischer“ Medizin. Auch die muslimischen Praktiker der griechischen
Medizin haben keinen Aderlass gemacht, ohne die Basmala zu murmeln; auch sie
inamo Dossier Islam Bauer Ambiguität
3
haben ihr Behandlungszimmer mit Kalligraphien der āyāt ash‐shifāʾ geschmückt. Und
wenn man sich die Bücher der prophetischen Medizin anschaut, so gibt es – beson‐
ders bei Ḥambaliten – welche mit viel Hildegardmedizin (Bauers Analogie) aber auch
solche, die außer ein paar frommen Sprüchen die übliche Lehre und Heilmethoden
bringen. Die Trennung von weltlicher und religiöser Medizin war so streng nicht.
Warum Latein?
„Wenn man den Begriff Ambiguität ... erweitert, muß man auch den Begriff der
Bedeutung weiter fassen“ (26). Muss man? Ambiguitas kommt von ambo (zwei) iggere
(treiben) und bedeutet: von‐zwei‐Seiten‐Treiben, Vagheit, Zögern, Zweifeln. Aber all
das meint Bauer gar nicht; er meint Vieldeutigkeit und nur wenn „Ambiguität“ gar
nicht seine lateinische Bedeutung hat, sondern nur ein hochtrabendes Obergewand
für „Vieldeutigkeit“ ist, muss man Bedeutung weiter fassen. Muss man denn Latein
schreiben, wenn man Deutsch denkt?
Unnötig auch einen „coitus pro natura“ zu erfinden, die Scholastiker meiner römisch‐
katholischen Kirche kennen nur einen „coitus naturaliter“, aber Bauer entstammt
bestimmt einer alternativen römischen Kirche.
Ich verstehe auch seine Schwierigkeiten, den grünen Stecker in das grüne Loch und
den roten in das rote zu stecken, nicht – seine Ausführungen über drei Gebrauchs‐
anweisungen, zwei Löcher und einem Stecker (54‐6) sind in meinen Ohren breit
gedrehter Quark – vielleicht sind sie ja für andere erhellend.
Ginge es ihm nicht um Hochgelehrsamkeit sondern um Einsichten, dann kämen wir
mit Offenheit, Vielfalt, Sowohl‐Als‐Auch, Pluralismus, Heterogenität, mit‐Wider‐
sprüchen‐Leben, Unabgeschlossenheit, Mehrdeutigkeit, „kommt drauf an“, „5 gerade
sein Lassen“, Streit‐Aushalten weiter als mit „Ambiguität“. Aber dann gelänge es
ihm weniger gut, dem Leser bis kurz vor Schluss weiszumachen, dass Islam gut und
Westen schlecht sei. Als Skeptiker habe ich mich gleich gefragt, ob das denn wirklich
so sei, dass der moderne Westen „klar und eindeutig“ sei und deshalb Bonaparte die
Mamelucken besiegt habe. Ich denke die vielen, relativ preiswerten, schnell nachzu‐
ladenen Schusswaffen spielten dabei eine gewisse Rolle und dass Standardisierung
Massenfertigung erleichtert. Dass die Muslime Dinar und Dirham standardisiert
haben, hat den Handel erleichtert. Aber schon der technische Fortschritt des Westens
war weniger Folge von „klar und eindeutig“ wie Bauer meint, als von „trial and
error“, Vorläufigkeit, Nichtabgeschlossenheit das Besser‐Machen (ohne auf das
einzige wahre Optimum zu warten) brachte den Westen nach vorn, nicht „Ornament
ist Verbrechen“, wie Bauer schreibt, sonst hätte es unter Wilhelm II keinen Fortschritt
bei der Stahlproduktion gegeben, sondern erst in den 1920er Jahren.
Was Bauer hier schreibt entspringt nicht eigenem Studium oder eigenem Denken,
sondern stammt von Herren, die vor allem Frankreich studiert haben. Hass auf
Andersdenkende (Bartholomäusnacht und Henri IVs Ermordung) sind aber nicht
Bedingung für Meter, Gramm, Liter und Nullmeridian. Nicht Louis Vertreibung der
Arno Schmitt
4
Hugenotten (Edikt von Nantes) sondern Colberts Schiffskanäle und die Abschaffung
der Binnenzölle steigerten Frankreichs Bruttosozialprodukt. In Deutschland brachten
Zollunion, Mittellandkanal, Reichsmark, und MEZ Produktionszuwachs auch ohne
konfessionelle Homogenisierung und Zentralisation. Nicht die „Preußische Union“
von Lutheranern und Calvinisten machte Preußen reich und „modern“ sondern die
katholischen Kohlen in Schlesien und an der Ruhr. Bauer muss ja nicht historischer
Materialist werden, aber sein Überbaugedusel ist schon sehr idealistisch.
Wenn er schreibt, dass die „Ökonomie besonders ambiguitätsintolerant“ (58) sei,
dann hat er sich nichts dabei gedacht. Nach meinem Verständnis ist es genau umge‐
kehrt: der Markt lebt davon, dass Samsung und Apple, Windows und MacOS, BMW
und Daimler nebeneinander existieren und nicht einer einzig recht hat. Nimmt man
den Wettbewerb von FAZ und Süddeutscher, von Grünen und Piraten dazu, sieht
man, dass „der Westen“ doch nicht so rigide und unflexibel ist, wie Bauer ihn dar‐
stellt. Erst kurz vor Schluss räumt er ein, dass „polyphone Musik, ... Opern ... und
Demokratie“ Leistungen des Westens seien, die nicht „klar und eindeutig“ seien;
doch seien Erstere marginal und die Demokratie „von Hekatomben von Opfern
gesäumt“ (403). Ich vermute, dass sich auf diesen Seiten Diskussionen mit Menschen
niedergeschlagen haben, die mehr vom Westen verstehen als Bauer, dass er mit
diesem Eingeständnis aber schon die Grenze seiner Einsicht in Positives am Westen
erreicht hat. Meiner Ansicht nach wäre das Buch viel besser, wenn es mehr hätte von
Dingen, die Bauer gut kennt, und weniger über den Westen.
Bauer schreibt immer wieder von den vier Rechtsschulen, obwohl er andere als die
vier erwähnt, u.a die von Abu Thaur (171); dabei passiert ihm ein Fehler: er spricht
von „dem Ẓāhiriten Abu Dāwūd“ (170). Erstens heißt der Mann D. und nicht Abū D.,
zweitens ist das der Gründer der Schule, die deshalb auch Dāwūdīya heißt. Bei zehn
nebeneinander existierenden Schulen von Zweideutigkeit zu sprechen, scheint mir
so schief wie bei 28 Koranlesarten. Oder sollte Bauer mit „ambi“ gar nicht „ambi“
sondern „pluri“ meinen?
Qirāʾāt
„Gleichzeitig spricht man auch bei einer einzelnen Textstelle, die in verschiedenen Ver‐
sionen unterschiedlich lautet, von einer qirāʾa.“ (62) Das stimmt nicht: nicht die Text‐
stelle nennt man qirāʾa, sondern ihre Varianten nennt man qirāʾāt. Für einen Deutschen
ist die Sache eigentlich ganz einfach: sowohl eine festgelegte Klanggestalt des ganzen
Koran nennt man „Lesart“, wie die einer Stelle. Nur weil im Englischen bei der Stelle
von „variant“ und beim ganzen Koran von „reading“ geredet wird, kommt Bauer
durcheinander. Der Vollständigkeit halber: qirāʾa hat nóch eine Bedeutung: Lesung/
Rezitation/Verklanglichung, also die Aktualisierung des Textes (performance).
„das Bewusstsein von der Pluralität der qirā´āt hat durch die Einführung des Buchdrucks
einen schweren Schlag erlitten. Im Jahre 1344/1925 wurde in Kairo der Koran in der Lesung
»Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim« gedruckt. Diese Ausgabe hat sich rasch in der gesamten islamischen Welt
inamo Dossier Islam Bauer Ambiguität
5
durchgesetzt.“ (95) „Der historische Zufall, daß sich die »Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim«‐Lesung im
Gefolge des Osmanischen Reiches weithin ausgebreitet hat und schließlich dank des
Buchdrucks in der Praxis eine Monopolstellung erlangte, ...“ (108)
Das stimmt so nicht. Es ist kein historischer Zufall, dass das osmanische Reich und
das Moghulreich die ḥanafitische/kufische Rechtschule annahmen, weil diese Reiche
(für das osmanische zumindest über lange Zeit) nur eine Minderheit von sunnitischen
Einwohnern hatten und deshalb die Rechtsschule wählen mussten, die die Anders‐
gläubigen am wenigsten diskriminiert. Und so wie die Mālikiten letztlich eine Lesung
aus Medina bevorzugen, so die Ḥanafiten eine aus Kufa. Ob das entscheidend war
oder die Tatsache, dass ʿĀṣims Lesung näher an der Standardaussprache des Arabi‐
schen ist als andere Lesungen, dass man also auf weniger Widersprüche zwischen
den Grammatik‐Büchern und den Koran‐Vortragsbüchern stößt, und deshalb gerade
Türken, Moghulen, Perser, Inder und Indonesier sich für die leichteste Lesung
entschieden, kann offen bleiben.
Es ist aber nicht bloßer Zufall und der Buchdruck tat wenig zum Zurückdrängen der
anderen Lesarten. Bauer müsste nachweisen, dass vor 1830 (dem Beginn des Drucks
von Koranen in der islamischen Welt) der ʿĀṣim‐Anteil geringer war als danach, und
nach 1925 nochmal größer als davor.
Falsch ist auch, dass sich der Kairiner Ausgabe von 1344/1925 oder die von 1342/1924
„in der gesamten islamischen Welt durchgesetzt“ hat. Bis heute sind die indo‐pakista‐
nische Ausgaben der Tāj Compagny (einschließlich der Nachdrucke) die meist gekauf‐
ten, wenn auch die von ʿUthmān Ṭāhā (http://en.wikipedia.org/wiki/Uthman_Taha) mit
der Seiteneinteilung einer osmanischen Vorlage (604 Seiten ohne einen einzigen Vers
zerreißen zu müssen) nach der Orthographie der Kairiner Ausgabe von 1952 geschrie‐
bene die meistverschenkte Ausgabe ist.
Was man leicht beweisen kann, ist, dass CD, DVD, Internet und Buchdruck in den
letzten 30 Jahren mehr zur Verbreitung von anderen Lesarten als Ḥafṣ nach ʿĀṣim
getan haben als alle Religionsschulen in den 1000 Jahren davor.
(http://easyquranstore.com/tajweed‐quran‐in‐other‐narrations‐rewayat/)
Nebenbei: Bevor die „Marokkaner“ die Lesung nach Warsch von den „Tunesiern“
übernahmen, hatten sie nach Hamzah aus Kufa gelesen. Aber diese inner‐maghre‐
binische Vereinheitlichung hat nichts mit dem Buchdruck zu tun.
Kapitelendnoten
Für den Leser, der Bauers Gedankengänge nachvollziehen will, ist das Buch eine
Unverschämtheit. Der Autor schreibt: „Der Leser sei versichert, daß Anmerkungen
auf nichts verweisen als auf Quellen‐ und Literaturangaben ... Ihm entgeht also
nichts inhaltlich Wichtiges, wenn er eine entspannte Lektüre permanentem Nach‐
schlagen vorzieht.“ (25) Oft bieten die Kapitelendnote keine Primärquelle für die
Behauptung, sondern irgendeinen Feuilletonisten, der Bauers Meinung schon früher
vertreten hat. Ob man dort Quellen findet, weiß man nicht. Bei arabischen Texten
gibt Bauer die Seite nach einer beliebigen Ausgabe an. Würde er zusätzlich kitāb, bāb,
Arno Schmitt
6
faṣl angeben, könnte man die Stelle in jeder Ausgabe finden. Noch praktischer wäre
ein Originalzitat. Aber weil fürs große Publikum geschrieben, verzichtet Bauer auf
die Nachvollziehbarkeit. Ich kann nicht glauben, dass Fußnoten einen so großen
Abschreckungseffekt haben. Dann könnte man ja auch gleich auf diakritische Punkte
in der Umschrift verzichten.
Und Bauer hält sich nicht mal an seine Versicherung. Der folgende Satz ist doch wohl
weder eine Quellen‐ noch eine Literaturangabe: „Die Begriffe »Homosexualität«
(Erstbeleg 1869) und »Heterosexualität« (Erstbeleg 1880) gehen auf Karl Maria Kert‐
beny (1834‐1882) zurück“ (421) – Das ist (selbstverständlich) falsch und zeigt, dass
Bauer jeden Unsinn glaubt. In der deutschen Wikipedia ist sowohl unter „homo‐
sexuell“ wie unter „Karl Maria Kertbeny“ der Erstbeleg für beide Begriffe abgebildet.
„Natürlich“ hat Kertbeny sich die Begriffe gleichzeitig ausgedacht.
A propos „gleichzeitig“: Im Theoriekapitel schreibt Bauer, dass wenn „in einer Stadt“
zur gleichen Zeit eine „Bevölkerungsgruppe“ eher zum Heiler geht und eine andere
zum Mediziner, dann sei das nicht „gleichzeitig“ – „gleichzeitig“ sei nur, wenn die
gleichen Menschen beide Heilmethoden akzeptieren. Abgesehen davon, dass dann
viele seiner Beispiele aus dem nahöstlichen Bürgertum seine Grundthese gar nicht
stützen, denn sehr viele Ḥambaliten akzeptierten weder Schiiten noch Sufis, finde ich
Definitionen, die dem Grundsinn des Wortes widersprechen, nicht Erkenntnis
fördernd.
Lust
Weil das Buch sich an das große Publikum wendet, greift Bauer oft Kollegen an,
ohne deren Namen zu nennen, oder er schreibt von anderen ab, ohne irgendwie
anzudeuten, dass das nicht auf seinem Mist gewachsen ist.
Zum Komplex mann‐männliche Sexualität und Erotik erwähnt er nur Massad und
Klauda, von denen einer gar keine Quellen studiert haben kann, weil er kein
Arabisch kann. Dass Everett K. Rowson und ich seit über zwanzig Jahren Grund‐
legendes dazu geschrieben haben, bleibt genauso unerwähnt wie die Arbeiten von
Frédéric Lagrange, Dror Ze’evi und Khaled el‐Rouayheb; letztgenannter hat viel
genauer erklärt, wieso verschiedenartige Diskurse zu dem, was wir als éine Sphäre
ansehen auf arabisch nebeneinander existieren.
Bemerkenswert auch, dass Bauer, den Hauptgedanken der von ihm erwähnten Bücher
nicht versteht: Dass es nämlich im „vorkolonialen“ Denken und Schreiben der Araber
weder den Begriff noch das Wort „Homosexualität“ gibt, dass also bei ihnen der
Bereich des Lebens, den wir heute als „Sexualität“ bezeichnen, anders strukturiert
war. Massad: Durch ihre Gerede über Homosexuelle, wo es bis dahin keine Homo‐
sexuellen gegeben hat, heterosexualisiert die Schwule Internationale (Amnesty Inter‐
national und schwule Menschenrechtsorganisationen) eine Welt, die bis dahin von
Homosexuellen und Heterosexuellen nichts wusste. Die Wirkung ist in der musli‐
misch‐arabischen Kultur alles andere als befreiend: Männer, die bei mann‐männ‐
lichem Sex als passiv oder aufnehmend gelten, werden gezwungen, ... sich als homo‐
inamo Dossier Islam Bauer Ambiguität
7
sexuell oder schwul zu identifizieren, und die eindringenden Männer müssen sich
auf éine Art von Objekten, Männer oder Frauen beschränken. So werden aus ihnen
Heterosexuelle, weil sie sonst in den Begriffen, die ihnen die Schwule Internationale
einzig lassen, zu Anormalen werden, mit allen Nachteilen, die das bedeutet. Public
Culture 14(2): 383f. – Während im modernen westlichen Denken ein Mann einen
Mann lieben kann, die miteinander Sex machen, kann im traditionellen, mediter‐
ranen, patriarchalischen Denken ein Mann nur mit einem Nicht‐Mann (Tunte, Trans‐
vestit, Knabe, Mädchen, Frau) Sex machen (die Unzahl von Verben sind alle transitiv:
schlagen, besteigen, reiten, ficken…).
Für zāniya benutzt Bauer das deutsche „Ehebrecherin“ (282), obwohl weder die zāniya
noch ihr Partner verheiratet sein müssen, demzufolge keine Ehe brechen – und aus
dem Text, wie Bauer ihn uns vorstellt – geht auch nicht hervor, dass die zāniya eine
Ehebrecherin gewesen sei. Zugegeben: „Geschlechtsverkehr mit einer Person, mit der
man dazu nicht das Recht hat“ ist deutlich länger und holpriger als „Ehebruch“ aber
wenn man genau sein will, darf man nicht schlampen.
Bauer bringt das Kunststück fertig, Sexualität als kulturelles Konstrukt aufzufassen
(„es ist keineswegs selbstverständlich, alle Handlungen und Emotionen, die direkt
oder indirekt mit den Geschlechtsorganen verbunden sind, auch untereinader ver‐
bunden sind und ein eigener Bereich der menschlichen Persönlichkeit“ bilden), aber
Homosexualität als kulturübergreifend darzustellen. Das erreicht er dadurch, dass er
zwanzig Mal von einvernehmlichem Sex zwischen Männern spricht auf ein Mal von
Liebe zu einem Jüngling, obwohl wir doch für den Nahen Osten nur von Vergewalti‐
gungen und Päderastie Kenntnisse haben. Dass Sexualität im Westen als „isoliert von
den übrigen Gefühls‐ und Handlungsbereichen“ und „streng getrennt“ (273) ange‐
sehen wird, kann ich nicht finden. Noch seltsamer erscheint mir, dass nach Bauer
„der Westen“ die Sexualität bewusst geschaffen habe, er spricht nämlich von dem
„Projekt [des Westens], eine von allen Bereichen menschlichen Erlebens geschiedene
Sphäre der »Sexualität« zu etablieren“ (274). Richtig ist, dass man ein Kraulen der
Brustbehaarung im Dekolté und eine Vergewaltigung zwecks Erniedrigung nicht in
einen Topf werfen muss, aber komisch finde ich, dass Bauer nur zwischen Sexualität
und Liebe zu unterscheiden weiß; nicht mal zwischen „jemanden für begehrenswert
halten“ und „jmd. begehren“ macht er einen Unterschied. Gewiss, um 1965 macht
sich ein Mann in der BRD schon verdächtig, wenn er die Schönheit eines Jünglings
oder Mannes bemerkte, aber dies ist noch lange kein Begehren oder – was für Bauer
das Gleiche ist – sich in einen Jüngling oder Mann Verlieben. Diese Blindheit für
Aspekte und Grade der Liebe ist umso bemerkenswerter, als Muslime darüber
umfangreiche Bücher verfassten.
Da es Bauer nur darum geht, herauszuarbeiten, dass der Westen den Nahen Osten
moralisch verdorben habe, interessiert ihn nicht, ob es zwischen den Liebestheorien
der islamischen Gelehrten und der westlichen Denker bezeichnende Unterschiede
gibt. Ich jedenfalls halte es für signifikant, dass im Nahen Osten einseitig gedacht
Arno Schmitt
8
wird (ich liebe x, ich begehre x, ich umwerbe x, ich ficke x), im Westen gegenseitig
(ich will, dass x mich begehrt, ich sehne mich danach, von x wahrgenommen zu
werden, ich will mit x ficken). In der reifen, westlichen Liebe oszillieren die Rollen‐
zuschreibungen, da liebt man/frau nicht nur ein Objekt, sondern man identifiziert
sich zweitweise mit Anteilen des Andern, man ist (wenigstens phasenweise) aktiv
und passiv. Als historischer Materialist bin ich der Ansicht, dass diese Art Liebe zu
denken erst entsteht, wenn Frauen auch im Betrieb und der Politik Chef sein können.
Ich habe im Heft darauf hingewiesen das Bauers Kronzeuge für sinnenfrohen Sex,
der Imām Ghazālī, genau wie Paulus die Askese über die Ehe stellt; Ibn Qaiyim al‐
Jauziya weist eine andere Parallele mit dem Gründer des Christentums auf: Arsch‐
ficken als Ursache und Folge des Abfalls vom Glauben. Wer Islam und Christentum
vergleicht, sollte beides studiert haben; nach meinem Eindruck hat Bauer das eine
gar nicht und das andere recht selektiv studiert. Er hat bei diesem Teilstudium vieles
entdeckt. Leider schreibt er auch über die Bereiche, die er nicht studiert hat.
„Kapitalistisches Konkurrenzdenken (kKD) und einfühlsame Freundschaften sind
aber schwer miteinander zu vereinbaren.“ (275) Mit keinen Wort erklärt Bauer
warum gerade das kapitalistische KD mit Freundschaft schlecht zusammen geht
oder auch nur wodurch sich kKD von anderem KD unterscheidet. Vorher schreibt er,
dass der Araber „als »agonaler Mensch« charakterisiert werden [muß]. Neben den
bewafneten Kampf der Sippen und Stämme trat der Wettkampf in der Jagd, im
Wettrennen und im Wettschießen. Noch wichtiger war der aber Wettkampf der
Dichter“ (254). Der Araber ist also laut Bauer von Kampfdenken durchdrungen.
Warum verträgt sich arabisches KD mit Freundschaft, aber nicht kKD?
Bauers Behauptung der Bürger habe die Homosexualität erfunden, um als ganz und
gar heterosexuell dazustehen (276), leuchtet mir nicht ein; ich gehe davon aus, dass
es in der fraglichen Zeit (grob 1850‐1950) im Bürgertum mehr Homosexuelle gab als
in der Arbeiterklasse. Schön auch die Behauptung, dass im 19. Jahrhundert Kapitalis‐
mus, Kolonialismus und Psychoanlayse „triumphierten“ (276), obwohl letztgenannte
erst im 20. Jhd. entstand. Und dann kommt eine Formulierung, die „die amerikani‐
sche Forscher“ der Stammtische lässig toppt: „Es ist mittlerweile gut nachgewiesen,
daß die europäische Konstruktion der Sexualität mit dem Imperialismus in einem
innigen Wechselverhältnis steht.“ (277) – sorry, „innig“ habe ich reingeschmuggelt,
aber sonst ist es doch eine Leeraussage; steht nicht alles mit jedem in einem Verhält‐
nis? „Die Macht des Westens griff nun auf jene fernen, exotischen Welten zu, ... wo
ein Sex blühte, der die westlichen Ordnungen des Sexes gefährlich ins Wanken
brachte.“ (277) Der Imperialismus schafft also Imperien, um die westliche Ordnung
des Sexes vor dem Umfall zu schützen. Da sehe ich noch andere Interessen.
Bauer spricht von „Ambiguitätsdimension“ von Sex bzw. Liebe (278), wo er nach
seiner eigenen Definition von Ambivalenz sprechen müsste (38, passim).
inamo Dossier Islam Bauer Ambiguität
9
„Die wichtigste Ursache für Ambiguität ist die Pluralität der Diskurse“ (268f.)
Entweder habe ich Bauer überhaupt nicht verstanden, oder das stimmt so nicht.
Gewiss, verglichen mit heutigen Salafisten waren die Denker des klassischen Islam
Rheinländer. So wie katholische Bischöfe am Niederrhein den Kohlenklau für den
Eigenbedarf freigaben und den Gläubigen erlauben, gegenüber den Ämtern (Jobcen‐
tern) falsche Angaben zu machen, solange Freibeträge und Regelsätze zu niedrig
sind, so galt auch in muslimisch geprägten Nahen Osten „leben und leben lassen“,
„Fünfe gerade sein lassen“ und „beide Hühneraugen zudrücken“. Oder anders gesagt:
Wie der Rheinländer und der italienische Südländer, wusste auch der Levantiner,
dass das Gesetz „auf dem Papier steht“, „das Leben aber das Leben“ ist. Aus diesem
Blickwinkel ist der von Bauer konstatierte Abgrund zwischen Köln und Kairo gar
nicht so tief und nicht so weit.
Merkwürdig auch, dass Bauer die Spannung zwischen zwei wichtigen Grundsätzen
völlig übergeht. In tausenden von Büchern stößt man auf al‐ʾamr bi’l maʿarūf wa an‐
nahy ʿan al‐munkar (das Gute befehlen und vom Bösen abhalten), womit in Saʿudi‐
Arabien die Religionspolizei gerechtfertigt wird. Im klassischen Islam stehen diesem
– unbestrittenen Gebot – gleich drei Regeln gegenüber: die trivialste ist die Erkennt‐
nis, dass es nicht großen Mutes bedarf, einen Schwachen auf seine mangelnde Fröm‐
migkeit hinzuweisen (über die der sich ohnehin klar sein dürfte), dass es also darum
geht, dem Mächtigen, der seine Kompetenzen überschreitet, in die Schranken zu
weisen. Das zweite Gegenmittel ist eine der wichtigsten Tugenden überhaupt: ṣabr
(Geduld), was auch Duldsamkeit gegenüber Sündern einschließt. Schließlich gilt:
Was Gott mit dem Schleier (saṭr) bedeckt hat, soll der Mensch nicht aufdecken. Es
geht also einen gesitteten Bürger nichts an, was im Privaten geschieht; selbst wenn
laute Musik aus einem Haus dringt, berechtigt das niemanden, in das Haus einzu‐
dringen, um zu schauen, ob dort eventuell Wein getrunken wird. Der Fromme darf
zwar seinen Nachbar deswegen ermahnen, aber ohne ihn bloßzustellen. Üble Nach‐
rede ist eine Sünde gegen Gott und die Mitmenschen.
Anders gesagt: Mir besingt Bauer zuviel die hohe „Ambiguitätstoleranz“, buchsta‐
biert sie zuwenig als lebenswirkliche Vielfalt und laissez‐faire aus. Er schaut mir
zuviel in die Bücher, zuwenig in die Häuser, Bäder und Gärten.
Seitenlang führt Bauer aus, dass Christen beim Vollziehen der Ehe keinen Spass haben
dürfen, ohne das irgendwie zu belegen – das einzige Zitat, das er bringt, geht gegen
Empängnisverhütung, nicht gegen Spass dabei.
Und da ich schon bemerkt habe, dass er ein ganz privates verzerrtes Bild von der
Kirche hat, habʹ ich bei Kirchenvätern und Scholastikern, und auch in die Beicht‐
spiegel aus meinem Bücherschrank geschaut. Hier das Ergebnis:
„Habe ich gesündigt durch Mißbrauch der Ehe? durch Mißbrauch mit mir selbst?
durch Rücksichtslosigkeit? durch Mangel an Opferbereitschaft?“ (Gesang‐ und
Gebetbuch, Trier: Paulinus 1955. S. 615)
Arno Schmitt
10
„Habe ich die Pflichten der Ehe verletzt?“ (Schott, Messbuch, Anhang, Freiburg;
Herder, 1929 – 1966 unverändert)
„Achte ich die persönliche Würde meines Ehepartners? Bemühe ich mich, daß unsere
Liebe zueinander wächst? Oder war ich eigensüchtig, rücksichtslos, nachtragend, zu
empfindlich?“ (www.herzmariens.de/Texte/beichte/erwachs.htm)
„Suche ich die Person meines Ehepartners oder sehe ich in ihm nur ein Mittel zur
eigenen Befriedigung?“ (Gotteslob)
Selbst bei den Fundamentalisten ist nur von Empfängnisverhütung die Rede, nie von
unerlaubter Lust in der Ehe.
Bauer macht viel daraus, dass im Westen mit der Natur für und gegen bestimmte
Formen des Sexes argumentiert werde, die Natur sei die Hure der Moral, im Islam
gebe des dergleichen mit „ṭabīʿa“ nicht. Vielleicht sollte er mal unter „fiṭra“
nachgucken.
Kein Lekorat
Komisch, dass bei Bauer einmal die Jurisprudenz vor ash‐Shāfʿī „an der Tradition
des Propheten ausgerichtet“ war (42) und ein ander Mal es Shāfʿīs Werk war, „das
Prophetenḥadīth als Rechtsquelle“ zu etablieren (159). Hat er da zwei unterschied‐
liche (ungenannt bleibende) Quellen zu Rate gezogen? Nach meinem Verständnis
hat die zweite Recht: Vor ash‐Shāfʿī hat man sich an der Praxis der Gemeinde,
dem Koran und vernünftigen Argumenten ausgerichtet.
Falsche Ausdrücke, Wiederholungen, schiefe Bilder stören – der Verlag hat wohl am
Lektorat gespart. Sonst hätte etwa Abū‐Ḥanīfa den Bindestrich verloren. Mir sind
auch viel zu viele „bekanntlich“s, „also“s, „offensichtlich“s und „zweifellos“e drin.
Verglichen mit anderen deutschen ProfessorInnen schreibt Bauer schön, doch es
ginge auch mit weniger Englisch und Latein.
Köstlich sind Formulierungen wie „Unnötig zu sagen, daß“ (270). Bezeichnender ist,
dass Bauer „Ideologie“ für „ambiguitätsfeindlich, klar und totalitär“ (52, 58) hält –
ohne den Begriff zu definieren oder eine Quelle für dieses Verständnis des Wortes
anzugeben. Dass Marx den Begriff als Verschleierung ungerechter Verhältnisse und
als Rechtfertigung von (Klassen‐)Interessen charakterisiert, ist ihm nicht bekannt.
gharīb
Ein ganzes Kapitel widmet Bauer den Fremden im Islam bzw. bei Arabern. Er sagt,
dass es im klassischen Arabisch weder den Begriff noch die Vorstellung von Frem‐
den gegeben habe. Er behauptet, dass Fremdheit im Arabischen nicht objektiv von
außen gedacht ist, sondern als „emotionaler Mangel im sich fremd fühlenden“, dass
Fremd‐Sein „durch kein Wort ausgedrückt werden“ kann. (347) Bauer ist hier auf
seinem Gebiet und er hat das ausführlich studiert, aber ich glaube es trotzdem nicht.
Das gleiche Wort (gharīb) wird nämlich nicht nur auf Menschen angewandt, sondern
auf alles mögliche, zum Beispiel auf Worte im Koran, und von denen glaube ich nicht,
inamo Dossier Islam Bauer Ambiguität
11
dass sie sich in ihrer Umgebung nur fremd fühlen; im Wörterbuch steht: seltsam, auf‐
fallend, ungewöhnlich, wunderlich, eigenartig, sonderbar, grotesk, schwer verständ‐
lich, dunkel, entlegen, ausgefallen, gekünstelt, maniriert. [Noch zweimal wäre das
Wort in anderem Kontext von Bauer zu nennen: Ein Spruch des Propheten, der nur
von einem übermittelt wird, heißt so (und nicht wirklich shadhdh wie Bauer schreibt),
und ein Soldat, der aus einem anderen Regiment abkommandiert wird, mag sich
zwar fremd fühlen, aber der wird vor allem wie ein Fremder behandelt.] Heute zumin‐
dest benutzen die Araber Jerusalems das Wort genau wie wir, wenn sie von Fremden
reden, manchmal benutzen sie auch al‐Khalaila (die Hebroner), so wie ein Bayer von
„Preißen“ spricht; der Bewohner Marrakeschs hat ein bemäntelndes und ein klares
Wort für den Zugezogenen: Marrakschī (denn er selbst heißt nach dem Beinamen „die
Prächtige“ Bahjawī) und Barrānī (der Auswärtige). Besonders „freundlich“ ist die
ramallahesische Bezeichnung Tailandi für einen Gastarbeiter aus dem Norden der
Westbank oder die Bairuter für Dienstmädchen gleich welcher Herkunft: Srilankiya.
Wem das nicht klassisch genug ist, Barbar/ʿajamī ist es gewiss. Man muss schon eine
sehr rosa getrübte Wahrnehmung haben, wenn man ernsthaft meint, der „klassisch‐
islamische“ Araber sei ohne Ausgrenzung ausgekommen. Nur lief bei ihm die
Abgrenzung eher über Verwandtschaft (fremdstämmig) und über Religion (anders‐
gläubig, ungläubig, ketzerisch).
Ich muss noch erwähnen, warum Bauer die Frühzeit ausklammert. Es geht ihm ja
darum, einen Vielfalt‐duldenden Islam zu besingen, in dem es weniger ja‐nein gibt
als sowohl‐als‐auch, weniger richtig als wahrscheinlich. Nun ist es aber so, dass die
Dogmatiker immer und überall – oder vorsichtiger gesagt: im Westen wie im Nahen
Osten – eher auf ja‐nein beharren und die Juristen sich überall mit Mit‐an‐Sicherheit‐
grenzender‐Wahrscheinlichkeit zufrieden geben. Indem Bauer die Frühzeit, in der
Glaubensfragen eine große Rolle spielten, links liegen lässt, und díe Epoche heraus‐
stellt, in der Juristen den Ton angaben, erscheint der Islam als weicher. Die vielen
Fälle, in denen in Bauers Mittelalter Gelehrte ins Gefängnis kamen, wegen schiʿiti‐
scher, anthropomorpher oder sonstiger Abweichungen, lässt er – natürlich – uner‐
wähnt. Auch sonst ist er selektiv blind. Die Muʿtaziliten, „angeblich rationalistische“
Lieblinge des Westens, seien „rigoros“ für die ewige Hölle gewesen, wo hingegen
beim sunnitischen Hauptstrom alle Muslime im Paradies Sex haben. Das Argument
der Muʿtazila unterschlägt er: Wenn ein Christ wegen der Sünde des Unglaubens
ewig brennen muss, dann ist es doch nur gerecht, dass ein Muslim wegen unbereu‐
tem Lustmord ewig bestraft wird. Er tut so, dass die Rationalität der Muʿtazila nur
orientalistische Propaganda war, und den Wert von Gerechtigkeit gegenüber gött‐
licher Tyrannei erkennt er nicht. Er tut auch so, als habe man im postformativen
Islam alles und jedes unglauben dürfen. Die Lockerheit in manchen Fragen
herauszustellen ist Bauers Verdienst. Leider übersieht er, dass diese Lockheit auf der
sicheren Stellung seiner Protagonisten, den männlichen, sunnitischen Gelehrten,
Bürokraten und Herrschern, beruht und darauf, dass das Dogma/ʿaqīda jeder Kritik
Arno Schmitt
12
entzogen ist, und das ist eine ganze Menge: Gott ist der allmächtige, ewige Schöpfer
und Erhalter der Welt, alle menschlichen Handlungen hat er geschaffen, Muhammad
ist der letzte seiner Gesandten, der Koran sein ungeschaffenes Wort, es gibt Engel,
Geister, Offenbarungsbücher, das Jüngste Gericht, Hölle und das Paradies, die ersten
drei Kalifen waren rechtgeleitet … Während es in der formativen Phase noch Mani‐
chäer und Skeptiker gab, und während man im modernen Europa Alles in Frage
stellen kann, war das im Nahen Osten durchaus anders. Natürlich unterschlägt
Bauer, dass das Dogma zu akzeptieren ist, ohne es verstehen zu wollen (bilā kaif),
und dass nach Ibn Ḥambal das Offenlassen von Glaubenspunkten noch schlimmer
ist, als Falsches zu glauben. Nur so kann Thomas Bauer die Position heutiger saʿudi‐
scher Gelehrter als völlig von der Tradition abgeschnittene, westliche Haltung –
wenn auch mit anderem Inhalt – darstellen. Er macht des Guten zu viel.
Zur Umschrift
Aufmerksame Leser werden bemerkt haben, dass ich bei der Umschrift versuche, die
arabische Hochlautung wiederzugeben und nicht die Schrift. Die Wiedergabe der
Schrift (Transliteration) ist nur dann sinnvoll, wenn die Leser mit der arabischen
Schreibung vertraut sind, aber arabische Lettern technisch nicht zur Verfügung stehen;
für Bibliothekare empfehlen einige ein Mischsystem. In allen anderen Situationen
führen nur Dummheit oder gedankenloser Traditionalismus zu inkonsequenten
Umschriften, wie Ḥanbal obwohl Ḥambal gesprochen wird (mb wird auf Arabisch
immer nūn + bāʾ geschrieben und „unbewegtes“ nūn + bāʾ wird immer mb gespro‐
chen). Bauer liefert viele Beispiele inkonsequenter Umschrift. Der Gipfelpunkt der
Verschmocktheit: „ich füge den arabischen Text hinzu; um einen akustischen Eindruck
vom Klang des Originals zu bekommen, muß ... ‐an als ā ausgesprochen werden.“
(120). Warum schreibt er dann nicht ā – zumal im Arabischen ā geschrieben wird?
Noch ein Beispiel: gharībun bi‐hādhihī l‐bilādi ghurbataini (344); am Ende von hādhihi ist
weder ein ī/yāʾ geschrieben, noch wird hier ein langes ī gesprochen. Ich weiß, dass
Bauer nicht der einzige deutsche Orientalist ist, der so verfährt. Dennoch ist es
grottenfalsch.
Arno Schmitt
Berger, Lutz: Überlegungen zu Thomas Bauer. Kultur der Ambiguität, Kiel 2018.
doi:10.21941/berger.ueberlegungenzuthomasbauer
Überlegungen zu Thomas Bauer:
Kultur der Ambiguität
Thomas Bauer war, wenn ich es richtig sehe, der erste, der in der
Nahostwissenschaft die Frage nach Ambiguität und Ambiguitätstoleranz nicht nur gestellt, sondern auch umfassend zu beantworten
gesucht hat. Er hat damit ein ganz neues Forschungsfeld eröffnet.
Dieses Forschungsfeld ist ohne jeden Zweifel ausgesprochen fruchtbar. Das Nachdenken über Ambiguitätsphänomene in den Gesellschaften des Nahen Ostens und darüber hinaus führt mich nicht immer zu den gleichen Ergebnissen wie Thomas Bauer. Spannend ist es
in jedem Fall.
„Die Kultur der Ambiguität“ wartet mit zwei klaren, eindeutigen
Thesen auf. Zum einen wird postuliert, dass die vormoderne Kultur
der islamischen Welt über eine ungewöhnlich große Toleranz gegenüber dem Uneindeutigen verfügt habe. Zum anderen wird dargelegt,
dass diese Toleranz im Kontext der Begegnung mit dem imperialistischen Westen im 19. und 20. Jh. verloren gegangen sei.
Thomas Bauer verweist selbst darauf, dass seine Untersuchung sich
vor allem auf den ägyptisch- syrischen, jedenfalls ostarabischen
Raum in der Zeit zwischen 900 und 1500 beziehe. Das könnte misstrauisch stimmen. Wäre man andernorts in der islamischen Welt auf
anderes gestoßen? Ich glaube nicht, dass eine geographische Ausweitung des Blicks zu signifikant anderen Ergebnissen geführt hätte als
denen, die Bauer vorgelegt hat. Sicher haben wir es mit sozioökonomisch durchaus ungleichen Gesellschaften zu tun. Auch gab es überall unterschiedliche kulturelle Sub- und Adstrate. Doch ist das hier
relevant? Nein, die Eliten der Welt zwischen Hindukusch und Atlantik
standen in zu engem Austausch, als dass ihre Schriftkulturen, die im
Mittelpunkt von Thomas Bauers Interesse stehen, sich radikal voneinander unterschieden hätten.
Ich möchte im Folgenden eine Reihe von Fragen in den Raum stellen,
die mir bei der Lektüre von Thomas Bauers Buch in den Sinn gekommen sind. Die Fragen, die ich stelle, wie die Überlegungen, die ich daran anschließe, bleiben ganz vorläufig. Manches von dem, was ich
sage, wird offenkundig widersprüchlich sein. Ich muss Sie folglich
bitten, mit der Ambiguität meiner Ausführungen ebenso nachsichtig
umzugehen, wie es mittelalterliche muslimische Gelehrte getan hätten.
1
Berger, Lutz: Überlegungen zu Thomas Bauer. Kultur der Ambiguität, Kiel 2018.
doi:10.21941/berger.ueberlegungenzuthomasbauer
Im Einzelnen möchte ich folgende Fragen mehr aufwerfen, als dass
ich sie beantworte:
1. Bestand im Vorderen Orient in der untersuchten Epoche eine
Ambiguitätstoleranz wie von Bauer beschrieben?
2. Warum verfügten die Menschen in vorderorientalischen
Gesellschaften der untersuchten Epoche über große
Ambiguitätstoleranz?
3. Ist Ambiguitätstoleranz ein spezifisch vorderorientalisches
Phänomen?
4. Warum ist die ehedem große Ambiguitätstoleranz im
Vorderen Orient verloren gegangen?
1. Bestand im Vorderen Orient in der untersuchten Epoche eine Ambiguitätstoleranz wie
von Bauer beschrieben?
Die Freude an literarischer Ambiguität, auf die Thomas Bauer verweist, erscheint unzweifelhaft. Ähnliches gilt, wenn auch der Natur
der Sache nach in geringerem Maße, für die Ambiguität des islamischen Rechts. Hier konnte man im Detail unterschiedlicher Ansicht
sein. Im Wesentlichen war das nicht der Fall und wäre auch nicht
praktikabel gewesen. Das islamische Recht hätte dann tatsächlich jener willkürlichen, unberechenbaren Kadijustiz entsprochen, die Max
Weber irrtümlich unterstellt. Was Recht war, war im Wesentlichen
eindeutig. Allein im Detail war Gottes Wille nicht immer recht zu erkennen. Man ging aber doch meist davon aus, dass dieser Wille nicht
zweideutig sei. Muslimische Gelehrte sagten zwar: kull mujtahid
musîb, d.h. jeder, der sich ehrlich und kompetent um eine Rechtslösung bemüht, hat recht und wird im Himmel seinen Lohn erhalten –
der Gelehrte, der A sagt, genauso wie der, der B sagt. In Wahrheit, so
meinte man aber doch zu wissen, bedeutete das nicht eine Ambiguität
des Rechts, sondern nur, dass wir das einzig Wahre nicht immer zu
erkennen in der Lage sind. Sagt einer A und einer B, dann hat nur einer
von beiden wirklich recht und Gottes Willen erkannt. Und der, so
meinte man, erhält den himmlischen Lohn zweimal.
Im Bereich der Sexualität erscheint auf den ersten Blick die Ambiguitätstoleranz vormoderner muslimischer Gesellschaften besonders
groß. Die frömmsten Gelehrten dichteten zum Lobe schöner Knaben
und, wie ich selbst an anderer Stelle habe zeigen können, auch prak-
2
Berger, Lutz: Überlegungen zu Thomas Bauer. Kultur der Ambiguität, Kiel 2018.
doi:10.21941/berger.ueberlegungenzuthomasbauer
tizierte mann-männliche Sexualität führte, trotz der doch recht klaren Regeln des islamischen Rechts, nicht zur moralischen Verurteilung einer Person. Es ist offenkundig, dass hier zwei unterschiedliche
Normensysteme gleichzeitig Gültigkeit hatten: Das des Islam und das
aus der Antike überkommene System mittelmeerischer Männlichkeitsvorstellungen. Nach diesen war, kurz gesagt, allein relevant,
dass ein erwachsener, freier Mann beim Geschlechtsverkehr immer
die aktive, als männlich definierte Rolle einnahm. Doch haben wir es
hier wirklich mit einem Fall von Normenkollision, von Ambiguität zu
tun? Das scheint mir nicht so sicher. Wenige Dinge erscheinen eindeutiger als die Geschlechterordnung vormoderner (und moderner)
vorderorientalischer Gesellschaften, soweit das Verhältnis von Männern und Frauen betroffen war. Die Lebenswelten von Männern und
Frauen wurden strikt getrennt. Das Verhältnis von Männern und
Frauen wurde, zumindest im städtischen Gelehrtenmilieu, um das es
hier geht, sehr weitgehend an den Regeln des islamischen Rechts
ausgerichtet.
Erotische Verhältnisse unter Männern hingegen folgten den alten
Regeln der Männlichkeit, von denen eben die Rede war. Jeder wusste,
auf welchem Feld er sich gerade erotisch bewegte und jeder musste
sich an die Gesetze des jeweiligen Feldes halten. Wenn erwachsene
Gelehrte sich von Heranwachsenden penetrieren ließen oder Geschmack an Männern fanden, die frei und erwachsen waren, war klar,
dass ein Normbruch vorlag, genauso wie wenn man sich an der Frau
eines anderen vergriff. Sehr viel Raum für Zweideutigkeiten bestand
da nicht.
Eine Normenkollision bestand also nur, wenn wir das Verhältnis zur
eigenen Ehefrau und das eines Gelehrten zu einem männlichen Jugendlichen als Teil der selben Sphäre betrachten. Ich glaube nicht,
dass das der vormodernen nahöstlichen Realität gerecht wird.
Vorsicht scheint mir auch geboten, wenn es um das Verhältnis zu den
Fremden geht. Es stimmt, dass das von Bauer untersuchte Wort für
den Fremden, gharîb, eine andere Note hat als unser Begriff „Ausländer“. Man konnte den Fremden, gegen den man Feindschaft hegte,
nicht gut mit diesem Wort bezeichnen. Ghurba, das abstrakte Substantiv zu gharîb, fremd, bezeichnet die selbst empfundene Fremdheit, die Unbehaustheit in der Welt, nicht den Umstand, dass jemand
Eindringling ist. Insofern würde ich Bauer gerne folgen. Aber gab es
gar keine Vorstellung vom Fremden im negativen Sinn, die ihn als jemanden kennzeichnet, den man ablehnt, weil er nicht dazu gehört?
3
Berger, Lutz: Überlegungen zu Thomas Bauer. Kultur der Ambiguität, Kiel 2018.
doi:10.21941/berger.ueberlegungenzuthomasbauer
Was ist mit 'ajam, Nichtaraber, oder ajnabî, Stammfremder – später
auch im allgemeineren Sinne für jemanden, der nicht dazu gehört,
gebraucht? Was ist mit kâfir, Ungläubiger? Pauschalisierte man hier
nicht? Sagte man nicht, ohne weiter zu differenzieren, al-kufr umma
wâhida, der Unglaube ist eine einzige Gemeinschaft? Gab es keinen
Rassismus? Doch, es gab ihn; oft war er übernommen aus antiken
Quellen und fand schriftlichen Niederschlag nicht zuletzt in Handbüchern zum Sklavenkauf oder in aus der Sicht der Zeit wissenschaftlichen Völkercharakteristika. Mir scheint der Abschnitt über die Fremden ein wenig zu sehr auf den Begriff des gharîb und den unaufgeregt
toleranten Reisebericht des Ibn Fadlân konzentriert und andere Formen von Literatur, religiöse wie weltliche, zu wenig in den Blick zu
nehmen.1
2. Warum verfügen die Menschen in vorderorientalischen Gesellschaften der untersuchten Epoche über große Ambiguitätstoleranz?
Lag das am Islam? Im Titel von Bauers Werk ist von „eine(r) andere(n)
Geschichte des Islam“ die Rede. Gemeint ist aber gerade nicht der Islam, sondern die Kultur — ja die Kulturen — vorderorientalischer
Gesellschaften, die mit dem Islam gleichzusetzen oder die als einzig
und allein von religiöser Normativität geprägt zu schildern ja gerade
nicht Thomas Bauers Anliegen ist.2 Er verweist zu Recht immer wieder auf die Präsenz anderer, konkurrierender Systeme von Normativität und Sinnstiftung in den von ihm untersuchten Gesellschaften.
Thomas Bauer untersucht nicht allein Pluralität von Sinnstiftung,
sondern vielfältige andere Phänomene von Ambiguität in vorderorientalischen Kulturen. Der Vordere Orient ist durch den Islam geprägt,
das steht außer Frage, aber der Islam ist immer nur ein Element unter
vielen. „Islam“ ist darüber hinaus ein stets neu ausgehandeltes Geflecht von Bedeutungen. Inwiefern ist die Ambiguitätstoleranz vorderorientalischer Kulturen ein Ergebnis von Islam (von Religion)? Inwiefern spielen andere Dinge hier eine Rolle? Mir scheint, dass diese
Frage noch näherer Erörterung bedarf.
1
Eine kleine Bemerkung am Rande sei noch erlaubt: Ich hätte mir gewünscht, dass Fuat
Sezgins Thesen über die angebliche muslimische Entdeckung Amerikas vielleicht ein wenig
vorsichtiger referiert worden wären.
2
Thomas Bauer wird im Zweifel, wie jeder Autor eines größeren Verlages, ohnehin nicht
unbedingt selbst für den Titel verantwortlich zeichnen
4
Berger, Lutz: Überlegungen zu Thomas Bauer. Kultur der Ambiguität, Kiel 2018.
doi:10.21941/berger.ueberlegungenzuthomasbauer
Ich glaube, es ist in diesem Kontext wichtig, die Felder, in denen Ambiguitätstoleranz postuliert wird, in den Blick zu nehmen. Ambiguitätstoleranz herrschte im Bereich der Einzelfragen der Religion, vor
allem soweit diese politisch ungefährlich waren, vielleicht im Bereich
der Sexualität, soweit sie nicht erbrechtlich relevant war, in einer Literatur, die nicht unbedingt als littérature engagée angesehen werden
kann. Die Freude am sprachlichen Spiel, der Stolz auf besonders eleganten Ausdruck, am Überraschenden ist gerade da besonders groß,
wo die elegante Form im Mittelpunkt stehen kann, wo man l'art pour
l'art betreibt und nicht die Notwendigkeit der Übermittlung einer
Botschaft die Freude an der Form erstickt.
Alles, was mit politischer Macht, mit Besitz, mit sozialem Status zu
tun hatte, war keinesfalls Gegenstand einer besonderen Toleranz gegenüber Zweideutigkeiten. Die strikte Trennung von männlichen und
weiblichen Sphären, von der oben bereits die Rede war, diente der
Vermeidung jedweder Ambiguität in Hinblick auf Unterhalts- und
Erbansprüche.
Ich würde daher postulieren, dass die Freude an der Ambiguität und
die Vielzahl der Felder, in denen sie zum Ausdruck gebracht werden
konnte, etwas zu tun hat mit der Trennung der Sphäre der Intellektuellen und Gelehrten, die Bauer untersucht, von der der politischen
Macht, die er nur am Rande behandelt. Ambiguitätsfreude der Intellektuellen ist Ausdruck des weitgehenden Fehlens einer überregionalen politischen Öffentlichkeit, einer gelehrten Debatte über Macht
und Politik. Über Machtfragen entschied in der Regel das Schwert,
nicht die öffentliche Meinung der Gelehrten.
Die Bereitschaft, in politisch relevanten Fragen Meinung und Gegenmeinung öffentlich und gleichberechtigt nebeneinanderzustellen
und die damit zusammenhängende Ambiguität auszuhalten, war, soweit ich sehe, in vormodernen Gesellschaften generell, jedenfalls
aber in den islamischen Gesellschaften der Epoche, die Thomas Bauer
in den Blick nimmt, selten so groß wie in der klassischen europäischen Moderne, die doch in unserer Postmoderne gemeinhin gerade
auf Grund ihres Drangs nach Eindeutigkeit kritisiert wird. Was könnte
von größerer Toleranz gegenüber widersprüchlichen politischen
Wahrheitsansprüchen zeugen als das so moderne Konzept von „Her
Majesty's loyal opposition“?
5
Berger, Lutz: Überlegungen zu Thomas Bauer. Kultur der Ambiguität, Kiel 2018.
doi:10.21941/berger.ueberlegungenzuthomasbauer
3. Ist Ambiguitätstoleranz ein spezifisch vorderorientalisches Phänomen?
Ich würde auf den ersten Blick die These unterstützen, dass im Vergleich mit westeuropäischen Gesellschaften vorderorientalische tendenziell uneindeutiger waren. Das ergab sich daraus, dass dort in der
Vormoderne zentrale und strukturierte Institutionen der Normierung
von Denken und Verhalten fehlten. Es gab keine Kirche, schon gar
keine Inquisition, der Unterricht war lange Privatsache und blieb
dauerhaft viel stärker von den selbstbestimmten Interessen der Lernenden geprägt als im Westen. Was die höheren Studien angeht, änderte sich das in der Osmanenzeit bald nach 1500, aber nur für die, die
im Staatsdienst Karriere machen wollten.
Was für die intellektuelle Welt galt, galt auch für die Gesellschaft als
Ganzes: Eine Ständeordnung, die jeden in einen vorgegebenen Lebensweg zwang, bestand nicht. Natürlich konnte nicht jeder vom Tellerwäscher zum mächtigen Günstling des Herrschers aufsteigen.
Aber es kann kein Zweifel bestehen, dass die soziale Ordnung deutlich
offener war als in Alteuropa. Das Konzept der Privatheit, das einem
jeden die Möglichkeit gab, in seinem eigenen Bereich zu leben, wie er
es für richtig hielt, verbunden mit dem Respekt vor den privaten Lebensentscheidungen einzelner, war deutlich stärker entwickelt. Unterschiedliche religiöse Gruppen lebten nebeneinander – sicher mit
klarer Rangordnung, aber doch deutlich spannungsfreier als in Westeuropa vor dem 18. Jh. All das schuf Voraussetzungen für Ambiguitätstoleranz, die in Westeuropa so nicht existierten.
Aber können wir mit dieser These sicher sein? Können wir Ambiguitätstoleranz objektiv messen? Ließen sich nicht, suchte man aktiv danach, zahlreiche Beispiele für Ambiguitätstoleranz auch in der alteuropäischen Kultur anführen? Waren westliche Reisende der Mongolenzeit von Wilhelm von Rubruk bis Marco Polo weniger unaufgeregt
als Ibn Fadlân? Konnten Geistliche der mittelalterlichen Kirche sich
nicht für die Literatur der heidnische Antike begeistern oder unzüchtige Vagantenlyrik verfassen? Waren im Hause des christlichen Gottes nicht auch viele Wohnungen, so dass die Pracht der Benediktiner
neben der Armut der Franziskaner stand?
Oder, um den Blick fort von Europa nach Ostasien zu wenden: Finden
sich nicht in den Literaturen Chinas und Japans zahllose Beispiele für
bewusste Unklarheit und Doppelbödigkeit, die denen der muslimischen Literaturen in nichts nachstehen?
6
Berger, Lutz: Überlegungen zu Thomas Bauer. Kultur der Ambiguität, Kiel 2018.
doi:10.21941/berger.ueberlegungenzuthomasbauer
Wenn wir von Literatur sprechen, können wir die Frage stellen, ob logische Stringenz in Handlungsablauf und Charakterzeichnung in
vormodernen Literaturen auch des europäischen Mittelalters stets
eingefordert worden ist. Hat man nicht hier oft Unklarheit und Zweideutigkeit toleriert, einfach, weil die Idee der logischen Stringenz von
Erzählung genauso wenig zwingend ist wie die perspektivische Darstellung in der Malerei.
Gleichviel: Vormoderne Kulturen, so möchte ich in aller Vorsicht formulieren, haben eine Tendenz, bei der Beschreibung der Welt uneindeutig zu sein. Die dauernde Einforderung von Eindeutigkeit, Normierung, Rechenhaftigkeit und das Streben nach dem Aufweis klarer
Kausalbeziehungen in allen Bereichen von Weltbeschreibung und erklärung ist zweifelsohne ein Phänomen der westeuropäischen Moderne genauso wie ihres nahöstlichen Gegenstücks und unterscheidet
beide von den Epochen davor. Die westeuropäische Moderne ist allerdings beim Beschreiben und Beherrschen von Welt erfolgreicher als
die Moderne des Vorderen Orients, weil sie seit dem 17. Jh. die Vorläufigkeit jeder eindeutigen Beschreibung angenommen hat: ein zutiefst
ambiges Konzept. Die Menschen im Vorderen Orient haben Moderne
seit dem 19. Jh. auch als Kontrollverlust wahrgenommen. Sie waren
daher schlechter in der Lage, die Ambiguität, die darin liegt, dass man
einerseits exakt beschreibt, erklärt und normiert, andererseits die
Ergebnisse dieses Prozesses immer nur für vorläufig hält, zu ertragen.
4. Warum ist die ehedem große Ambiguitätstoleranz im Vorderen Orient verloren gegangen?
Ich würde mit Thomas Bauer davon ausgehen, dass die Hauptursache
der massiven Reduktion der Ambiguitätstoleranz in vorderorientalischen Gesellschaften in der Reaktion auf die Übermacht der europäischen Moderne im 19. und 20. Jh. zu suchen ist. In vielerlei Hinsicht
sind ähnliche Prozesse der reaktiven Ambiguitätsreduktion auch in
anderen kolonialen und postkolonialen Gesellschaften abgelaufen.
Doch habe ich den Eindruck, dass der Vordere Orient einerseits — sehen wir von Algerien und Palästina, vielleicht noch Libyen ab — in der
imperialistischen Epoche eher weniger gelitten hat als andere Gesellschaften. Andererseits scheint es, dass die Ambiguitätsreduktion dort
besonders massiv verläuft.
7
Berger, Lutz: Überlegungen zu Thomas Bauer. Kultur der Ambiguität, Kiel 2018.
doi:10.21941/berger.ueberlegungenzuthomasbauer
Wenn man verstehen will, warum das so ist, wird man beim bloßen
Verweis auf die spiegelbildliche Übernahme imperialistischer Muster
nicht stehen bleiben können. Neben vielem anderen erscheint es auch
sinnvoll, dass die Epoche von der Mamlukenzeit bis ins 19. Jh. mit in
den Blick genommen wird, die aus verschiedenen Gründen von
Thomas Bauer nur gestreift wird. Hat vielleicht manches, das uns hier
interessiert, seine Wurzeln nicht in der Reaktion auf den Imperialismus, sondern in den autochthonen Kulturen des Orients in den Jahrhunderten zwischen 1500 und 1800? Ich denke, das ist eine wichtige
Piste.
Dazu nur zwei Beispiele: Die Dynastie der Safaviden hat mit Gewalt
und unter Vertreibung aller relevanten Andersdenkenden, insbesondere der sunnitischen Gelehrtenschicht, Iran nach 1500 zu einem
schiitischen Land gemacht. Derartiges hatte es in der älteren Geschichte des muslimischen Vorderen Orients so gut wie nie gegeben.
Der Imperialismus der europäischen Moderne hat mit dieser Reduktion von religiöser Ambiguität nicht das Geringste zu tun. Ähnliches
gilt für die sogenannten Reformbewegungen im sunnitischen Islam
im 18. Jh. überall zwischen Westafrika und Indien. Die bekannteste
dieser Bewegungen, der Wahhabismus, hat seit dem 18. Jh. — ebenfalls mit brutaler Gewalt — jedwede Form von Ambiguität auf der
arabischen Halbinsel und darüber hinaus zu vernichten gesucht. Der
Konflikt postsafavidisch-schiitischer und wahhabitischer Eindeutigkeit und davon geprägter Identitäten ist in unseren Tagen ein zentrales Element nahöstlicher Krisen und Kriege. Dass religiöse Identitäten dabei nur als ein Faktor neben die Machtinteressen von Iran und
Saudi-Arabien als postimperialistischen Nationalstaaten und anderes mehr treten, ändert daran nichts.
Vieles wäre noch zu Thomas Bauers Überlegungen zu sagen gewesen.
Ich habe ungeachtet des hier Ausgeführten viel aus Thomas Bauers
Buch gelernt. Es sind wichtige Bücher, aus denen man etwas lernt, es
sind auch wichtige Bücher, die zu Widerspruch und Nachfrage anregen. „Die Kultur der Ambiguität“ ist solch ein wichtiges Buch.
(Vorgetragen auf einem Kolloquium in Würzburg im Januar 2016)
8