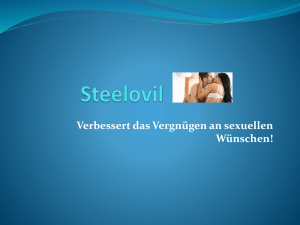See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/274890348 Neuroenhancement zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit im Alltag Chapter · January 2015 CITATION READS 1 3,634 3 authors: Franz Baumgarten Wanja Wolff Universität Potsdam Universität Konstanz 10 PUBLICATIONS 138 CITATIONS 119 PUBLICATIONS 2,311 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Ralf Brand Universität Potsdam 187 PUBLICATIONS 3,215 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: A PsychoNeuroPhysiological Approach to the Self-Regulation of Human Performance View project Boredom (and Sports): Function, Mechanisms, Consequences View project All content following this page was uploaded by Ralf Brand on 04 May 2015. The user has requested enhancement of the downloaded file. Neuroenhancement zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit im Alltag Franz Baumgarten, Wanja Wolff & Ralf Brand Inhalt 1 Einleitung 2 Definition Neuroenhancement 2.1 Substanz- vs. verhaltensorientierte Definition 2.2 Abgrenzung zum Doping im Sport 3 Epidemiologische Befunde 4 Empirische Ergebnisse zur Verhaltensmodellierung 4.1 Einfache Korrelationsstudien 4.2 Komplexere Ansätze zur Verhaltenserklärung 5 Ethische Bewertung 6 Fazit 7 Literaturverzeichnis Franz Baumgarten, Wanja Wolff & Ralf Brand 216 1 Einleitung Der Begriff Leistung prägt die moderne Gesellschaftsform: Menschen und deren Handlungen werden mess- und kontrollierbar, maximale Produktivität zahlt sich aus. Vielleicht um den daraus resultierenden Anforderungen an die eigenen mentalen und körperlichen Kapazitäten besser gerecht zu werden, benutzen Menschen leistungssteigernde Substanzen. Doping, als verbotenes Mittel zur Steigerung der Leistungsfähigkeit im Sport mag schon seit vielen Jahren Ausdruck solchen Geschehens sein. Angesichts der tragenden Rolle des Leistungsbegriffs in der Gesellschaft scheint es deshalb nicht verwunderlich, dass sich die öffentliche Wahrnehmung neuerdings verstärkt auf die Einnahme leistungssteigernder Substanzen in Alltagssituationen richtet. Ein Student trinkt einen Energy Drink, um konzentrierter für die alles entscheidende Abschlussprüfung lernen zu können. Eine Architektin nimmt eine wachmachende Koffeintablette, um eine anstehende Projektfrist einhalten zu können. Ein Chirurg greift zu einem eigentlich verschreibungspflichtigen Medikament, welches aber auch die „Nebenwirkung“ hat, dass es für langanhaltendere Aufmerksamkeit sorgt. Ein Projektmanager schluckt Amphetamine, um im anstehenden Pitch um Auftragsmillionen mit dem nötigen Drive rüberzukommen. Was ist und wo beginnt substanzbedingte Leistungssteigerung im Alltag? Was dürfen oder wollen wir uns leisten und wo sind die Grenzen? Während in den Medien mit dem Begriff “Hirndoping” hantiert wird und Menschen zu “smart pills” oder “brain boostern” greifen, hat sich in der Wissenschaft der Begriff Neuroenhancement für die Beschreibung dieses Verhaltens etabliert. Darunter wird meistens der Gebrauch psychoaktiver Substanzen zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit verstanden (Dietz et al., 2013; Mache, Eickenhorst, Vitzthum, Klapp, & Gronenberg, 2012). Im Wissenschaftsmagazin „Nature“ gaben in einer Umfrage unter Akademikern 20% der Befragten an, mindestens schon einmal derart leistungssteigernde Substanzen ohne medizinische Notwendigkeit benutzt zu haben (Maher, 2008). Laut dem DAK-Gesundheitsreport von 2009 mit dem Schwerpunktthema “Doping am Arbeitsplatz” nutzen rund 5% der Erwerbstätigen regelmäßig in Eigenregie Medikamente, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern (Thielmann, 2009). Beide Beiträge stehen sinnbildlich für ein national und international wachsendes Bewusstsein über dieses Phänomen. Das Ziel dieses Beitrages ist, überblicksartig den aktuellen Stand der verhaltenswissenschaftlichen Forschung zum Thema Neuroenhancement zu beschreiben. Dafür werden, ausgehend von verschiedenen definitorischen Ansätzen, zunächst Neuroenhancement zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit im Alltag 217 einige epidemiologische Befunde zur Verbreitung des Phänomens skizziert. Dann werden empirische Untersuchungsergebnisse vorgestellt, die aktuell zur Erklärung dieses Verhaltens diskutiert werden. Schließlich folgt eine Zusammenschau über die das Neuroenhancement begleitende ethische Diskussion. 2 Definition Neuroenhancement Trotz der zunehmenden Verbreitung, die das Thema in den Medien neuerdings findet, ist man von einer allgemein gültigen, in Fachkreisen allgemein akzeptierten wissenschaftlichen Definition von Neuroenhancement noch ein gutes Stück entfernt. Allerdings besteht Übereinstimmung darin, dass es im Wesentlichen um den Gebrauch von Mitteln bzw. Substanzen geht, die zur Leistungssteigerung in subjektiv belastenden Situationen oder zur Verbesserung eines eigentlich noch „normalen“ Leistungsniveaus eingenommen werden, jeweils ohne dass dafür eine medizinische Indikation vorliegt. Der Ausdruck Neuroenhancement betont neuronale Modifikationen als Basis entsprechender Leistungszunahmen (z.B. Blockierung des präsynaptischen Noradrenalintransports durch Methylphenidat). Die meist synonym benutzte Bezeichnung Cognitive Enhancement verweist demgegenüber auf die kognitiven Zielbereiche solchen Substanzkonsums (z.B. Aufmerksamkeit). Aufgrund der geläufigeren Verwendung wird in diesem Beitrag der Begriff Neuroenhancement bevorzugt. Jedoch beziehen sich folgende Ausführungen gleichermaßen auf beide Fachausdrücke (Neuroenhancement und Cognitive Enhancement). Vorgeschlagene Definitionen reichen von rein substanzorientierten bis hin zu verhaltensorientierten Positionen. 2.1 Substanz- vs. verhaltensorientierte Definition Substanzorientierte Definitionen grenzen den Begriff Neuroenhancement ausschließlich auf den Gebrauch von Mitteln ein, die eine “direkte chemische Veränderung von Gehirnfunktionen” bedingen (Lieb, 2010). Die durch die Einnahme der Substanz ausgelösten physiologischen Veränderungen führen dann zur Verbesserung z.B. der Konzentration, der Wachheit oder Gedächtnisleistung. Diese definitorische Herangehensweise gewänne für den praktischen Gebrauch zum Beispiel dann Bedeutung, wenn der Gebrauch bestimmter Substanzen zur Leistungssteigerung juristisch sanktioniert werden soll. Franz Baumgarten, Wanja Wolff & Ralf Brand 218 Verhaltensorientierte Definitionen verzichten auf das Element, dass eingenommene Substanzen auch wirksam sein müssen. Im Kern dieser definitorischen Herangehensweise steht vielmehr die erwartete Funktionalität, die Konsumenten an eine Substanz knüpfen (Wolff & Brand, 2013). Dementsprechend ist nachrangig, welches Mittel eingenommen wird, sei es nun ein stark koffeinhaltiges LifestyleGetränk oder das verschreibungspflichtige Medikament Ritalin®. Entscheidend ist die subjektive Erwartung der Person, dass die konsumierte Substanz den gewünschten Endzustand der Leistungssteigerung herbeiführen kann (z.B. gesteigerte Konzentration). Demnach könnte auch eine spätnachmittägliche Tasse Kaffee eine Form von Neuroenhancement darstellen. Allerdings nur, wenn sie vor allem deshalb getrunken wird, weil man durch sie die Wachheit und so die eigene geistige Leistungsfähigkeit steigern will. Die Einnahme leistungssteigernder Substanzen sollte in diesem definitorischen Zusammenhang deshalb stets als ein Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele (engl. means-to-end relation; instrumental use) konzeptionalisiert werden. In diesem Sinne wurden auch schon neurowissenschaftliche Technologien, zum Beispiel die transkranielle Magnetstimulation als Neuroenhancement beschrieben (Clark & Parasuraman, 2014). Aus wissenschaftlicher Sicht eröffnen substanzunabhängige Definitionen vor allem Ansätze zur Verhaltensanalyse. Für eine umfassende Betrachtung von Neuroenhancement empfiehlt es sich, beide Perspektiven im Blick zu halten. Unserer Auffassung nach bietet sich jedoch als Grundposition eher die am Verhalten orientierte Definition an, die, wie in Tabelle 1 gezeigt und weiter hinten im Kapitel noch besprochen, wichtige Substanzklassen unterscheiden sollte (Wolff & Brand, 2013). Tab 1: Substanzklassen des Neuroenhancement mit Beispielen Substanzklassen Lifestyle Substanzen Verschreibungspflichtige Substanzen Illegale Substanzen Beispiele Glucose Koffein (z.B. in Energydrinks) Methylphenidat (Ritalin®) Modafinil (Vigil®) Donepezil (Aricept®) Amphetamine Cannabinoide Kokain Neuroenhancement zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit im Alltag 2.2 219 Abgrenzung zum Doping im Sport Am deutlichsten verweist der Begriff “Hirndoping” auf mögliche Analogien von Neuroenhancement im Alltag und Doping im Sport. Die wichtigste strukturelle Übereinstimmung besteht offensichtlich darin, dass es in beiden Bereichen um den Gebrauch leistungssteigernder Substanzen und Methoden geht. Während der Begriff Doping im alltäglichen Sprachgebrauch aber vor allem mit der Steigerung sportlicher Leistung durch eine Verbesserung der zugrundeliegenden körperlichen Fähigkeiten assoziiert wird, bezieht sich Neuroenhancement (bis dato) in erster Linie auf die Verbesserung mentaler Funktionen sowie Verhaltenskontexte, die dezidiert außerhalb der Welt des Sports liegen (z.B. in der Arbeitswelt oder beim Lernen im Studium). Allerdings ist es wichtig zu wissen, dass in bestimmten Sportarten auch kognitiv leistungssteigernde Mittel (beispielsweise Koffein bei den Sportschützen) zu den verbotenen Substanzen zählen, die als Doping verfolgt werden. Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Phänomenen besteht darin, dass die Kategorie Doping im Leistungssport, anders als Neuroenhancement im Alltag, juristisch schon eindeutig bewertet werden kann. Anhand einer jährlich aktualisierten Liste von Dopingmitteln und -verfahren definiert die World Anti-Doping Agency (WADA) den Gebrauch bestimmter Substanzen und Methoden als verboten und sanktioniert entsprechendes Verhalten, wenn es bewiesen werden kann. Diese Rahmenbedingung korrespondiert mit der dargelegten substanzorientierten Herangehensweise an die Definition von Doping. Mit Blick auf Neuroenhancement im Alltag stellt sich die Situation anders dar: Neuroenhancement ist nicht immer juristisch sanktionierbar. Der Besitz, also die nicht verordnete Anwendung und die Verbreitung verschreibungspflichtiger und illegaler Substanzen kann gemäß Arzneimittelgesetz strafrechtlich verfolgt werden (eben dieses Gesetz verbietet in Deutschland gemäß Artikel §6a auch explizit den Einsatz von Arzneimitteln für das Doping im Sport). Manche Varianten von Neuroenhancement hingegen, z.B. wenn Ritalin® ohne ärztliche Verschreibung oder hoch konzentriertes Koffein zur kognitiven Leistungssteigerung eingenommen wurde, stehen eben nicht im Widerspruch zur (in Deutschland) gültigen Gesetzeslage. Unterschiede bestehen zudem insofern, als im Anti-Doping Code der WADA ethische Gründe gegen die Einnahme verbotener Substanzen ausgeführt werden. Diese moralische Argumentation folgt einem breiten gesellschaftlichen Konsens und resultiert in einer ablehnenden Haltung gegenüber Doping im Sport. So setzt die 220 Franz Baumgarten, Wanja Wolff & Ralf Brand WADA-Definition als Grundlage für Doping vor allem auch am Gebot der Fairness an. Diese Voraussetzung folgt dem Grundsatz, dass für alle Sportlerinnen und Sportler gleiche Regeln und gleiche Voraussetzungen gelten sollen (Foddy & Savulescu, 2007). Eine entsprechende ethische Bewertung von Neuroenhancement und daraus resultierende gesellschaftliche Vor- und Nachteile, sind aktuell noch Gegenstand offener Debatten (siehe Kapitel 5). Wo also die Ablehnung von Doping im Sport schon größtenteils auf Zustimmung in der Gesellschaft stößt, trifft dies auf die Verwendung leistungssteigernder Mittel im Alltag als Neuroenhancement nicht zu. Die von der WADA erstellte Liste von Dopingsubstanzen im Sport basiert auf einer konsequenten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Wirkung bestimmter Mittel für die Leistungssteigerung. So fördern beispielsweise anabole Steroide nachweislich den Muskelaufbau (Kicman, 2008) oder steigert EPO nachweislich die Ausdauerleistung (Elliot, 2008). Der leistungssteigernde Effekt vieler Substanzen, die de facto zum Neuroenhancement genutzt werden, kann bei weitem nicht so sicher belegt werden. Interessanterweise wird hier noch diskutiert, ob bzw. weshalb personenbezogene Wirkunterschiede bestehen (Smith & Farah, 2011). Jedenfalls stehen Studien, die auf die nicht vorhandenen leistungssteigernden Effekte der Nutzung von Methylphenidat bei gesunden Personen verweisen (Turner, Robbins, Clark, Aron, Dowson & Sahakian, 2003), neben anderen, die eine Verbesserung der Gedächtnisleistung durch dieselbe Substanz zu belegen scheinen (Repantis, Schlattmann, Laisney, & Heuser, 2010). Noch sehr viel unklarer ist die Existenz langfristiger negativer Auswirkungen auf die Gesundheit. Die gesundheitsschädigende Wirkung vieler im Leistungssport eingesetzter Substanzen ist demgegenüber eindeutig belegt. Sie umfassen physiologische genauso wie psychologische Veränderungen (z.B. durch Steoride; Kicman, 2008). Die zum Neuroenhancement eingesetzten Mittel, insbesondere die der sehr häufig eingesetzten Lifestyle-Substanzen, können mit Blick auf ihre kurz- wie auch langfristigen gesundheitlichen Effekte noch kaum beurteilt werden. Schließlich besteht ein weiterer Unterschied im systemischen Einsatz von Dopingmitteln im Sport. Die Gründe hierfür sind oft tief in den (z.B. gesellschaftlichen) Strukturen verankert, die Individuen unter Umständen in ihrer Entscheidungsfreiheit einschränken. Auch interessengeleitete Stakeholder können einen nicht unerheblichen Einfluss auf die individuelle Dopingmotivation haben. Neuroenhancement ist demgegenüber noch eher ein Verhalten, das mehr oder weniger im Benehmen des Einzelnen liegt. Gleichwohl kann die Einnahme leistungssteigernder Neuroenhancement zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit im Alltag 221 Substanzen sowohl im Sport als auch im Alltag als Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen Situation gesehen werden (Hildt, Lieb, & Franke, 2014; Sjöqvist, Garle, & Rane, 2008). 3 Epidemiologische Befunde Wissenschaftliche Untersuchungen darüber, wie verbreitet das Phänomen Neuroenhancement tatsächlich ist, haben sich bisher fast ausschließlich mit Datensätzen beschäftigt, die an Schulen und Universitäten erhoben wurden. Wenig überraschend ist, dass die Prävalenzraten für Lifestyle-Substanzen am Höchsten ausfallen. Beispielsweise berichten in einer Studie mit 496 US-College Studierenden 33% der Befragten, mehr als einmal im Monat Energiedrinks als Mittel zur Leistungssteigerung zu konsumieren (Malinauskaus, Aeby, Overton, Carpenter-Aeby, & Barber-Heidal, 2007). In einer Stichprobe von 1.324 deutschen Studierenden (Eickenhorst, Vitzthum, Klapp, Groneberg, & Mache, 2012) gaben 89% an, zur Erleichterung des Lernens im Studium Kaffee zu trinken. 11% nutzen Koffeintabletten. Für verschreibungspflichtige Substanzen werden, wenn Untersucher offen und direkt danach fragen, bei College-Studierenden in den USA Lebenszeitprävalenzen von 7% bis 8% und 12-Monatsprävalenzen von 4% bis 6% berichtet (McCabe, Knight, Teter, & Wechsler, 2005; Teter, McCabe, LaGrange, Cranford, & Boyd, 2006). Für Studierende in Deutschland schwanken die entsprechenden Zahlen zwischen 2,5% Lebenszeitprävalenz (Franke, Bonertz, Christmann, Engeser, & Lieb, 2011) und 7% Studienzeitprävalenz (Eickenhorst et al., 2012). Wenn Befragungstechniken eingesetzt werden, in denen Befragte ihr Verhalten nicht direkt angeben müssen, sondern dieses gruppenstatistisch aus dem Gesamtdatensatz erschlossen wird (Randomized-Response-Technik; Warner, 1965), verändern sich diese Zahlen: Für 2.569 Studierende, die in Deutschland auf diese Weise indirekt zur Einnahme von verschreibungspflichtigen und illegalen Substanzen befragt wurden, wurde eine 12-Monats-Prävalenz von 20% berichtet (Dietz, et al., 2012). Dieses Ergebnis entspricht ziemlich genau den eingangs berichteten Zahlen zum Neuroenhancement unter gestandenen Wissenschaftlern (Maher, 2008). Nur illegale Substanzen berücksichtigend (z.B. Kokain), wurden zuletzt Lebenszeitprävalenzen bei Studierenden in Deutschland zwischen 0,25 und 2,3 % berichtet (Franke et al, 2011; Mache et al, 2012). Die genannten Zahlen wirken größtenteils realistisch, sollten jedoch noch vorsichtig interpretiert werden, weil manche Franz Baumgarten, Wanja Wolff & Ralf Brand 222 Untersuchungen methodisch nicht einwandfrei sind. Beispielsweise wird in manchen Erhebungen nicht konsequent in die Abfrage integriert, ob die Substanzeinnahme mit dem primären Ziel der Leistungssteigerung erfolgte. Die deutlich höheren Prävalenzraten, die mit indirekten Verfahren aufgedeckt werden (Dietz et al., 2013), verweisen zudem darauf, dass Personen, wenn sie ihren Substanzkonsum offen angeben sollen, sozial erwünscht antworten. Außerdem sind bisherige Stichproben wahrscheinlich wenig repräsentativ. Es sollte nicht auf die Gesamtbevölkerung rückgeschlossen werden. Deshalb ist es auch wichtig, den aufkeimenden „Medien-Hype“ um das Thema Neuroenhancement nicht unnötig mit unsicheren Dateninterpretationen zu befeuern (Partridge, Bell, Lucke, Yeates, & Hall, 2011). Jedoch verweisen die vorliegenden epidemiologischen Kennziffern darauf, dass der Gebrauch leistungssteigernder Mittel im Alltag definitiv eben kein Hirngespinst ist, sondern ein ernst zu nehmendes und untersuchungswertes gesellschaftliches Phänomen darstellt. 4 Empirische Ergebnisse zur Verhaltensmodellierung Bislang existieren verhältnismäßig wenige Studien, die empirisch illustrieren oder gar erklären könnten, weshalb Menschen zu Neuroenhancement als Mittel der Leistungssteigerung im Alltag greifen. Ergebnisse beruhen größtenteils auf korrelativen Befunden zu Verhaltensmotiven, Stress und Geschlechtsunterschieden. Diese werden zuerst kurz zusammengefasst. Dann folgt eine Skizze über Forschungsperspektiven, die wir für vordringlich halten: Erstens sollten empirische Untersuchungen das Verhalten Neuroenhancement zukünftig in bewährte Verhaltensmodelle einbetten und nicht, so wie bisher überwiegend, als Verhaltensziel per se (als abhängige Variable) konzeptualisieren. Zweitens erscheint es notwendig, methodische (vor allem experimentelle) Untersuchungsparadigmen zu entwickeln, die Ergebnisse jenseits bloßer Verhaltensbeschreibungen ermöglichen. 4.1 Einfache Korrelationsstudien Zur Erklärung menschlicher Verhaltensweisen werden häufig deren zugrunde liegende Motive und Absichten betrachtet. Mit Blick auf den Gebrauch verschreibungspflichtiger Substanzen gaben beispielsweise US-College Studierende den Wunsch nach verbesserter Konzentration und Wachheit an (Teter et al., 2006). Auch unter den in Deutschland befragten Personen werden diese beiden Motive, Neuroenhancement zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit im Alltag 223 neben dem Wunsch nach einer generellen, unspezifischen Erhöhung des kognitiven Potentials, als hauptsächliche Gründe für die Einnahme von leistungssteigernden Substanzen berichtet (Eickenhorst et al., 2012). In einer Umfrage zum Gebrauch von Energiedrinks gaben zwei Drittel der studentischen Befragten an, diese zur Energiesteigerung zu konsumieren oder um mit ihrer Unausgeschlafenheit umzugehen (Malinauskas et al., 2007). Sowohl Lifestyle- als auch verschreibungspflichtige Substanzen werden von Studierenden zur Vorbereitung auf Prüfungssituationen eingesetzt (Middendorf, Poskowsky, & Isserstedt, 2012). Unter Umständen geschieht dies deshalb, weil sie sich in Prüfungszeiträumen besonderem Stress ausgesetzt sehen. Dass Neuroenhancement und wahrgenommener Stress in einem Zusammenhang stehen, ist für das Setting Universität nachgewiesen (Weyandt et al., 2009). Auch an Berufsschülern wurde dies bereits gezeigt (Wolff & Brand, 2013). Während in US-amerikanischen Studien berichtet wird, dass sich die Geschlechter in ihrem Konsumverhalten unterscheiden (mehr Männer als Frauen neigen zu Neuroenhancement; McCabe et al., 2005), findet sich diese Differenz in deutschen Stichproben nicht (Franke et al., 2011; Mache et al., 2012). Unterschiede in Persönlichkeitseigenschaften könnten ebenfalls Einfluss haben. Eine Studie verweist auf die höhere emotionale Instabilität (Neurotizismus) unter Neuroenhancement-Nutzern (Middendorf et al., 2012). Auch wurde der Gebrauch verschreibungspflichtiger und illegaler Substanzen mit der Suche nach neuen Erfahrungen und Erlebnissen (engl. sensation seeking) zusammengebracht (Low & Gendaszek, 2002). Die wichtigste Gemeinsamkeit aller hier dargestellten Befunde (und einigen ähnlichen mehr) ist, dass sie bloße Beschreibungen von (meist einfachen bivariaten) Zusammenhängen darstellen. Deshalb erlauben sie keine Rückschlüsse auf mögliche Ursache-Wirkungs-Relationen. Zudem sind die Resultate allesamt an Stichproben aus dem Schul- und Universitätskontext gebunden, beruhen also größtenteils auf der Befragung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, was eine Verallgemeinerung der gewonnenen Erkenntnisse auf die gesamtgesellschaftliche Situation erschwert. 4.2 Komplexere Ansätze zur Verhaltenserklärung In nahezu allen empirischen Untersuchungen zur Frage, weshalb Menschen leistungssteigernde Substanzen im Alltag einnehmen, wird dieses Verhalten als Zielvariable (abhängige Variable, Kriterium) operationalisiert. Und es wird nach 224 Franz Baumgarten, Wanja Wolff & Ralf Brand Faktoren (unabhängigen Variablen, Prädiktoren) geforscht, die mit Neuroenhancement einhergehen oder es bedingen können. Jedoch wäre es sehr viel konsequenter, die Rolle des Verhaltens Neuroenhancement, welches ja schon selbst ein Mittel zur Zielerreichung ist (Leistungssteigerung), als Verhaltensoption zur Beeinflussung von Leistung zu modellieren. Mit Blick auf die bisherigen (oben dargestellten) Forschungslinien, bietet beispielsweise die Job-Demand-Ressources-Theory einen theoretischen Rahmen dafür (Bakker & Demerouti, 2014). Diese empirisch im Kontext von Erwerbstätigkeiten bewährte Theorie setzt wahrgenommene Ressourcen und Anforderungen im Arbeitsumfeld mit motivationalen Voraussetzungen in Verbindung und postuliert differentielle Auswirkungen auf die Gesundheit und Leistung. Angewandt auf Neuroenhancement konnten wir in einer Pilotuntersuchung mit einer Stichprobe von 1.007 Studierenden in Deutschland zeigen, dass der Konsum von Lifestyle Substanzen die Wechselwirkung zwischen Anforderungen, die als zu hoch wahrgenommen werden, und Gefühlen von Burnout verstärkt (Wolff, Brand, Baumgarten, Lösel & Ziegler, 2014). Außerdem konnte innerhalb dieser Untersuchung belegt werden, dass der Gebrauch von verschreibungspflichtigen Substanzen zusätzlich den protektiven Einfluss von Ressourcen schwächt, konkret den einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung auf die intrinsische Motivation. Beide Effekte gehen mit schwächeren Leistungen im Studium einher. Zwar basiert auch diese Pilotuntersuchung noch auf Querschnittsdaten, jedoch ist offensichtlich, dass solche Verhaltensmodellierungen zu wesentlich differenzierteren Einordnungen über die spezifische Wirkung von Neuroenhancement führen werden. Längsschnittliche Untersuchungen sollten den nächsten Schritt zur Überprüfung dieser noch vorläufigen Erkenntnisse darstellen. Parallel dazu sollten experimentelle Strategien verfolgt werden. Erst solche erlauben kausale Schlüsse über die Verhaltensentstehung. Die randomisierte Zuweisung von Teilnehmern und eine hohe interne Validität dieses Untersuchungstypes ermöglicht die Kontrolle konfundierender Variablen (z.B. besondere Lebensereignisse). Soweit uns bekannt, gibt es bislang erst eine einzige solche Untersuchung. In ihr konnte gezeigt werden, dass ein kurzzeitiger Verlust mentaler Selbstkontrollressourcen (engl. ego-depletion) die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass mit Neuroenhancement unerfahrene Probanden eine Lifestyle-Substanz einsetzen, um in einer nachfolgenden Leistungsaufgabe erfolgreicher zu sein (Wolff, Baumgarten & Brand, 2013). Neuroenhancement zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit im Alltag 225 Dieses im Experiment beobachtete Verhalten mag dem, was viele annehmen widersprechen, nämlich, dass der erstmalige Gebrauch leistungssteigernder Substanzen vor allem in Situationen geschieht, in denen mentale Kapazitäten erschöpft sind. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass der Entscheidung pro Neuroenhancement eher ein bewusster (kontrollierter) Abwägungsprozess vorausgeht, der vielleicht eher durch Neugier, als durch eine Furcht vor negativen Auswirkungen geprägt sein könnte. Dementsprechend wären in Präventionsmaßnahmen für Personen, die Neuroenhancement noch nie versucht haben (wenn denn überhaupt präventiert werden soll), wohl vor allem Informationen zur Beeinflussung dieses Abwägungsprozesses sinnvoll. Solche zum „richtigen“ Reagieren in Stresssituationen erscheinen demgegenüber eher überflüssig. 5 Ethische Bewertung Die Debatte zur ethischen Bewertung und Einordnung von Neuroenhancement wird kontrovers geführt. Befürworter und Gegner bringen unterschiedliche Argumente ins Feld, die den jeweiligen Standpunkt untermauern. Die gegenwärtige Debatte entspinnt sich entlang der Diskussionslinien persönliche Freiheit vs. Reglementierung, sozialer Druck vs. gesellschaftlicher Fortschritt, Gleichheit vs. Ungleichheit und Kosten v. Nutzen. Die persönliche Freiheit des Einzelnen wird als gewichtiges Argument pro Neuroenhancement ins Feld geführt. Allerdings sind bestimmte Bevölkerungsgruppen vom Gebrauch dieser individuellen Freiheit a priori ausgeschlossen (z.B. Kinder), oder es steht der Gebrauch bestimmter Substanzen mit gegenwärtigem Recht in Widerspruch. Brisanz erhält die Diskussion dadurch, dass Verflechtungen von Wissenschaftlern, die eine Legalisierung bestimmter Psychopharmaka fordern, mit der Pharmaindustrie nachgewiesen werden konnten (Grüter, 2011). Wenn die substanzgetriebene Selbstoptimierung keine negativen Konsequenzen für Dritte mit sich führt, wird das Freiheitsargument von vielen Autoren einer stärkeren Reglementierung vorgezogen (Biedermann, 2010; Linoh, 2011). Das Ausschließen negativer Konsequenzen für Dritte ist allerdings gar nicht so einfach. Wenn durch die Beanspruchung individueller Freiheitsrechte die Leistungsfähigkeit Einzelner erhöht wird, kann dies Dritte dazu zwingen, pharmakologisch nachzurüsten (Cacik, 2009; Flaskerud, 2010; Lieb, 2010; Sahakian & Morein-Zamir, 2011; SchöneSeifert, 2009). Dies ist inbesondere dann der Fall, wenn durch die Einnahme von Substanzen begrenzte Ressourcen (z.B. Anstellungsverhältnisse im Berufsleben) 226 Franz Baumgarten, Wanja Wolff & Ralf Brand erreicht werden können. Das Argument der Nichtschädigung Dritter wäre in diesem Fall verletzt. Wird Neuroenhancement allerdings schlicht als Symptom gesellschaftlichen Fortschritts verstanden, dann handelt es sich nicht mehr um von Einzelnen ausgeübten Druck, sondern um einen gesamtgesellschaftlichen Trend, an den Menschen sich anpassen (Schöne-Seifert, 2009). Dieses Argument ist dynamisch, weil die Bewertung mit der aktuellen Verbreitung und Akzeptanz von Neuroenhancement korrespondiert: Bei geringer Verbreitung gleicht es einem „unter Druck setzen“ Dritter, bei hoher Verbreitung ist es eine gesamtgesellschaftlich zu erfüllende Norm. Umgekehrt würden dann Einzelne von der Gesellschaft regelrecht aufgefordert, ihre Leistungsfähigkeit kognitiv zu steigern, wenn dadurch ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen resultiert. Empirisch deutet sich aktuell z.B. schon jetzt eine erhöhte Akzeptanz des Neuroenhancements unter Ärzten und Piloten an (Franke et al., 2012). Verteilungsgerechtigkeit ist zentral, wenn sich Neuroenhancement zur gesamtgesellschaftlichen Notwendigkeit entwickelt. Befürworter spekulieren, bei unbeschränktem Zugang ließen sich soziale Unterschiede nivellieren (Lieb, 2010). Unterstützt wird dieses Argument durch den Befund, dass Neuroenhancement bei Leistungsschwachen effektiver ist (Mehta et al., 2000). Durch soziale oder monetäre Zugangsbeschränkungen könnten bestehende Ungleichheiten allerdings auch verstärkt werden (Farah et al., 2004; Flaskerud, 2010). Die Fairnessfrage wird außerdem vor dem Hintergrund diskutiert, ob im beruflichen Setting überhaupt eine Wettbewerbssituation herrsche, die vergleichbar der Situation im Sport unfaire Wettbewerbsvorteile ermögliche (Biedermann 2009; Godmann, 2010; SchöneSeifert & Talbot, 2010). Das Argument, dass im gesellschaftlichen Wettbewerb aufgrund fehlender „Spielregeln“ kein Betrug möglich sei, wirkt dabei jedoch reichlich artifiziell (Biedermann, 2009). Der Verweis auf eine nur ausschnitthaft kodifizierte Ethik im Geschäftlichen mag von einem juristischen Standpunkt aus stichhaltig sein. Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Normen verliert er an Gewicht. Zentral für die ethische Bewertung von Neuroenhancement ist nicht zuletzt das mit dem Verhalten einhergehende Kosten-Nutzen-Verhältnis. Neben den bereits aufgeführten Risiken wird vor möglicherweise persönlichkeitsverändernden Effekten der Einnahme leistungssteigernder Mittel im Alltag gewarnt. Substanzoptimierte Leistungsfähigkeit könnte mit einem Verlust von Authentizität einhergehen und wäre so teuer erkauft (Linoh, 2011; Schäfer & Groß, 2008); zumal dies zu einer Verschiebung dessen führen könnte, was als normal und gesund gelten soll (Lev, Neuroenhancement zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit im Alltag 227 Miller, & Emanuel, 2010). Kritiker befürchten zum Beispiel eine “Medikalisierung gesunder Zustände” (Schöne-Seifert, 2009, S. 39). Auf Nutzenseite steht demgegenüber die Möglichkeit das volle kognitive Potential eines jeden Einzelnen zu aktivieren und somit – individuell wie auch gesamtgesellschaftlich – Leistungsfähigkeit zu verbessern (Biedermann, 2009; Lieb, 2010). Einerseits wäre die Steigerung von Wissen und Lernleistung ein in einer Wissensgesellschaft durchaus gewichtiges Argument. Andererseits relativieren vorliegende Befunde, die auf eher geringe leistungssteigernde Effekte der meisten Substanzen verweisen und die noch nicht abschätzbaren negativen Gesundheitsfolgen, dieses Argument noch erheblich (Flaskerud, 2010; Sahakian & Morein-Zamir, 2011). Eine Bewertung der mit dem Phänomen Neuroenhancement verbundenen ethischen Aspekte, die eine Analogie der Debatte mit dem Phänomen Doping im Sport erlauben würde, steht noch aus. Aktuelle ethische Erörterungen sollten daher vor allem als Vorlage für politische Steuerungsstrategien genommen werden, da sie sehr unterschiedliche Aussichten über die Zukunft einer „enhanceten“ Gesellschaft entwerfen. 6 Fazit Nicht nur in den Medien ist in der jüngsten Vergangenheit ein deutlich wachsendes Interesse am Thema Neuroenhancement wahrzunehmen. Wahrscheinlich, weil sich die Analogie zum Doping im Sport zumindest auf den ersten Blick anbietet, zeugen diese Medienberichte aber häufig eher von der Jagd nach der schnellen, spektakulären Schlagzeile („Hirndoping im Studium – Pillen für den Lernrausch“; Witte, 2013), als dass in diesen sorgfältig mit dem zur Verfügung stehenden Wissen umgegangen würde. Tatsächlich ist es nämlich so, dass die Forschung zum Neuroenhancement noch in vielerlei Hinsicht, methodisch wie inhaltlich, in den Kinderschuhen steckt. Am Dringlichsten für die Zukunft erscheint es uns, dass die gesundheitlichen Folgen dieses Verhaltens vollständiger abgeschätzt werden. Für manche Substanzen, z.B. Amphetamine, sind diese gut belegt, für andere, z.B. Taurin in Energie Drinks, ist kaum Wissen vorhanden. Außerdem sollte die ethische Debatte über das Für und Wider vorangebracht werden. Dies mit dem Ziel, dass in naher Zukunft hoffentlich ein gesellschaftlicher Verständigungsprozesses über das Verhalten Neuroenhancement einsetzen möge. Franz Baumgarten, Wanja Wolff & Ralf Brand 228 7 Literaturverzeichnis Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2014). Job demands-resources theory. In P. Y. Chen & C. L. Cooper (Hrsg.), Work and Wellbeing: A complete reference guide (pp. 37-64). Chichester: Wiley-Blackwell. Biedermann, F. (2010). Argumente für und wider das Cognitive Enhancement. Ethik in der Medizin, 22, 317-329. Cakic, V. (2009). Smart drugs for cognitive enhancement: ethical and pragmatic considerations in the era of cosmetic neurology. Journal of Medical Ethics, 35, 611-615. Clark, V. P., & Parasuraman, R. (2014). Neuroenhancement: Enhancing brain and mind in health and in disease. NeuroImage, 85, 889-894. Dietz, P., Striegel, H., Franke, A. G., Lieb, K., Simon, P., & Ulrich, R. (2013). Randomized Response Estimates for the 12-Month Prevalence of CognitiveEnhancing Drug Use in University Stu-dents. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 33, 44-50. Eickenhorst, P., Vitzthum, K., Klapp, B. F., Groneberg, D., & Mache, S. (2012). Neuroenhancement among German university students: motives, expectations, and relationship with psychoactive lifestyle drugs. Journal of psychoactive drugs, 44, 418-427. Elliott, S. (2008). Erythropoiesis-stimulating agents and other methods to enhance oxygen transport. British journal of pharmacology, 154, 529-541. Farah, M. J., Illes, J., Cook-Deegan, R., Gardner, H., Kandel, E., King, P., Wolpe, P. R. (2004). Neurocognitive enhancement: what can we do and what should we do? Nature Reviews Neuroscience, 5, 421-425. Flaskerud, J. H. (2010). American culture and neuro-cognitive enhancing drugs. Issues in mental health nursing, 31, 62-63. Foddy, B., & Savulescu, J. (2007) Ethics of Performance Enhancement in Sport: Drugs and Gene Doping. In R. E. Ashcroft, A. Dawson, H. Draper & J. R. McMillan (Eds.), Principles of Health Care Ethics (p. 511-519). Chichester: John Wiley & Sons. Franke, A. G., Bonertz, C., Christmann, M., Engeser, S., & Lieb, K. (2012). Attitudes toward cognitive enhancement in users and nonusers of stimulants for cognitive enhancement: A pilot study. AJOB Primary Research, 3(1), 10. Franke, A. G., Bonertz, C., Christmann, M., Huss, M., Fellgiebel, A., Hildt, E., & Lieb, K. (2011). Non-medical use of prescription stimulants and illicit use of stimulants for cognitive enhancement in pupils and students in Germany. Pharmacopsychiatry, 44, 60-66. Goodman, R. (2010). Cognitive Enhancement, Cheating, and Accomplishment. Kennedy Institute of Ethics Journal, 20, 145-160. Grüter, T. (2011). Klüger als wir? Auf dem Weg zur Hyperintelligenz. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. Neuroenhancement zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit im Alltag 229 Low, G. K., & Gendaszek, A. E. (2002). Illicit use of psychostimulants among college students: a preliminary study. Psychology, Health & Medicine, 7, 283-287. Hildt, E., Lieb, K., & Franke, A. G. (2014). Life context of pharmacological academic performance enhancement among university students-a qualitative approach. BMC Medical Ethics, 15(1), 23. Kicman, A. T. (2008). Pharmacology of anabolic steroids. British Journal of Pharmacology, 154, 502-521. Lev, O., Miller, F. G., & Emanuel, E. J. (2010). The Ethics of Research on Enhancement Interventions. Kennedy Institute of Ethics Journal, 20, 101-113. Lieb, K. (2010). Hirndoping: Warum wir nicht alles schlucken sollten. Mannheim: Artemis & Winkler. Linoh, K. P. (2011). Tagungsbericht “Hirndoping und Neuroenhancement– Möglichkeiten und Grenzen”. Medizinrecht, 29, 353-357. Mache, S., Eickenhorst, P., Vitzthum, K., Klapp, B. F., & Groneberg, D. A. (2012). Cognitive-enhancing substance use at German universities: frequency, reasons and gender differences. Wiener Medizinische Wochenschrift, 162, 262271. Maher, B. (2008). Poll results: look who's doping. Nature, 452(7188), 674-675. Malinauskas, B. M., Aeby, V. G., Overton, R. F., Carpenter-Aeby, T., & BarberHeidal, K. (2007). A survey of energy drink consumption patterns among college students. Nutrition Journal, 6, 35-41. McCabe, S. E., Knight, J. R., Teter, C. J., & Wechsler, H. (2005). Non-medical use of prescription stimulants among US college students: prevalence and correlates from a national survey. Addiction, 100, 96-106. Mehta, M. A., Owen, A. M., Sahakian, B. J., Mavaddat, N., Pickard, J. D., & Robbins, T. W. (2000). Methylphenidate enhances working memory by modulating discrete frontal and parietal lobe regions in the human brain. Journal of Neuroscience, 20(6). RC65 (1–6). Middendorff, E., Poskowsky, J., & Isserstedt, W. (2012). Formen der Stresskompensation und Leistungssteigerung bei Studierenden. Hannover: HIS Hochschul-Informations-System. Partridge, B. J., Bell, S. K., Lucke, J. C., Yeates, S., & Hall, W. D. (2011). Smart drugs “as common as coffee”: media hype about neuroenhancement. PLoS One, 6(11), e28416. Repantis, D., Schlattmann, P., Laisney, O., & Heuser, I. (2010). Modafinil and methylphenidate for neuroenhancement in healthy individuals: A systematic review. Pharmacological Research, 62, 187–206. Sahakian, B. J., & Morein-Zamir, S. (2011). Neuroethical issues in cognitive enhancement. Journal of Psychopharmacology, 25, 197-204. Schäfer, G., & Groß, D. (2008). Enhancement: Eingriff in die personale Identität. Deutsches Ärzteblatt, 105(3), 4. 210-212. Franz Baumgarten, Wanja Wolff & Ralf Brand 230 Schöne-Seifert, B. (2009). Neuro-Enhancement: Zündstoff für tiefgehende Kontroversen. In B. Schöne-Seifert, J. S. Ach, U. Opolka, D. Talbot (Hrsg.), Neuro-Enhancement: Ethik vor neuen Herausforderungen (S. 347-363). Paderborn: Mentis,. Schöne-Seifert, B., & Talbot, D. (2010). (Neuro-)enhancement. In H. Helmchen & N. Sartorius (Eds.), Ethics in psychiatry: European contributions (509-530). New York: Springer Science + Business Media. Sjöqvist, F., Garle, M., & Rane, A. (2008). Use of doping agents, particularly anabolic steroids, in sports and society. The Lancet, 371(9627), 1872-1882. Smith, M. E., & Farah, M. J. (2011). Are prescription stimulants “smart pills”? The epidemiology and cognitive neuroscience of prescription stimulant use by normal healthy individuals. Psychological bulletin, 137, 717. Teter, C. J., McCabe, S. E., LaGrange, K., Cranford, J. A., & Boyd, C. J. (2006). Illicit use of specific prescription stimulants among college students: prevalence, motives, and routes of administration. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 26, 1501-1510. Thielmann, B. (2009). Doping am Arbeitsplatz - DAK Gesundheitsreport 2009. Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie, 59, 278-279. Turner, D. C., Robbins, T. W., Clark, L., Aron, A. R., Dowson, J., & Sahakian, B. J. (2003). Relative lack of cognitive effects of methylphenidate in elderly male volunteers. Psychopharmacology, 168, 455-464. Warner, S. L. (1965). Randomized response: A survey technique for eliminating evasive answer bias. Journal of the American Statistical Association, 60, 6369. Witte, F. (2013, 9. November). Hirndoping im Studium. Pillen für den Lernrausch. Süddeutsche Zeitung, Zugriff am 5.4.2014 unter http://www.sueddeutsche.de/ bildung/hirndoping-im-studium-pillen-fuer-den-lernrausch-1.1814351 Wolff, W., Baumgarten, F., & Brand, R. (2013). Reduced self-control leads to disregard of an unfamiliar behavioral option: An experimental approach to the study of neuroenhancement. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 8:41. Wolff, W. & Brand, R. (2013). Subjective stressors in school and their relation to neuroenhancement: a behavioral perspective on students' everyday life "doping". Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 8:23. Wolff, W., Brand, R., Baumgarten, F., Lösel, H., & Ziegler, M. (2014). Modeling students' instrumental (mis-)use of substances to enhance cognitive performance: Neuroenhancement in the light of job-demands-resources theory. BioPsychoSocial Medicine, 8:12. Weyandt, L. L., Janusis, G., Wilson, K. G., Verdi, G., Paquin, G., Lopes, J., . . . Dussault, C. (2009). Nonmedical prescription stimulant use among a sample of college students relationship with psychological variables. Journal of Attention Disorders, 13, 284-296. View publication stats